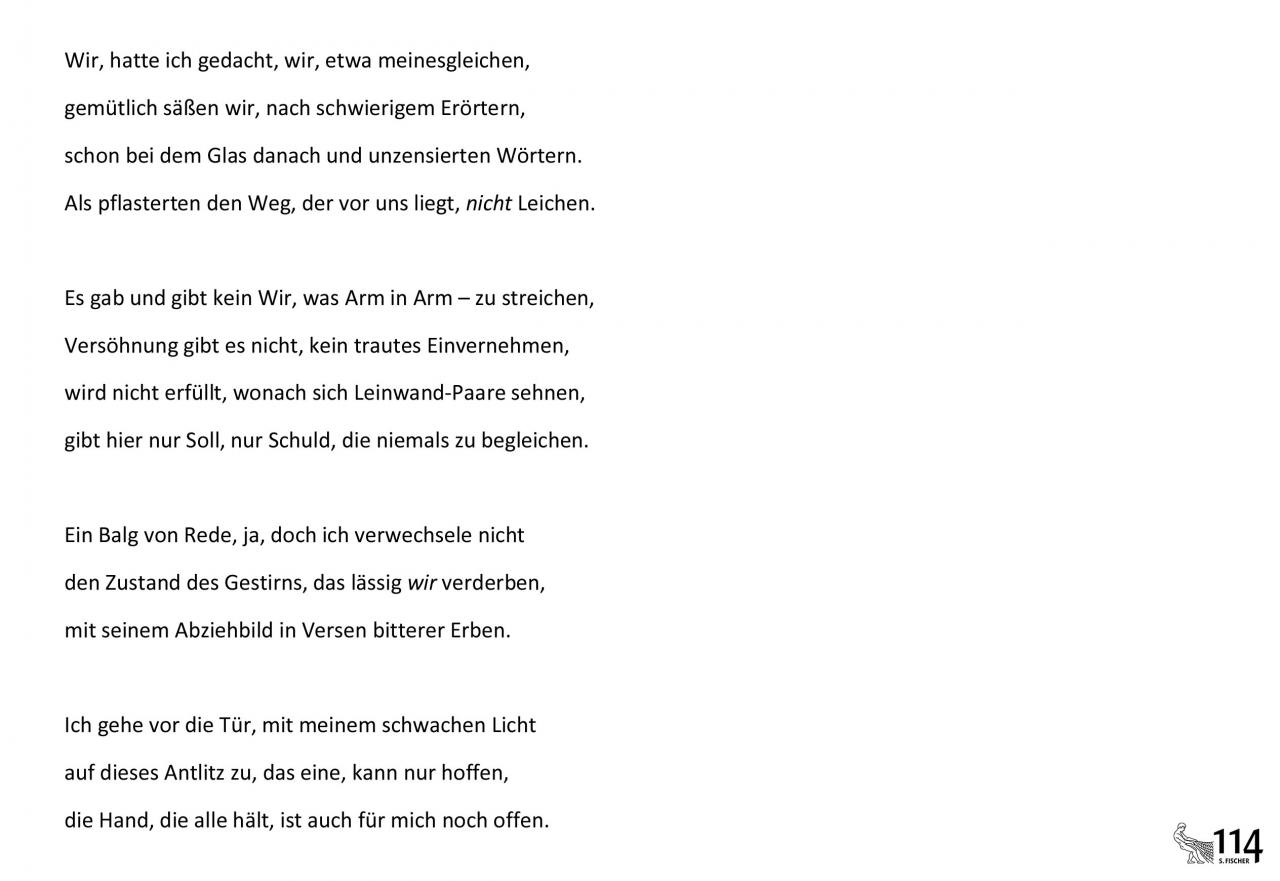
Kommentare
großartig wie die form hier gegen das arbeitet, was sie generiert. ein sonettsonett.
Hm? Könnten Sie das noch genauer erklären? Was wird generiert und wie arbeitet die Form dagegen?
Wie demütig dieses Gedicht ist. Offenbar einem Augenblick der Schwäche - oder eben der Klarsicht - entwunden. Ob das "der Zustand" ist? Das "Wir" lese ich als Dichter-Wir (das es nicht gibt). Der Dichter klagt sich und seine Zunft der Scheinheiligkeit an. Vielleicht geht es auch um die Auseinandersetzung mit den Ahnen, das schlechte Gewissen, der Bitte um Nachsicht nicht nachgekommen zu sein. "Die Hand, die alles hält" - das ist doch eine verblüffend religiöse Geste, sie als Hoffnung in den letzten Vers zu setzen. Ein erstaunliches Gedicht. Auf den ersten Blick zugänglich, wird es immer komplizierter, zumal sich am Schluss dann doch "hoffen" auf "offen" reimt.
es ist vielleicht eine Herkunft, die vom Wir geprägt war, das zerfiel. und dieses Zerfallen in eine tradierte Form hinein ist schon merkwürdig. und sicher ist der Text auch sentimental. doch sehnt der Text sich nicht zurück. Rückwärts weist die Form allein.
Aber das Wir ist doch gar nicht zerfallen, im ersten Terzett ist es doch noch da als Vorstellung, wenn auch kursiv. Und der Zustand ist doch ein gegenwärtiger, es geht doch nicht nur um eine zurückliegende Form, nicht nur um Herkunft. Der "Zustand des Gestirns" wird doch jetzt "lässig" verdorben durch dieses "wir", durch die "bitteren Erben", die nicht mehr als "Abziehbilder" schaffen. Das ist doch schon ein manifester Vorwurf und eine Selbstanklage. Das Gestirn - die Künste? Und am Ende: die Dichtung? Oder gerät auch sie in Verruf?
Von einem und von zweien; einerseits, »meinesgleichen«, andererseits »Einvernehmen«, »Leinwand-Paare« und »Wir«. Spielerisch unklar bleibt, ob hier auf kleiner, mittlerer oder großer Ebene gesprochen wird, ob über Liebe, Pflicht oder ganz großer Geworfenheit (wem gehören »Antlitz« und »Hand«?): beim besagten »Zustand« ist alles drin.
Ein bitterer Erbe spricht in vierzehn wuchtigen Versen. Er kennt kein „Wir“ mehr, ist den Menschen fremd – die anderen, das sind nur noch „etwa“ Seinesgleichen. Woher kommt die Differenz? Aus der Vergangenheit? Doch der Blick geht in die Zukunft. Aber auch sie ist bereits geprägt - durch eine offene Rechnung, durch eine Schuld, die niemals zu begleichen ist. Gespräche sind nicht mehr möglich, wer sie dennoch führt, erliegt der Illusion. Überraschend ist der Perspektivwechsel der dritten Strophe. Jetzt kommt eine weitere, eine andere Schuld in den Blick, eine ökologische. Das Gedicht wird nicht ohne Stolz als Abziehbild des ruinierten Planeten diffamiert und mündet in eine zaghafte Erlösungsphantasie, in deren „schwachem Licht“ die Schuld noch einmal andere, nämlich metaphysische Konturen annimmt. Kommt die „offene Hand“, Sinnbild aller Vergebung, dem Kitsch nicht allzu nahe? Nein, kommt sie nicht.
Ich habe den Eindruck, hier wird auf mehreren Ebenen gesprochen, zumindest durchdringen die große und kleine Ebene einander, nicht? Sehnsucht nach "unzensierten Wörtern", nach offener Gesellschaft, mit Popper gesprochen. Und die (kursiv gesetzten) Leichen wären dann die Opfer real existierender geschlossener "Wir"-Gesellschaften? Und soweit, bis zur dritten Strophe, das "Große". Aber dann, in der vorletzten Zeile, geht das "Ich" auf ein "Antlitz" ("das eine") zu - da fiel mir sofort Levinas ein. Ein Antlitz! Das Hoffnung gibt. Der Einzelne. Der Eine. Da wird es fast privat. Und diese Spannung - gefällt mir. Ein großartiges Gedicht, hinter dem, da mag Jan Kuhlbrodt recht haben, eine vom "Wir" geprägte - und vom "Wir" enttäuschte - Herkunft steht.
Der da spricht, geht hinaus wie eine der Jungfrauen aus Matthäus 25. Immerhin zu den klugen gehörend, hat er aber nicht allzu viel Öl auf der Lampe. Vielleicht hatte er kein Geld, um mehr zu kaufen. Vielleicht war er nicht vorausschauend, nein, bestimmt nicht. Wenn er dann zur Türe kommt, hoffend, dass noch offen, gilt letzteres für den Ausgang der ganzen Sache. Wie geht es wohl einem, der diesen Reim aus der Truhe holt?
strophe eins uns zwei sind ganz stark in ihrer mischung aus lapidarer resignation, rätselhaftigkeit und stimmungsvollem in-fom-setzen. strophe drei hängt dann durch und das ende sucht nach einem strohhalm (wie es jemand macht, dem es wie get, wenn er aus der truhe verstaubtes holt?). knüpft aber durchaus an den anfang an. rettung durch form, das gefällt mir.
Eine Abrechnung in Sonettform: mit der Illusion des Wir, der Liebe, der Poesie. Statt Versöhnung und "trautem Einvernehmen" gibt es nur Schuld, die "niemals zu begleichen" ist, auch nicht durch das Wort, scheitert dieses doch an seinem Abziehbild-Charakter, "ein Balg von Rede". Und doch bemüht der Autor das Wort, um seiner Hoffnung Ausdruck zu geben, dass da ein Antlitz ist und eine Hand, die ihn nicht abweisen. Auf diese Instanz steuert das Gedicht zu. Und entpuppt sich so nicht nur als resignatives Reuebekenntnis, sondern als Gottsuche im emphatischen Sinn.







 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /