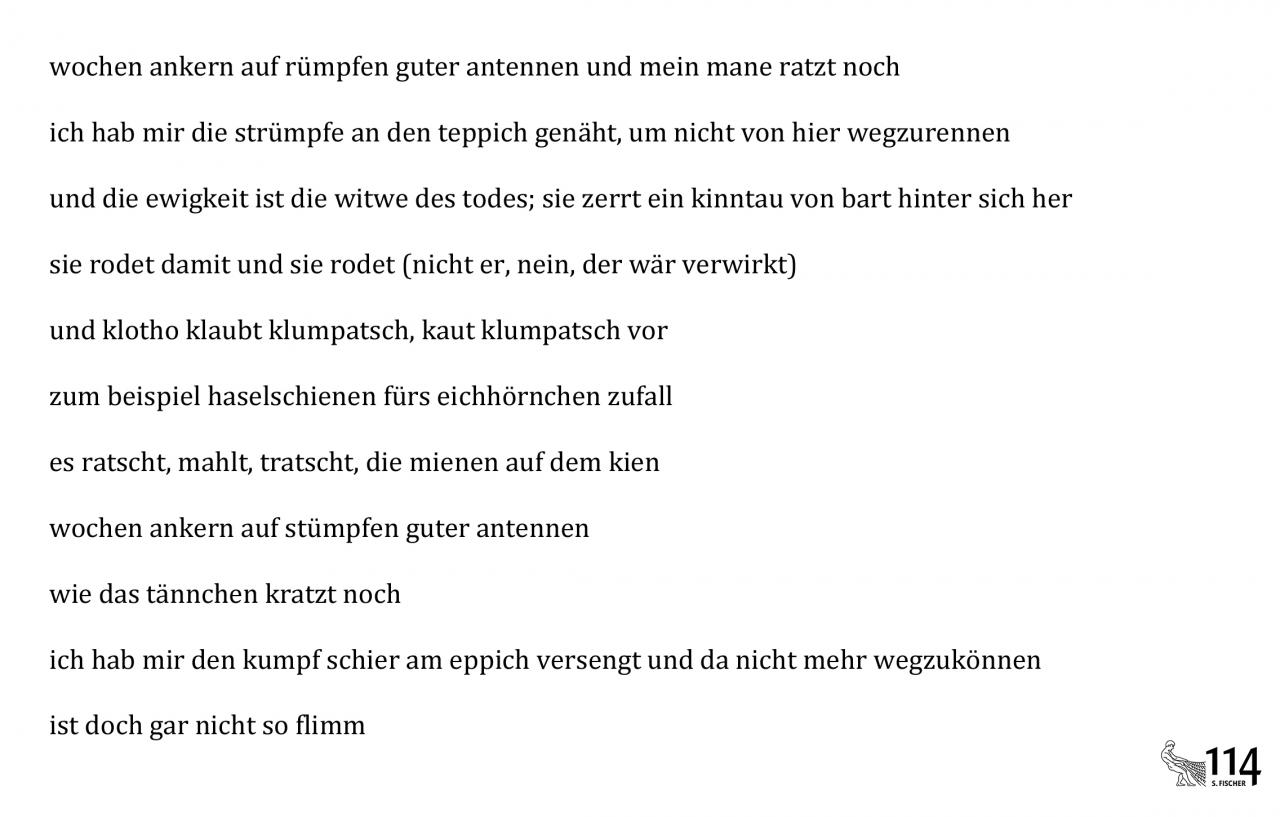
Kommentare
Was für eine erste Bildfolge, gewagt, befremdlich, im höchsten Tempo durch den Vers gejagt. Da muss man mit seiner Vorstellungskraft erst einmal hinterherkommen. Die Rasanz der Bilder steht im Kontrast zum Thema der ersten beiden Verse: dem Ankern, dem noch Schlafen, dem wie festgenähten Stehenblieben. Extreme Dynamik im Stillstand. Das gilt auch für die letzten vier Verse, welche die ersten noch einmal wiederholen. Nicht ohne ihnen einen neuen Dreh zu geben. Ja bei diesem Rahmen lässt sich das nicht leugnen: hier ist etwas durch die Verschiebung minimaler Einheiten (rümpfen, strümpfe, stümpfe; klaubt, kaut; ratscht und tratscht, in eine wundersame Un- oder Neuordnung geraten: Der Tod ist tot, es lebt die Ewigkeit, deren Zeitlosigkeit mit dem Preis zu zahlen ist, dass sich die Lebensfäden zu einem großen Haufen Unzusammenhängenden verheddert haben. Und da steht sie jetzt die Schicksalsgöttin vor dem Klumpatsch und stellt fest: "ist doch gar nicht so flimm."
"und die ewigkeit ist die witwe des todes" mag ich unfassbar! Sobald ich’s gedacht geschafft hatte, wollt’ ich zu flattern anfangen!
das ist ja nun wirklich die Zeile, an der man (negativ) hängenbleibt. Genetivmetapher, schwierig, und dann auch noch Ewigkeit Witwe und Tod in einem Satz? mehr Disziplin bitte
Unabhängig davon, ob es eine Frage des "Mans" und der eingeforderten Disziplin sei, scheint Sprache mir zunächst und zumeist ein Fall von Umgebung, die sie ermöglicht – generelle Schwierigkeit von Genetivmetaphern einzuklagen, nur weil sich irgendjemand mal an ihnen den Zeh stieß, empfinde ich eher als schwierig; nämlich genau dann, wenn aus Zehschmerzen Gesetze werden. Einen Satz konnte ich nicht finden, zumindest keinen, der sich eindeutig abgrenzt. Weswegen m.E. die Möglichkeit besteht, dass da noch mehr steht im Satz, außer "Ewigkeit", "Witwe" und "Tod"; nämlich die Zeile davor und dahinter mitgenommen. Womit lediglich festgestellt wäre, dass die genannten Substantive nah beieinander sind, ja. Nicht aber des Satzes, sondern der Nähe wegen. Womit die Frage nach Entfernungen gestellt wäre: Ab wann weilen nicht zueinander gehörende Worte weit genug fern voneinander, um beisammen sein zu dürfen? Sprache, als ein Fall von Umgebung, sagte ich anfangs – und die stimmt, m.E.; auch für die Damen "Ewigkeit", "Witwe" und "Tod".
die zeile fängt damit an und der genetivvergleich endet mit dem semikolon, da ist also fast nichts zu retten. verbannung der genetivmetapher habe ich an keiner stelle zum gesetz gemacht. mehr disziplin bitte auch beim lesen. nur gesagt, das ist eine schwierige kiste. klar, auf den kontext kommt es an. der ist hier auch so rasant, dass man das fast verzeiht. aber ausgerechnet dieses bild zum besten zu erklären verrät einen mangel an disziplin auch beim leser. inhaltlich gibt das auch nicht viel mehr her, als das die ewigkeit den Tod überdauert. weiblich, männlich, ganz nett, aber was solls? dafür also eine genetivmetapher auffahren? nein danke. dem autor/autorin ist es selbst wohl aufgefallen, deswegen gleich auch die ironisierung im anschluss. vielleicht sollte es auch selbst ironisch bereits sein. insgesamt ein schönes schrulliges gedicht mit einer ganz schwachen genetivmetapher in der dritten zeile
ich kann es auch noch genauer begründen: leben ist eines, tod ein zweites, eine art übergang, ende, was auch immer – und dann wär dann noch die ewigkeit, von der wir so wenig wissen wie vom tod, eine vorstellung, vermutlich geboren aus der verneinung der endlichkeit (tod des tods?). so weit so schön, diese zusammenhänge anzugehen. aber der tod ist eben nicht die endlichkeit, er war auch nicht mit der ewigkeit verheiratet (was hieße hier heirat?). das sind immense probleme, riesige begriffe. poesie kann eigentlich durch bilder öffnen, durch konkrete ineinanderschiebung räume/spalte öffnen etc. hier aber presst man riesige begriffe in ein putziges bild zusammen, das gar nichts erklärt (wenn es auch, das sei immerhin zugegeben, die problematik anvisiert), aber das gefühl mit gibt: jaja, die ewigkeit bleibt zurück, wenn tod und leben als begriffe sich auflösen etc.. und dann geht es auch schon gleich weiter zu kinntau und bart, auch putzig. dabei mag ich das schrullige, kauzige, auch das versprechen. aber ewigkeit, witwe und tod quetschen sich dabei zu eng ineiander und stehen sich auf den füßen. in ewigkeit angst und champagner! wie gesagt, trotzdem ein schönes gedicht.
Oh, nun kamen neue Antworten während des Antwortens hinzu – das führt zu Überschneidungen in der Kommunikation und zum Willen der Unübersichtlichkeit. Wohlan, weiterhin also hier mitgeteilt: was die Heirat angeht, so ist diese in der Tat ungeklärt. Meine Phantasie erlaubte mir, es habe sie gegeben. Die Dame Ewigkeit blieb zurück; der Tod erstarb irgendwann, sagen wir, an einem zähen Schnupfen. Seitdem also kann sie leben, er setzt kein Ende mehr. Aber gestorben wird weiterhin, das merken wir ja – siehe Peter Lustig. Wovon also berichtet die Zeile? Ein Mythos vom Urknall, der noch kommen wird? Und möge die Logik milde lächeln, sich einen Bart wachsen lassen und mit selbigem davon rennen, in der Vorsicht, nicht über ihn zu stolpern. Gern gelesen hab ich’s trotzdem; vielleicht male ich viel und zu viel aus. Aber sind dafür nicht Worte da? Dass meine Farben selber machen, wo sie’s mögen täten, im Zwischenraum?
Verzeihung bitte, wenn ich ob der genauigsten Ausführung von "Genetivmetapher, schwierig" mir erlaubte, dem Verfasser nachzuhelfen und die fehlenden Worte durch eigene zu ergänzen. Dass dabei die Genetivmetapher nicht zum Gesetz erklärt wurde, tut mir sehr leid; anders schien aber auch nicht der Fall zu sein. Womit es sich vielleicht einfach um zu wenig Worte handelte; oder um zu viele, die nicht waren. Was ja beides ein Fall sein könnte, je nach dem. Das muss dann die Genauigkeit der Disziplin oder die Disziplin der Genauigkeit entscheiden. Und wehe eine von beiden kommt hinten rum! Dann ist es Zeit, Kaffee zu holen! Obacht, Straßenverkehr!
Nun ja, das "man" hat schon etwas gesetzheischendes. oder simulierendes. ich bitte um verzeihung und nehme das "man bleibt hängen" gern zurück.
Ich lese, ich versteh nicht, ich lese interessiert, ich freu mich, es "pastiort" ein wenig, es alliteriert heftig ("klotho klaubt klumpatsch"), der Satz "und die ewigkeit ist die witwe des todes" prägt sich ein, dann die "rümpfe", "strümpfe", "stümpfe". Was will hier Sinn machen, was nicht, soll ich syntagmatisch oder paradigmatisch lesen? Den letzten Satz entziffere ich als den eines nuschelnden Lisperers: "ich hab mir den rumpf schier am teppich versengt und da nicht mehr wegzukönnen / ist doch gar nicht so schlimm". Was immer das heissen mag, was immer. Die Verrücktheit hat einen Anflug von Prinzip. Und regt an.
Noch einmal der Genitiv-Metaphern-Streit: Zwei Argumente sprechen gegen die Verwendung der Genitiv-Metapher. Erstens, dass es sich handwerklich wohl um die einfachste Form der Metaphernbildung handelt - quasi der Türöffner massenhafter Bildproduktion (Entschuldigung). Zweitens, dass ihre Verwendung einer bestimmten Zeit und damit Kultur zuzuordnen ist. Der deutschsprachigen Lyrik des 17. und 18. Jahrhunderts. Wer die Genitiv-Metapher heute benutzt, bedient sich am Fundus dieser Zeit und sollte das bedenken.
Genau das aber ist der Fall bei der "Witwe des Todes". Diese Metapher bedient sich am Fundus von familiären Denkmustern wie der "Großmutter des Teufels" - so ein Märchen, aufgelesen von den Brüdern Grimm. Die "Witwe des Todes" ist also ein formales Zitat eines Topos, keine Parodie, ein Pastiche - ein Zitieren, ohne zu Verlachen. Wer sich an Märchen oder gleich darauf am Mythos bedient greift auf diese Tradition der Oralität, der erzählten Geschichte zurück. Und dazu passt eben auch die handwerkliche Einfachheit, die hier in die Poetik der minimalen Veränderung eingebettet wird. Beide Argumente wider die Genitiv-Metapher laufen in diesem besonderen Fall ins Leere - und dann kommt noch Robert Striplings sehr einleuchtende Lektüre-Phantasie hinzu. Insgesamt also: ein schönes, schrulliges Gedicht mit einer herausleuchtenden und wohlbedachten Genitiv-Metapher in der dritten Zeile.
„Die Verrücktheit hat einen Anflug von Prinzip“ ist gut gesagt. Im Kinderlied „Auf der Mauer auf der Lauer…“ z.B. kommt im Grunde ein ähnliches Prinzip zur Anwendung, aber dem Prinzip fehlt dort der Anflug von Verrücktheit: Durch sukzessives Weglassen von Buchstaben entsteht zunächst Unsinn, dann eine Lücke. Danach ist alles wieder beim Alten. Aber erstaunlicherweise wird einem erst dann richtig bewusst, dass der Text eigentlich von Anfang an unsinnig war. Hier ist das Eichhörnchen die Wanze, aber auch die Witwe könnte eine Wanze sein. An der Genitivmetapher stoße ich mich daher nicht. Eher daran, dass die Minimalpaare, Verschleifungen und Löschungen sich wie ein Film über die übrigen Eigenschaften des Gedichts legen, vor allem die semantischen. Anders gesagt: Wenn sie nicht in das Sprachspiel gekleidet sind, stehen manche Wendungen seltsam entblößt da. Außerdem ist für mich nicht ganz ersichtlich, warum die Verballhornung nur ganz bestimmte Fügungen trifft und andere, gerade die pathetischen, unberührt lässt. Diese Einwände trüben aber nur bedingt das Vergnügen.
nun ja, ich schrieb ja: schwierig mit der genetivmetapher. ich brauchte also eine rechtfertigung. die liefert nun christian metz, indem er das bild nicht von seiner inhärenten (nicht-)logik her liest und die bilder/begriffe nicht als ausdruck eines gedankens/gedankenspiels liest, sondern als spielerisches zitat. kann man sicherlich machen und sollte man vielleicht, weil es produktiver ist. ist aber nur aufgrund der wörter witwe und tod sicherlich nicht zwingend. außerdem bleibt die konstruktion an dieser stelle problematisch, sofern man dem gedicht hier irgendwas entreißen will außer zitatspiel. trotzdem eine schöne und vermutlich passender lesart.
wie die "minimalpaare" sich über die "semantik" legen, verstehe ich nicht ganz, was ist genau gemeint?
die diskussion allein spricht wiederum für das gedicht, scheint mir.
lesen im Zimmer des Linguisten, als der Linguist aufblickt und sagt, Ist Eppich nicht eine Pflanze?, und vor das Regal tritt, um Zander herauszuziehen, das Handwörterbuch der Pflanzennamen, und tatsächlich hat er recht: Eppich = apium = Sellerie, apium inundatum: Flutender Sellerie, und wir lachen beide auf, echt glücklich –









 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /