
Kommentare
Heu ist auch so ein Wort:
Heu, /Heu in den Kinderscheuern, / wo zu verbrennen / oder sich für immer zu verlieren / gleich leicht ist. / Gebündeltes Heu, / Heu auf den Feldern, / Heu als die bei der tödlichen Vielfalt / der Möglichkeiten gerade so / zueinander gegebenen Buchstaben, / diese Richtung, / aber keine andere. / Heu, das im Wind fliegt / auf den dürren Stoppeln bleibt, / für immer von den anderen getrennt, / das den Schnee erwartet, / der ihm den Himmel nehmen wird, / sein unbewegtes, mattes Ebenbild. / Die Gewißheit, daß es keinen Trost gibt, / aber den Jubel, / Heu, Schnee und Ende.
Ilse Aichinger
-zeichnung ist eine Reflexion (will mit dem Titel gleich so sein), vom Wort ausgehend, methodisch eher technisch (wobei mir diese Technik bekannt vorkommt), sich selbst nicht ganz hinüberführend ins Gedicht, denke ich, zum Mitdenken genötigt. Aber: die Reime und Stabreime aber, der über das Denken hinweg schäumende Wortfluss! Der Klang wie Pulverschnee - das irrational leicht-leicht-leichte LAUTgedicht ist absolut gelungen. Es nimmt sich und mich mit, schwebt wie Flocken. Drin störend mal ein "welk" - das farblich aus dem Schnee rausgeht um der Alliteration willen - oder dieses satztechnisch notwendige Partizip, kurz bevor aber - aber - der Schluss mir das Denken abnimmt vor der Stelle der Stille. Schön.
Ein Gedicht, das so leicht daherkommt, dass es kaum zu fassen ist, dennoch blickt man nicht durch. Wahrscheinlich, weil es auch ein Nebel ist. Ein phänomenologisches Gedicht, das fortschreitet am Faden der Erhellung und Verdunkelung einzelner Worte, zurück oder nicht für voll genommen. Halbe Affirmationen folgen auf negierende Präzisierungen usw. Schnee ist ein Grund? Ist kein Grund. Ist eine Hülle, ist keine Hülle usw. Manchmal stimmt es, manchmal stimmt es nicht. Manchmal stimmt es auch, obwohl es nicht stimmt. Manchmal ist es auch nur Einstimmung oder Abstimmung – Musik.
Das erinnert tatsächlich an Ilse Aichinger (danke für das schöne Zitat!), bei der es auch heißt: „Schnee ist kein Wort“. Bezieht sich das Gedicht etwa darauf? „schnee / ist so ein wort“, heißt es in diesem Gedicht. Wahrscheinlich ist beides richtig, Schnee ist ein Wort und kein Wort, ist Metapher, von „grund“ auf? Und als solche Hülle und Erhellung zugleich? Ist als Bezeichnung zu hinterfragen, von der Zeichnung ausgehend, von der wiederum nicht gesagt werden kann, ob sie vor oder nach der Bezeichnung liegt. Es könnte sich also ein Schnee hinter dem Schneewort verbergen, ihn „offenlegen“, es könnte aber auch umgekehrt sein, nämlich, dass das Schneewort schon der ganze Schnee ist.
So springt es immer hin und her, vom Grund zur Hülle, vom Fell zum Gefühl, vom Tage zur Lage, von der Metapher zur „gefühlten“ Metapher, von der versuchten Fixierung zur Aufhebung, von der Annahme zur Aufgabe. An diesem Punkt bin ich mir aber nicht sicher, ob es wirklich Sinn hat, sämtlichen Bedeutungen und Mehrfachbedeutungen nachzuspüren, zumal die semantischen Schichten nicht gerade dünn aufgetragen sind. Vielmehr eilt ihnen ein schier unüberschaubarer Wust ontologischer und begriffsgeschichtlicher Assoziationen voraus: Grund, Bewegung, Gestalt, Dinge, Worte, sein / könnte sein usw. Wer käme diesen Begriffen bei? Das Gedicht bleibt ja auch ganz auf der Ebene des Bezeichnenden, verschiebt die Lexeme gegeneinander, schüttelt sie nach allen Regeln der Kunst und es kommt doch keine referentielle Rede heraus. Soll auch nicht. Da liegt es wahrscheinlich näher, im abwägenden Hinstellen von Minimalpaaren und wiederholenden Erweitern eine Art impressionistisches Spiel oder einen rondeauartigen Tanz zu sehen, vor allem durch sich selbst gedeckt.
Der Ertrag aber, wenn man denn einen bräuchte, sind diese Bilder und Analogiebildungen, jene zwischen dem weißen Blatt Papier und der nach und nach Zeichen freigebenden Schneeschicht etwa, oder jene zwischen dem Inderlufthängen der Worte und dem Tanzen der Flocken, „scheinbar schwerelos“, von denen keiner sagen kann, ob sie „wirklich“ dem Schnee entsprechen. Und überhaupt: Ist das Bezeichnen, neben einem Feststellen, nicht immer zugleich ein Stillstellen, auf „still“ stellen? (Nur Menschen und Dinge, die einen Namen haben, können auch auf ihre Plätze verwiesen werden.) Gelingt das Bezeichnen gar nur um den Preis des Schweigens? Muss etwas „schmelzen“, um etwas darüber sagen zu können, ist das Sagen ein Nachziehen dessen, was sich abzeichnet? Vielleicht erfolgen manche der Alliterationen auch etwas zu systematisch, „die Stelle der Stille“ etwa ist in Anbetracht des Vorangegangenen eine fast schon pflichtschuldige Pointe.
Aber wie lange, frage ich mich, werden wir an den Wörtern überhaupt noch Entdeckungen dieser Art machen können? Es gibt eine Folgerichtigkeit des Sprachspiels, die es mitunter auch entkräftet und eine Textfläche erzeugt, die ein wenig an eine Übersetzung erinnert, bei der auch die Varianten stehengeblieben sind. Ich möchte eigentlich nichts Pejoratives in diese Beobachtung legen, nur etwas fragendes, denn nichts an diesen Versen ist prätentiös. Sie erinnern eben, ganz dem Aviso des Titels gemäß, an eine flüchtig hingeworfene, ausschnitthafte „zeichnung“, notwendig schwarz-weiß, wolkig, flockig, wie mit dem Zerstäuber aufgetragen, bald gespenstisch umrißlos, bald mit Schattierungen versehen.
Was aber ist nun, im Gedicht, mit „-zeichnung“ sonst noch gemeint? Die Gegenstände, die zur Schneeschmelze sichtbar werden? Das Darunter-Liegende generell? Oder ist der fehlende erste Teil des Titelwortes nichts weiter als die Vorsilbe „Be“ und die „Auflösung“ in der Bezeichnung zu suchen? Aber was ist hier Zeichnung, was Bezeichnung? Was liegt worunter und was hängt woran? Die Worte also, sind sie der Schnee oder das Zugedeckte? Meint die Zeichnung das (Sinn)bild einer Schrift, die poetische Rede, die zwischen Zeigen und Verbergen schwebt oder schwankt, eine Welt also, in der die Worte neu und anders ins Gewicht fallen, unter dem Zutun von etwas Drittem, das weder Ding noch Bezeichnung ist? Aber hier wiederhole ich mich nur noch. Ich blicke nicht durch.
Schnee ist das, was ich nicht anhalten kann, schreibt Ajgi. Immer verwundert, nicht nur im Winter, bin ich, sobald mir wieder einfällt, wie lautlich verschieden und doch so verwandt das deutsche Schnee und das französische neige sind. Leises Rieseln in dem Gedicht, aus dem Gedicht her zu mir, und das, bei Schneetreiben, heute in Duisburg ...
Sechzehn Zeilen von einer schwerelosen Anmut. Woran es liegt? An der Klangmelodik dieser "wendig lebendigen" Verse, die so leichtfüssig assonieren und alliterieren, Reime bilden und tanzen, dass Stelle und Stille fast in eins fallen. Von Schnee ist die Rede, vom Wort und der Sache, von Zeichen, Linien und einem Blatt. Vergleiche huschen herbei - Schnee wie Hülle wie Fell wie Gefühl -, etwas liegt, deckt zu oder erhellt und enthüllt. Stehen und Einstehen haben hier nichts zu sagen (zu suchen). Im Weiß zeigt sich das Unbedingte - für den, der zu lesen versteht.








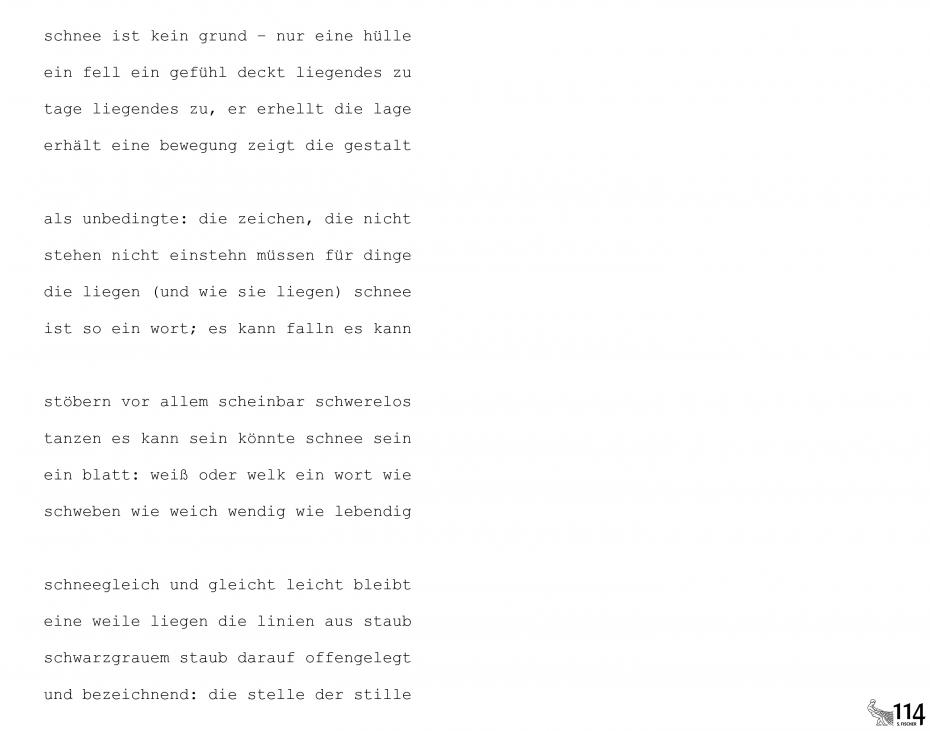
 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /