Kritik des Rausches...Als man begann, dem Bewusstsein ein Heim im menschlichen Intellekt zu errichten, einen leeren Raum mit Spiegeln ausgelegt, da brauchte man etwas, vor dem es sich mehr fürchten konnte als vor der Kälte reflektierender Wände. Darum entwarf man das Chaos und alle Verlorenen, die die Spiegel zerbrachen, irrten seitdem draußen umher, Wahnsinnige auf der Suche nach sich selbst. So begann sich das Bewusstsein bald an die neue Umgebung zu gewöhnen, erklärte die Spiegel zu Fenstern und baute sich aus dem, was es dadurch erblickte seine Welt. Mit der Zeit wurde es so geschickt im Verrücken der Spiegel, dass jeder Blick, den es nach außen richtete, tausendfach zurückgeworfen doch stets etwas Neues zeigte, und so vergaß es die Spiegel und alles was sich dahinter auftat und war ganz zufrieden mit sich... Der Beginn des RauschesNach Kant beginnt die Ich-Flucht in der Philosophie. Das Auflösen des Subjekts, die konsequente Dekonstruktion der Substanzen und schließlich deren Überführung zum Diskurs. Schlegel fordert „den Gang und die Gesetze der vernünftig denkenden Vernunft aufzuheben, und uns wieder in die schöne Verwirrung der Fantasie, in das ursprüngliche Chaos der menschlichen Natur zu versetzen“. Die Romantik übernahm diesen Anspruch und riss die Grundfesten ein, auf denen Kant gerade noch sein Denken errichtet hatte. Die Leerstelle akzeptierenAlle Disziplinen, die eine Definition des Rausches versuchen wollen, müssen sich dem Dualismus zwischen dem Bewusstsein und dem Unbewussten stellen. Tun sie dies nicht, misslingt der Lösungsversuch zu einer Transformation des Problems. Der Rausch wird dann bereits ideologisiert gedacht und aus der jeweiligen Perspektive weiter ideologisiert – es findet keine Annäherung an einen Zustand des Unbewusstseins mehr statt, sondern ein Schärfen der Gegensätzlichkeit. Copyright © Hannes Opel – May 15, 2008 |
|
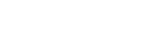
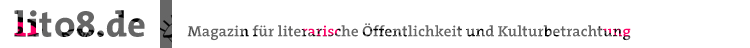




![Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft [Copyright (c) Reclam Verlag]](opel-kritik-des-rausches-kant.jpg)

![Friedrich Schlegel: „Athenäums“-Fragmente [Copyright (c) Reclam Verlag]](opel-kritik-des-rausches-schlegel.jpg)