Ludvík Kundera und Franz Fühmann (Hrsg.): Die Glasträne
DER LESER AM FLUSS
Über den Gedichten von Georg Trakl
In ewger Bläue der Azur.
Der Wind in meinem Buche blättert.
Die Augen ruhten lang schon. Nur
ein buntes Käferchen durchklettert,
lebendiges Initial,
der Strophen weißgefaßten Rahmen,
verzückt wie ich – und deinen Namen
vergaßen wir fast dieses Mal,
Dichter, der Strophen du gelesen,
die heute – längst vergessen – ruhn,
dein Sommer war durchklirrt gewesen
von Waffenlärm, wie meiner nun
doch strömt der Fluß, wie anderwärts
und hell im Schilf spielt Sonnenflimmern
und läßt im gleichen Glanze schimmern
den Stahl der Sichel wie des Schwerts.
Wie weit ists bis zu meinem Tod?
Hör, wie der Fluß mein Wort wegleitet,
mit meinem Spiegelbild entgleitet
und wie das Licht aufflammend loht,
fast sprengend die granitnen Höhen
der Landschaft rings, die hartgebrannt
wie die Gebirge um mein Land,
da ewig sie im Feuer stehen.
Und von des Sonnentores Loh’n
führn Felder niederwärts wie Treppen,
darüber sich die Dürren schleppen
und Hunger auszusähen drohn.
Der Schnitter schwenkt den blanken Stahl,
und ein Befehl ist die Gebärde:
Halt wie die Toten fest die Erde,
und fester noch – für dieses Mal! –,
im Schatten dann der Lindenkrone
wischt er den Schweiß, der strömend rinnt:
So gut behelmt hat ihn die Sonne,
bevor er seinen Weg beginnt.
Vielleicht ist schon sein Tag bemessen,
das Ende naht auf schnellen Schuhn.
Dein Sommer ist durchklirrt gewesen
mit Waffenlärm wie meiner nun,
doch strömt der Fluß wie anderwärts,
und hell im Schilf spielt Sonnenflimmern
und läßt im gleichen Glanze schimmern
den Stahl der Sichel wie des Schwerts.
František Hrubín
Vielseitigkeit und Vielsaitigkeit
Während des ersten Weltkrieges veröffentlichte der tschechische Dichter und Wissenschaftler Otokar Fischer seine Übersetzungen deutscher Gedichte unter dem Titel Aus Goethes Vermächtnis, denen er die folgenden Worte zum Geleit gab:
Ich stelle meine persönliche Auswahl deutscher Dichtung absichtlich unzeitgemäß unter den Schutz Goethes, der vor hundert Jahren selbst im Angesicht des Krieges nicht aufhörte, an die menschliche Stimme des Herzens zu glauben.
Etwa zur gleichen Zeit gab Franz Pfemfert in Berlin seine Anthologie Die jüngste tschechische Lyrik heraus, in der Absicht, „verbindend zu wirken in einem Augenblick, wo Sprechen und Schreiben fast immer nur geschieht, um zu trennen – es ist das Ziel dieser Veröffentlichung, die ich als einen politischen, völkerverbindenden Akt gewertet wissen möchte“.
Während des zweiten Weltkrieges, in dem für alle Tschechen besonders tragischen Jahr 1942, dem Jahr von Lidice, dem Jahr der Massenhinrichtungen, übersetzte der kranke tschechische Dichter Josef Hora Verse von Goethe, Lenau, Schiller und Chamisso – nur für sich, ohne die Absicht einer Veröffentlichung. Genau besehen, war das kein bloßer Akt des Trotzes, sondern es geschah, um unter der Schreckensherrschaft des Faschismus auf die humanistischen Quellen deutscher Literatur hinzuweisen, es war „eine geistig-moralische Tat und eine kulturpolitische Manifestation“. Etwa zur gleichen Zeit beschäftigte sich Bertolt Brecht im amerikanischen Exil intensiv mit Hašeks Švejk, dem tschechischsten und internationalsten Buch der tschechischen Literatur, er konzipierte sein Stück Schweyk im zweiten Weltkrieg und schrieb am 27. Mai 1943 in sein Tagebuch:
Seine Weisheit ist umwerfend. Seine Unzerstörbarkeit macht ihn zum unerschöpflichen Objekt des Mißbrauchs und zugleich zum Nährboden der Befreiung.
Zweimal zwei Beispiele aus schweren Zeiten – sie können vielleicht als besonders aufschlußreiches Zeugnis für die Wechselbeziehungen zweier Literaturen gelten, für die Wege und das Wesen dieser Beziehungen. Mit der Anthologie tschechischer Dichtung des 20. Jahrhunderts, dem bisher umfangreichsten Versuch dieser Art, soll das beglichen werden, was innerhalb dieser Beziehungen schon seit langem und mit Recht als drückende Schuld angesehen wird. Denn sicherlich genügt es nicht, nur theoretisch zu wissen, daß vor allem die Poesie für die Literatur und das nationale Leben der Tschechoslowakei richtungweisend ist, daß sie in diesem Jahrhundert mit Europa und der Welt Schritt hielt und daß sie in weit höherem Maß als die Prosa oder das Drama die inneren qualitativen Voraussetzungen dafür besitzt, der Welt etwas Neues zu sagen.
Über die Frage, wer die Begründer der tschechischen Poesie des 20. Jahrhunderts sind, könnte man streiten. Ist es der Träumer, aber auch Pamphletist Antonín Sova, der Seher, aber auch Gestalter intimer Dramen? Ist es der „erratische Block“ Petr Bezruč, der leidenschaftliche und eigenwillige Kämpfer gegen nationale und soziale Ungerechtigkeit? Ist es der philosophische und ekstatische Otokar Březina, der der Poesie buchstäblich das ganze Weltall erschließt? Ist es der ironische J.S. Machar, der den Gestank des Großstadttrottoirs in die allzu erhabene Welt der sogenannten hohen Poesie aufsteigen läßt? (Seine wertvollsten Gedichte freilich gehören noch ins neunzehnte Jahrhundert.) Oder sind die Begründer Toman, Šrámek, Neumann, Gellner, diese Anarchistenplejade von unterschiedlichem Temperament und vielseitiger Begabung, die sich wohl mit der destruktiven Losung „Nach uns die Sintflut“ dekorierte, aber zugleich einen gesunden Antimilitarismus vertrat und durch deren Verdienst die anarchistische Bewegung im tschechischen Bewußtsein zu einer positiven Tendenz wurde?
Diese Streitfragen sind rein akademischer Natur. Alle jene, die aus dem Boden der neunziger Jahre mit ihrem bitteren Aufruhr und ihren „zerbrochenen Seelen“ hervorgewachsen waren, haben die Grundsteine für den Bau zusammengetragen, an dessen Vollendung noch heute gearbeitet wird. Allerdings wurde all diesen individuellen Revolten das Jahr 1905 sozusagen zu einem Markstein, einige Dichter verstummten auf Jahre (Březina für immer), und alle verloren den ursprünglichen Elan, als hätten sie angesichts der scheinbaren Ausweglosigkeit für die Gesellschaft und die Zeit, für die Gesellschaft in der Zeit, „Vernunft angenommen“, wenn nicht gar resigniert. Bis zum Beginn des ersten Weltkriegs ist in der tschechischen Lyrik eine Ebbe zu bemerken… Aber auch nach einer Ebbe bleibt einiges Wertvolle: hier zum Beispiel Neumanns vitalistische Poesie und die Dichtung, die die Wunder der modernen Zivilisation besingt.
Der erste Weltkrieg brachte alles in Bewegung, was bereits schlaff oder verschüttet schien. Bekanntlich nahmen innerhalb der österreich-ungarischen Monarchie die Tschechen eine oppositionelle Haltung ein, und so fand sich unter den tschechischen Dichtern keiner, der den Krieg auch nur vorübergehend verherrlicht hätte. Es fanden sich jedoch Dichter, in deren oft sehr gedämpften „Aufzeichnungen“ mehr Intensität war als in manchem wortreichen Antikriegsgedicht, es fanden sich Dichter, die Glaube und Hoffnung weckten, und Dichter, die die „Sicherheit eines Ortes“ fanden, die Sicherheit der Heimat.
Im Oktober 1918 kam es endlich zu dem lange erwarteten Bankrott, zum Abreißen der jahrhundertealten Bindungen an die Habsburger Monarchie. Der Rausch der nationalen Unabhängigkeit fand in der Poesie keinen besonders starken Ausdruck. Sehr bald formiert sich eine neue Dichtergeneration und es ist bemerkenswert, daß fast alle Lyriker, auch die etwas älteren wie Neumann und Hora, im Zeichen der proletarischen Revolution auf den Plan traten.
Neu, neu, neu ist der Stern des Kommunismus. Die gemeinschaftliche Arbeit bringt einen neuen Stil hervor, und es gibt keine Modernität außer dieser.
Vladislav Vančura ist der Autor dieses Mottos, unter dem die neue Generation ihren Einzug in die Literatur und ins Leben hielt. Die erste Phase dieser Entwicklung, deren Brennpunkt die avantgardistische Künstlervereinigung Devětsil darstellte, war die proletarische Dichtung, der Proletkult. Ihren Idealen verlieh den vollkommensten und zugleich originellsten Ausdruck Jiří Wolker, der nach Bezruč auf lange Zeit meistgelesene tschechische Dichter. Die zweite Phase stand im Zeichen des Poetismus, einer Richtung, die von ihrem Haupttheoretiker Karel Teige folgendermaßen definiert wurde:
Die Kunst des Poetismus ist leger, spielerisch, phantasievoll, mutwillig, unheroisch und der Liebe zugewandt. Ihr fehlt jede Romantik. Sie entstand in einer Atmosphäre heiterer Geselligkeit, in einer Welt, die lacht, wenn auch ihre Augen weinen. Das humorvolle Temperament überwiegt, auf Pessimismus wurde aufrichtig verzichtet.
Der Schutzheilige des Poetismus ist Appollinaire so gut wie Majakowski; und mochte sich diese Strömung noch so traditionsfremd gebärden, sie hing doch eng mit einer heimischen Tradition zusammen: der tschechischen Volksdichtung mit ihrer Spielfreudigkeit, ihrem Witz und ihrem Zauber. Durch die „Schule“ des Poetismus sind die bedeutendsten Dichter der Zeit zwischen den beiden Kriegen gegangen – Seifert, Biebl, Nezval, Halas, Závada, aber auch Hora –, ohne den Poetismus wäre die Poesie der Songs von Voskovec und Werich undenkbar, im Zeichen des Poetismus standen auch die ersten Arbeiten von Dichtern wie Holan und Mikulášek, und zu ihm bekennt sich, beinahe schon programmatisch, die jüngste tschechische und slowakische Poesie der Gegenwart. „Es ist das bleibende Verdienst des Poetismus, daß er der Bildhaftigkeit alle Freiheit gab…“, erklärte F.X. Šalda, die bedeutendste Gestalt der tschechischen Literaturkritik, „die Verse, die unter seinem direkten oder indirekten Einfluß geschrieben wurden, haben zwei scheinbar widersprüchliche Tugenden, ohne die es keinen guten Vers gibt: sie sind sehr leicht, denn sie haben Flügel und fliegen; und dabei haben sie ein beträchtliches spezifisches Gewicht, sie sind also auch dicht. Leicht und dicht zugleich!“
Als die Zeit des reinen Poetismus sind die Jahre 1923–1928 anzusehen; danach beginnt seine jugendliche Unbekümmertheit, seine ausgelassene Fröhlichkeit zu schwinden, Schatten fallen auf die Gedichte, in denen Scheinwerfer, „allen Schönheiten dieser Welt“ zugewandt, bisher in voller Helligkeit erstrahlten. Noch ehe die Massen der Arbeitslosen durch die Straßen zogen, noch ehe die ersten Schüsse auf Demonstranten abgefeuert wurden, erklangen in den Versen der tschechischen Dichter Töne der Trauer, der Wehmut, des Leides und des Todes. Man glaubte damals und später, sich nur unter Vorbehalt dieser eigenartigen und einzigartigen Periode der tschechischen Dichtung nähern zu können. Es fehlte auch nicht an heftigen Gegnern, die sie pauschal verurteilten. Aber heute wissen wir, daß die Gesänge einer scheinbar subjektiven Trauer eigentlich ein sehr objektives Signal waren. František Halas sprach es im Namen aller seiner Gefährten aus:
Der Tod ist kein Programm, nur der Horizont der Frösche ist auf dem Friedhof zu Ende. Die Dichtung über den Tod ist keine Verneinung des Lebens, sondern ein Stachel, der die Liebe zum Leben steigert… Die lebenspendende Angst vor dem Vergehen ist der Kitt des ewigen Rebellentums, das sich niemals mit der Zerstörung allein zufriedengibt.
Der Schlußpunkt hinter dieser Periode ist das Jahr 1933. In unmittelbarer Nachbarschaft der Tschechoslowakei melden Trommeln und Pfeifen und brennende Bücherhaufen akute Gefahr. Konnte bisher noch jemand von einem Idyll sprechen – jetzt war es zerstört. Das bedeutete allerdings nicht, daß die gesamte „nicht engagierte“ Poesie Hals über Kopf antifaschistisch wurde, daß alle Dichter der „Stille und Meditation“ sich sofort in feurige Kämpfer verwandelten. Die Wege der Poesie sind komplizierter. Jeder Dichter ist unaufhörlich mit sich in Streit, verstrickt in den Widerspruch zwischen dem Streben, die Dichtung zum Werkzeug des Kampfes zu machen, und der Verlockung der Einsamkeit, der Kontemplation, der entfesselten Phantasie und anderer sogenannter Abweichungen. Aber gerade dieser Widerstreit, diese Zweipoligkeit ist eine Quelle der Spannung und lntensität ohne die es keine echte Dichtung gibt. Die Tatsache, daß alle Versuche einer Definition der Poesie, ihrer Prinzipien und ihrer Sendung am Ende unvollkommen sind, weil immer noch etwas Undefinierbares bleibt, macht eben das Wesen der Poesie aus, einer Welt, die durch unzählige Fäden mit der äußeren und inneren Wirklichkeit verbunden ist, einer Welt jedoch mit eigener Ordnung.
Ein weiterer Knotenpunkt für die tschechische Poesie ist das Jahr 1936. In dieses Jahr fiel der hundertste Todestag Karel Hynek Máchas, des Dichters, der am Beginn der modernen tschechischen Lyrik steht, der für die tschechische Literatur das bedeutet, was Byron, Shelley, Lermontow, Hölderlin für andere Literaturen bedeuten. Dieses Jubiläum war für die avantgardistische Generation des Devětsil der erste bewußte Weg zu den Quellen, ein Anlaß zum Nachdenken über das Wesen der Poesie, über die Beziehungen zwischen Dichtung und Gesellschaft, über die Stellung des Dichters in der Gesellschaft, und es stellte die ersten Verbindungen zur Tradition der revolutionären Romantik her. Im Jahr 1936 brach jedoch auch der Bürgerkrieg in Spanien aus, jenes große Memento der Zeit vor der Katastrophe. Er war wieder für viele tschechische Dichter ein Anlaß, zu den Quellen zu geben – zu den Quellen der Entwicklung zwischen den beiden Kriegen – und daraus Schlüsse zu ziehen. Diese beiden Impulse, der von Mácha ausgehende und der aus Spanien kommende, verschmolzen und gaben der tschechischen Lyrik dieser Zeit ein Gepräge, das einzigartig in der Geschichte der Literaturen und kaum auf einen anderen Sprachorganismus übertragbar ist.
1938, das Jahr des unrühmlichen Münchener Abkommens, und 1939, das erste Jahr der Okkupation, sind düstere Jahre der tschechischen Geschichte und große Jahre der tschechischen Poesie. Alles Persönliche und Unpersönliche ging damals ins Überpersönliche ein. Die Musen schwiegen nicht zwischen den Waffen, und es entstanden Verse und Gedichtbände, die zutiefst ergreifend und von bleibendem Wert sind, „Gedenkbücher des tschechischen Geistes über den Wendekreis der Geschichte hinweg“, wie Josef Hora sagte, Bücher, in denen der zukünftige Leser „alle übermenschliche Anspannung der Gemüter, alle Schwere der Prüfung, aber auch alle moralische Tapferkeit findet, die wir aufbrachten, um Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung von uns fernzuhalten“. Die alten und immer wieder neu ausgesprochenen Worte von den Dichtern als dem „Gewissen des Volkes“, die Worte von ihrer Verantwortung in Zeiten, wo die Trommeln schlagen, hatten für die tschechischen Lyriker Gültigkeit. Eine kleine Anthologie tschechischer Gedichte allein aus diesen zwei tragischen Jahren würde beweisen, daß die Tschechoslowakei damals nicht nur in einem Schnittpunkt der Geschichte, sondern auch in einem Schnittpunkt der europäischen Dichtung stand.
In den Jahren der Okkupation war die tschechische Poesie vor eine völlig neue Aufgabe gestellt: man mußte so schreiben, daß die Leser verstanden und daß zugleich die Wächter, die Zensoren getäuscht wurden. Es entstand eine „allegorische“, chiffrierte Poesie, die aus den Tiefen der Sprache bislang verborgene Bedeutung hervorholte, eine Poesie, die eine Schwester der schon berühmt gewordenen französischen Résistancedichtung ist. Je mehr die tschechische Sprache von den nazistischen Okkupanten unterdrückt und geschmäht wurde, desto mehr Sorge verwandten die tschechischen Dichter auf die Reinheit ihrer Muttersprache. Und selbst Verse, die scheinbar ganz außerhalb von Zeit und Raum standen, hatten politische Tragweite: durch das melodische, aufwühlende, verfeinerte und kühne Tschechisch, das höchstes Maß an Kultiviertheit erreichte. Die Wirkung solcher Verse war aufrüttelnd: ihre Sprache erinnerte das Volk an die tschechische Vergangenheit und lenkte seine Gedanken auf die Perspektiven einer besseren Zukunft.
Der Mai 1945 riß die Mauern nieder, die in den Jahren zuvor jede freiere Dichtung verhindert hatten. Dithyrambisch und in unvergeßlichen Hymnen wurde die nationale Freiheit begrüßt, aber zugleich wurden die Ablagerungen des Krieges im Bewußtsein der Menschen freigelegt, wurden erschütternde Zeugnisse und „Erbschaften“ ans Licht gebracht, wurden die Worte des Grauens aus der Okkupationszeit wieder laut. Dennoch überwog die Freudigkeit, ein mitreißender Elan, für den es in der tschechischen Geschichte kaum eine Analogie gibt. Anerkannte Dichter und Prosaisten – Nezval, Halas, Olbracht, der slowakische Lyriker Novomeský und andere – widmeten sich begeistert und aufopferungsvoll der Betreuung wichtiger Sektoren der Kultur. Das beinahe überstürzte Tempo dieser Zeit war nicht imstande, die überempfindlichen Seismographen in den Dichtern abzustumpfen, ohne die sie des Namens Dichter unwürdig wären. Es folgte die sozialistische Revolution von 1948. Die durch sie ausgelösten schöpferischen Kräfte wurden jedoch in der Zeit des Personenkults an ihrer vollen Entfaltung gehindert. Die Literatur wurde vorübergehend auf ein Maß von Uniformität reduziert, dem manche bedeutende Dichter das Schweigen vorzogen. Später erstand die tschechische Poesie wieder in ihrer ganzen Vitalität und mit allen ihr zur Verfügung stehenden Registern, mit ihrer Vielseitigkeit und Vielsaitigkeit, mit ihrem Neuerertum, das kein Risiko scheut, mit ihrem faszinierenden Melodienreichtum und ihrer atemberaubenden Imagination, mit ihren vielfältigen Formen des freien Verses, mit ihrem Appell an Intellekt und Emotion. Die humanistischen Werte sind wieder auf den Platz gerückt, der ihnen gebührt. Türen und Fenster sind ihnen weit geöffnet.
Ludvík Kundera, Vorwort
„Unser Herz, das soviel Blut verlor“
– Gedichte aus der Tschechoslowakei, Ungarn und der Sowjetunion. –
Im folgenden werden Ihnen fünf Bücher vorgestellt, denen nicht nur gemeinsam ist, dass es sich um Bände mit Uebertragungen fremdsprachiger Lyrik handelt. Noch in einer – allerdings bezeichnenden – Aeusserlichkeit stimmen diese Bücher überein: nämlich der, dass Sie aller Voraussicht nach keins von ihnen in Ihrer Buchhandlung finden werden, obwohl es sich um Neuerscheinungen deutscher Verlage handelt und obwohl einige dieser Bände in recht hohen Auflagen erschienen sind. Des Rätsels Lösung: alle fünf Titel sind in Verlagen der DDR erschienen. Und wenn Sie sich für das eine oder andere der hier angezeigten Bücher interessieren, dann müssen Sie sich schon die Mühe machen, es eigens zu bestellen und dann ein paar Wochen darauf warten. Jede Buchhandlung wird Ihnen diese Bücher beschaffen, aber kaum eine hat Bücher aus der DDR vorrätig. Auch das gehört zur betrüblichen „Lage im geteilten Deutschland“. Die Anthologie Die Glasträne, die, herausgegeben von Ludvík Kundera und Franz Fühmann, im Verlag Volk und Welt (Berlin) erschienen ist, darf gerade heute besondere Beachtung beanspruchen – sie enthält nämlich tschechische Gedichte des 20. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der sich vor den Augen der Welt ein verheissungsvoller Demokratisierungsprozess in der ČSSR vollzieht, sieht selbst der literarisch Uninteressierte, welche engen Beziehungen zwischen der tschechischen Literatur und der Politik bestehen; es braucht hier also nicht mehr eigens auseinandergesetzt zu werden, welchen entscheidenden Anteil Schriftsteller an der Demokratisierung in Prag hatten und noch haben. Die Lyriksammlung Die Glasträne zeigt nun ganz deutlich, wie stark die tschechischen Lyriker dieses Jahrhunderts schon immer nicht nur die politischen Zustände in ihren Werken gespiegelt, sondern sie mitbestimmt haben. Wie aktuell beispielsweise wirkt heute das beschwörende Gedicht von Stanislav Kostka Neumann (1875 bis 1947), das schon einige Jahrzehnte alt ist (die deutsche Uebertragung stammt von Louis Fürnberg und Franz Fühmann):
Mein Volk, mir gehts ja nur um dich,
uns allen geht es nur um dich!
Verrate nicht, da Dämmerung
unsere Heimat beschlich.
Verrietst du das ewig sich hellende Licht,
verrätst du das Leben, die Kinder und dich!
Verrate nicht!
Dämmerung – ist nur ein Spielchen der Zeit,
sie ist ja nicht für die Ewigkeit!
Verrate nicht!
Luft, Wasser, die Quellen des Lichts werden sein!
Die Saat wird aufgehn! Die Ernte gedeihn!
In Herz-Millionen wird es mai’n!
Verrate nicht!
Die Blumen welken. Der Schimmer verfliegt,
der trügerisch über dem Leben liegt.
Verrate nicht!
Du weisst nicht, mein Volk, du Einjahrsbäumchen: Grün
wird nach jedem Winter die Flur, und erblühn
wirst auch du nach der Nacht. Mein Volk bleibe kühn,
verzag nicht, verrate nicht!
Die Sammlung Die Glasträne ist die bisher umfassendste deutschsprachige Anthologie tschechischer Dichtung des 20. Jahrhunderts, umfangreicher noch als die vor einigen Jahren im Westen (bei Glock und Lutz, Nürnberg) von Josef Mühlberger herausgegebene Anthologie Linde und Mohn. Die deutschen Nachdichtunten in Die Glasträne stammen von einer ganzen Reihe deutscher Lyriker, u.a. von Günther Deicke, Franz Fühmann, Reiner Kunze, Peter Hacks, Paul Wiens und Johannes Bobrowski; zu einem Teil allerdings wurden sie – ein etwas problematisches Verfahren – nach Rohübersetzungen angefertigt, die Karla Bachrachová besorgt hat.
Ludvík Kundera informierte in seinem knappen Vorwort über die Entwicklungstendenzen der tschechischen Poesie im 20. Jahrhundert. Er skizziert den Aufbruch und Aufruhr in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, das Verebben der Bewegung zu Beginn des Ersten Weltkrieges und die Erneuerung nach der Lösung von der Habsburger Monarchie 1918, die in der Lyrik zunächst den Proletkult, dann den Poetismus (mit den „Schutzheiligen“ Appollinaire und Majakowski) begünstigte. Eine weitere Zäsur setzte das Jahr 1936: in dieses Jahr fiel der hundertste Todestag dos Dichters Karel Hynek Máchas, der für die tschechischen Lyriker ein Anlass zur Rückbesinnung auf die Tradition wurde; ausserdem begann 1936 der Spanische Bürgerkrieg, der viele Schriftsteller zum Engagement trieb.
In den Jahren der Okkupation, also seit 1939, konnten die Lyriker nur noch, ähnlich wie die Poeten der französischen Résistancedichtung, chiffriert die Wahrheit sagen. In dieser Zeit war es die Aufgabe der tschechischen Schriftsteller, die von den Okkupanten unterdrückte und geschmähte Muttersprache rein zu bewahren – in dieser Situation hatten sogar die scheinbar unpolitischen Verse eine Funktion:
Ihre Sprache erinnerte das Volk an die tschechische Vergangenheit und lenkte seine Gedanken auf die Perspektiven einer besseren Zukunft.
Nach der Befreiung 1945 wurde die nationale Befreiung hymnisch begrüsst, zugleich wurden die Erlebnisse des Krieges und der Besatzungszeit in erschütternden Zeugnissen an die Oeffentlichkeit gebracht. Nach der Uebernahme der Macht durch die Kommunisten 1948 wurden die schöpferischen Kräfte zunächst an ihrer vollen Entfaltung gehindert, und Ludvík Kundera schreibt:
Die Literatur wurde vorübergehend auf ein Mass von Uniformität reduziert, dem manche bedeutende Dichter das Schweigen vorzogen.
Erst später gewann die tschechische Lyrik ihre ganze Vielfalt zurück, und in diesen Monaten und Wochen zeigt sich deutlich für jedermann, welchen Anteil die so oft als weltfern geschmähten Poeten mit ihren humanistischen Utopien an der Neugestaltung eines Landes haben können.
(…)
Peter W. Gerhard, Die Tat, 24.8.1968
Zum 70. Geburtstag von Franz Fühmann:
Hans Richter: Ein verlorener Sohn Böhmens
Sinn und Form, Heft 4, Juli/August 1992
Zum 95. Geburtstag von Franz Fühmann:
Walter G. Goes: Versuche über Literatur
Ostseezeitung Rügen, 14.1.2017
Fakten und Vermutungen zu Franz Fühmann + Archiv + KLG
Porträtgalerie
Gedenkartikel: Uwe Wittstock, Uwe Kolbe + 2 + 3, Max Walter Schulz,
Christa Wolf + Ulrike Almut Sandig + Dietmar Riemann +
Christian Klötzer + Wieland Förster + Ursula Püschel + Günter Deicke
Interviews: mit LehrerInnen, mit Hans-Georg Soldat
Fakten und Vermutungen zu Ludvík Kundera
Ludvík Kundera – Fragment eines Gesprächs 2007 zur Ausstellung Dada East.


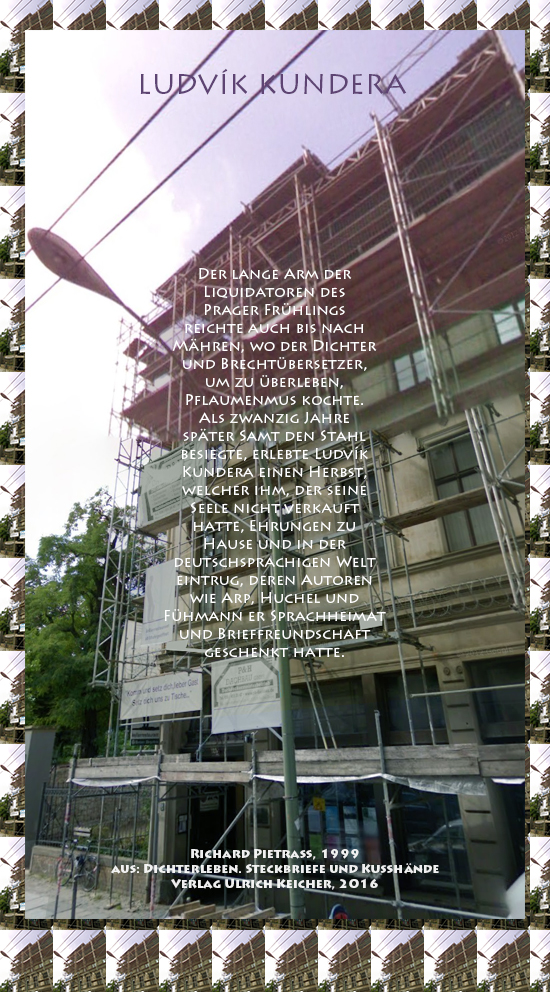








Schreibe einen Kommentar