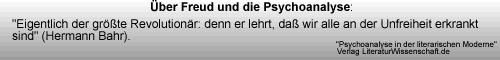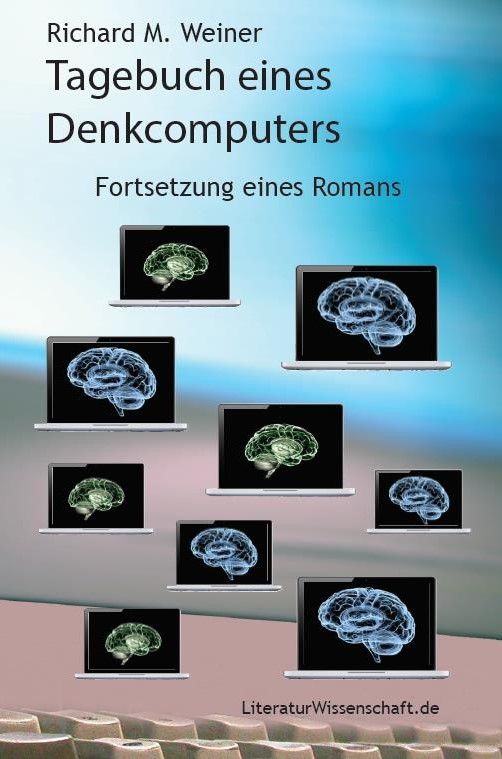Inhaltsverzeichnis der Ausgabe Nr. 3, März 2010
Zu dieser Ausgabe
Ein authentischer Diebstahl
Der Fall Helene Hegemann und die Authentizität
Von Antonius Weixler
Literatur im Geiste des Copy & Paste
Die 17-jährige Helene Hegemann löst mit ihrem neuen Roman „Axolotl Roadkill“ eine intensive Debatte aus. Darin haben sich bisher aber fast nur ältere Kritiker zu Wort gemeldet
Von Philip Krause
Die Roaring Twenties
Airens „Strobo“ schildert Techno, Drogen und Spätpubertät
Von Hans Peter Roentgen
Authentizität ist keine Kategorie
Helene Hegemanns „Axolotl Roadkill“ und die überforderte Literaturkritik
Von Eckart Löhr
Playgiarism
Hegemann, die postmoderne Literaturtheorie und die Rückkehr des Autors in der Literaturwissenschaft
Von Thomas Anz
Der Autor und sein Werk
Hamsun, Céline, Benn und andere Beispiele
Von Eckart Löhr
Heilige Schriften und ihre Verunreinigungen durch Autoren
Gegen die theologischen Reste einer textfixierten Literaturwissenschaft
Von Thomas Anz
Wen kümmert´s, wer spricht?
Die Beurteilung eines Werkes darf nicht von der Biografie des Autors abhängen
Von Eckart Löhr
Preisträger und Nominierte für den Preis der Leipziger Buchmesse 2010
Der Mensch glaubt nicht freiwillig, er glaubt aus Not
Über Martin Walsers Novelle „Mein Jenseits“
Von Norbert Kuge
Opfer und wehrloser Täter zugleich
Martin Suter erzählt in seinem neuen Roman von einem tamilischen Liebes-Koch
Von Georg Patzer
Autsch, denkt die Leserin
Über Anne Webers Roman „Luft und Liebe“
Von Frauke Schlieckau
Ein Blick ins Herz
Maximilian Dorner zeigt dem Leser in „Ich schäme mich. Ein Selbstversuch“ sein Innerstes
Von Martin Spieß
Reisen light
Janet Malcolm ist unterwegs auf Tschechows Spuren
Von Frauke Schlieckau
Anders sein
Über Leif Randts Roman „Leuchtspielhaus“
Von Kathrin Schlimme
Eine kleine Räuberpistole in altertümelndem Stil
Über Andrea Camilleris Caravaggio-Roman „Die Farbe der Sonne“
Von Georg Patzer
Gegen den donnernden Schwachsinn auf allen Kanälen
Gerhard Polts „Kehraus“ ist nun auch als Hörspiel erhältlich
Von André Schwarz
Wie lange geht das noch „gut“?
Schulden erdrosseln unsere Zukunft
Von Dirk Kaesler
Kauziger Komplize
Apologie eines Mitläufers: Martin Gülichs neuer Roman „Septemberleuchten“
Von Oliver Pfohlmann
Ein Blutrausch ist über die Menschen gekommen
In seinem Roman „Hasenjagd im Mühlviertel“ beschreibt Helmut Rizy die Konsequenzen der größten Widerstandsaktion im Konzentrationslager Mauthausen
Von Andreas Tiefenbacher
Die nicht ganz permanente Revolution
Robert Menasse schreibt Essays zum Einmal-Lesen
Von Michael Duszat
Einer von uns
In Bild und Ton: Hans Magnus Enzensberger
Von Daniel Krause
Teekessel, Geld und Poesie
Rainer Maria Rilkes Briefwechsel mit Eva Cassirer – eine Edition mit kulturgeschichtlichem Mehrwert
Von Jörg Schuster
Vom Sprachmüll im Fernsehen und Schlagworten
Max Goldts „Ein Buch namens Zimbo“ mit satirischen Texten
Von Gunter Irmler
Surfkurs in die Wissenschaft
Gerhard Wagner unternimmt mit seinem Roman „Paulette am Strand“ den Versuch eines Genremixes
Von Heike Hauf
„Tausend Freundinnen, aber keine einzige Freundin.“
Jakob Heins autobiografisch geprägte Erinnerungen an eine männliche Jugend in der DDR
Von Winfried Stanzick
Insulare Zeiten
Die lesenswerte Anthologie „war jewesen – West-Berlin 1961-1989“ von D. Holland-Moritz und Gabriela Wachter zeichnet ein abwechslungsreiches Bild einer untergegangenen Stadt
Von Bastian Schlüter
Sätze von sprachlicher Schönheit und Eleganz
Peter Roseis neuer Roman „Das große Töten“ ist dicht und bewegend
Von Winfried Stanzick
Gruppensex im Swingerclub
Thomas Brussig glotzt in „Berliner Orgie“ von außen auf das „älteste Gewerbe der Welt“
Von Philip Krause
Leben als Kunst
In dem Lesebuch „Leben“ von Brigitte Landes werden existenzielle Fragen gestellt
Von Jana Scholz
Das Herz ist ein Berg ist ein See
Cornelia Schmerle erschafft „In Pulsen“ eine sinnliche Sprachwelt
Von Andreas Hutt
Und in der Ferne schimmert der See
Jochen Kelter und Hermann Kinder haben einen Strauß „Bodenseegeschichten“ veröffentlicht
Von Klaus Hübner
Kein Reinfall
Heinrich G. Butz hat ein Buch über den Rheinfall im Spiegel der Jahrhunderte publiziert
Von Klaus Hübner
Bolaños bizarre Welt
„2666“ lautet der kryptische Titel des grandiosen Romans des 2003 verstorbenen chilenischen Autors Roberto Bolaño. Die knapp 1.100 Seiten sind das Vermächtnis eines meisterhaften Erzählers, der es mit den Granden der Weltliteratur hätte aufnehmen können
Von Thomas Hummitzsch
Manische Philologie
Vladimir Nabokovs Puschkin-Edition in deutscher Übersetzung
Von Mark-Georg Dehrmann
Das große Abrichten
Ein Klassiker des Kadettenromans und der ungarischen Literatur wird wiederentdeckt: Géza Ottliks „Die Schule an der Grenze“
Von Oliver Pfohlmann
Auf der Suche nach dem „Haus des Friedens“
Nuruddin Farahs Roman „Netze“ thematisiert die Rückkehr einer Somalierin in ihr von Bürgerkrieg und Zerfall gezeichnetes Heimatland
Von Behrang Samsami
Ein Dorf wie jedes andere?
Amos Oz’ Geschichten beschreiben den Zustand und die Erfahrungen einer existentiellen Einsamkeit
Von Winfried Stanzick
Feder und Hammer
In „Ein verborgenes Leben“ erzählt Sebastian Barry vom harten Los der Frauen im Irland der Bürgerkriegsjahre
Von Monika Stranakova
Terror stört die Bürgerruhe
Das Tagebuch des wohlhabenden Bürgers Célestin Guittard aus dem revolutionären Frankreich
Von Georg Patzer
Ein leicht verständliches Paradigma
Zu Stephen Kings Roman „Die Arena“
Von Thomas Neumann
Spurlos verschwinden
William Boyds verstörender Roman „Einfache Gewitter“
Von Thomas Neumann
Zwischen Realität und Übersinnlichem
Auch Audrey Niffeneggers zweiter Roman spielt mit den Ebenen
Von Winfried Stanzick
Über die Wahrheit der Kunst
Carl-Johan Vallgrens Roman „Kunzelmann und Kunzelmann“
Von Thomas Neumann
Die unendliche Geschichte der richtigen Partnerwahl
Über Virginia Woolfs Roman „Nacht und Tag“
Von Norbert Kuge
Flucht vor der Vergangenheit
Die Liaison, von der William Trevor in seinem neuen Buch „Liebe und Sommer“ erzählt, hat nichts Romantisches
Von Anabell Schuchhardt
Entfaltung für Kunst und Geist
Caius Dobrescu und Gerhard Csejka loten die Form der Ode aus
Von Anke Pfeifer
Was geschehen ist, soll niemals vergessen werden
Margot Kleinbergers Erinnerungen an ihre Deportation nach Theresienstadt: „Transportnummer VIII-1 387 hat überlebt“
Von Ursula Homann
Schillerndes Porträt eines unkonventionellen Frauenlebens
Judith Koelmeijers Biografie „Das Leben der Anna Boom“ schildert die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel eines leidenschaftlichen Frauenlebens
Von Luitgard Koch
Krieg und Frieden
Auch 150 Jahre nach der Geburt des letzten deutschen Kaisers gehen die Meinungen der Biografen über das „persönliches Regiment“ Wilhelm II. weit auseinander
Von Jörg von Bilavsky
Ein viktorianischer Rebell
Über Guido J. Breams Charles Darwin-Biografie
Von Klaus-Jürgen Bremm
Tragödie des Komödianten
Stephen Weissman bringt Chaplin zum Sprechen
Von Daniel Krause
Eine oft peinliche erotische Selbstpreisgabe
Hellmuth Karaseks Buch „Ihr tausendfaches Weh und Ach“ ist im Grunde überflüssig
Von Winfried Stanzick
Abgesang
Das Krimijahrbuch ist schon wieder am Ende
Von Walter Delabar
Absturz gefällig?
Jim Nisbet begleitet den Helden seines Romans bei einem grandiosen Showdown
Von Walter Delabar
Happy End für einen Killer?
Max Allan Collins gönnt seinem Lieblingshelden Quarry einen friedlichen Lebensabend
Von Walter Delabar
Mordmetropole im Ländle
Über Christine Lehmanns Krimi „Mit Teufelsg’walt“
Von Stefan Schweizer
In einem fremden, eigenen Land
Rosa Ribas befragt die Väter nach ihren Sünden
Von Walter Delabar
Rechte Unterwelt
Angelo Petrellas unkonventioneller Krimi über einen neapolitanischen Skin
Von Walter Delabar
Unschuldige Täter
Håkan Nessers grandioses Spiel über das Leben, über späte Sinnstiftung und über Schuld
Von Walter Delabar
Tödliches Mobbing
Über Kathy Reichs neuen Forensik-Thriller „Das Grab ist erst der Anfang“
Von Thomas Neumann
Kontrollierte Echolalie
Über Bücher zum Werk von Wolf Haas, Wilhelm Raabe und Arthur Schopenhauer – und was sie miteinander zu tun haben
Von Axel Dunker
Die fünfte Anthologie zum Raabe-Literaturpreis
Hubert Winkels wirbt für Preis, Preisträgerin und Namensgeber
Von Hans-Joachim Hahn
Das Wissen von der Gewalt
Maximilian Bergengruen und Roland Borgards versammeln Studien zu einem modernen Forschungsgebiet
Von Kai Köhler
Vielfalt der ,Säkularisierung‘
Über zwei Sammelbände zur Geschichte von Ästhetik und Religion
Von Daniel Weidner
Hesse goes USA
Ingo Cornils bündelt in „A Companion to the Works of Hermann Hesse“ Betrachtungen zu Person und Oeuvre des Autors
Von Susan Mahmody
Gedichte zum Klingen gebracht
Annette Lose legt ein Verzeichnis von Hacks-Vertonungen vor
Von Kai Köhler
Kommune I – Philologie (erster Versuch)
Sara Hakemi untersucht die Flugblätter der Kommune I im Kontext der Skandalavantgarden
Von Walter Delabar
Theoretische Grundlagen der Biografie
Ein von Bernhard Fetz herausgegebener Sammelband stellt Diskussionsfelder vor
Von Torsten Mergen
Zwei Kulturen?
Thomas Klinkert und Monika Neuhofer haben den Sammelband „Literatur, Wissenschaft und Wissen seit der Epochenschwelle um 1800“ herausgegeben, der „Theorie – Epistemologie – komparatistische Fallstudien“ bietet
Von Carolina Kapraun
Huldigung an das Althergebrachte
Christian Begemann hat den Sammelband „Realismus: Epoche, Autoren, Werke“ herausgegeben
Von Daniela Richter
Der Rebell, der zum Klassiker wurde
Klaus-Detlef Müllers Brecht-Arbeitsbuch erscheint in einer Neuauflage
Von Ines Schubert
Alter Wein in nicht ganz so neuen Schläuchen
Zu Ulrich Greiners mäßig originellem Lyrikverführer
Von Nils Bernstein
Übersichtliche und fundierte Grundlagen
Wolfgang Steinigs und Hans-Werner Hunekes „Sprachdidaktik Deutsch“
Von Monika Grosche
Im Netzwerk
Anett Lütteken und Barbara Mahlmann-Bauer haben einen Band zu „Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger im Netzwerk der europäischen Aufklärung“ herausgegeben
Von Klaus Hübner
Basistheorien und Praxisfelder – Stefan Neuhaus über die Vermittlung von Literatur
„Drei Seiten für ein Exposè“ – Hans Peter Roentgen gibt in seinem Buch Tipps für Autoren
Ausbruch und Bändigung
Über Horst Bredekamps „Michelangelo. Fünf Essays“
Von Frauke Schlieckau
Lesen lernen
Mortimer J. Adlers und Charles van Dorens Beantwortung der Frage: „Wie man ein Buch liest“
Von Monika Grosche
Der eindimensionale Blick auf die Welt
Über John Grays Buch „Von Menschen und anderen Tieren“
Von Eckart Löhr
Die Meisterwerke des Louvre
Henry Loyrette unternimmt einen virtuellen Spaziergang durch das meistbesuchte Museum der Welt
Von Frauke Schlieckau
It’s all music
Alex Ross’ „The Rest is Noise“ – Musik im 20. Jahrhundert
Von Thomas Neumann
Woodstock revisited
Drei Bücher zum 40. Jubiläum des Woodstock Festivals
Von Thomas Neumann
Herrlicher Krieg – Hansgeorg Schmidt-Bergmanns Band zum Futurismus in einer Neuauflage
Von „Get Back“ zu „Let it be“ – Friedhelm Rathjens Buch über den Anfang vom Ende der Beatles
Stimmen zum Glück
Der Züricher Philosoph Michael Hampe inszeniert eine polyphone Philosophie des „vollkommenen Lebens“
Von Oliver Pfohlmann
Heideggers Denken der Sprache
In seiner Habilitationsschrift „Die Offenheit des Sinns“ versucht Michael Steinmann, Heideggers Sprachphilosophie zugänglich zu machen
Von Stefan Degenkolbe
Zurück zur „Mutter aller Dinge“!
Hans-Joachim Friedrich führt uns mit „Der Ungrund der Freiheit im Denken von Böhme, Schelling und Heidegger“ in tiefste Tiefen
Von Franz Siepe
Das Heiligtum menschlicher Persönlichkeit
Nach über einem halben Jahrhundert werden die wichtigsten Texte eines der bedeutendsten Vertreter der russischen Religionsphilosophie, Simon L. Frank, in einer Werkausgabe ediert
Von Volker Strebel
Ein Halbgott der Sozialwissenschaften
Das neue Handbuch zur Soziologie Pierre Bourdieus lädt zum kritischen Gebrauch ein
Von Heribert Tommek
Wozu man fähig ist
Richard J. Evans beendet mit dem Band „Krieg“ seine eindrucksvolle Trilogie über „Das Dritte Reich“
Von H.-Georg Lützenkirchen
Flucht und Verfolgung
Insa Meinen schildert die Shoah in Belgien
Von Alexandra Pontzen
Konsequent umgesetzt
Felix Römers Studie „Der Kommissarbefehl“ belegt, dass deutsche Soldaten im Zweiten Weltkrieg zeitweise keine Gefangenen machten
Von Klaus-Jürgen Bremm
„Wer war Hans Globke wirklich?“
Jurist des „Dritten Reiches“ und Staatssekretär Adenauers
Von Kurt Schilde
Priester der Vernichtung
Über Christian Hartmanns Biografie von Hitlers Generalstabschef Franz Halder
Von Klaus-Jürgen Bremm
Keine Geschichte großer Helden
Sven Reichardt und Malte Zierenberg erzählen in „Damals nach dem Krieg“ die Geschichte Deutschlands von 1945 bis 1949
Von Ulrike Ehret
Protoformen des modernen Kriegs
Alexander Seyfarth hat mit seiner Studie „Die Heimatfront 1870/71. Wirtschaft und Gesellschaft im deutsch-französischen Krieg“ eine Pionierarbeit zur Erforschung der Einigungskriege vorgelegt
Von Klaus-Jürgen Bremm
Warum suchten westdeutsche Bundesbürger Zuflucht in der DDR?
Bernd Stöver gibt darüber Auskunft
Von Ursula Homann
Wollstonecrafts unerledigtes Dilemma
Ute Gerhards kurze Geschichte des Feminismus
Von Rolf Löchel
Südseeträume der anderen Art
Lukas Hartmann begibt sich mit dem Maler John Webber und Captain Cook auf eine Reise „bis ans Ende der Meere“
Von Norbert Kuge
Religiosität von unten? Lucian Hölschers Begriffsgeschichte der protestantischen Frömmigkeit
Benutzerfreundliches Standardwerk
Bernhard Bischoffs „Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters“ ist in vierter Auflage erschienen
Von Susanne Krepold
|