
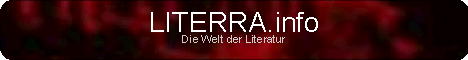
|
|
Startseite > Bücher > Biografie > Rütten & Loening > Elli H. Radinger > WOLFSKÜSSE - MEIN LEBEN UNTER WÖLFEN > Leseproben > Persönliche Empathie |
Persönliche Empathie
| WOLFSKÜSSE - MEIN LEBEN UNTER WÖLFEN
Elli H. Radinger Fester Einband, 224 Seiten Sep. 2011, 19.99 EUR |
Bisons gehören neben den Wölfen und Kojoten zu meinen Lieblingstieren in Yellowstone. Ihnen zuzuschauen, wie sie grasend über die Prärie ziehen, ihre Jungen gegen Wölfe verteidigen, und nach einer Flussdurchquerung übermütig Pirouetten drehen, bringt sofort Frieden und Stille in mein Herz und ein Lächeln auf die Lippen. Umso schwerer fällt es mir, sie leiden zu sehen. Dies ist eine der schwersten Lebenslektionen, die ich in der Wildnis lernen musste: Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind und der Natur ihren Lauf zu lassen. Sehr oft wurde ich vor diese Herausforderung gestellt. Und je schwerer es für mich war, um so mehr habe ich daraus gelernt.
Ich entdeckte den Wolf, als ich in das weite Tal des Hayden Valley fuhr. Er lag neben einem toten Hirschkalb und rührte sich nicht. Merkwürdig. Wenn er das Kalb gerissen hatte, müsste er jetzt eigentlich daran fressen. Aber er lag nur da, mit der Schnauze im Gras und offenen Augen. Ich war erleichtert. Er war also nicht tot. Vielleicht ruhte er sich nur aus. Dann stand er mühsam auf. Es war ein Jungwolf, höchstens ein Jahr alt. Als er versuchte, ein paar Schritte zu laufen, sah ich, dass ein Bein in unnatürlichem Winkel abstand und blutete. Es war gebrochen. Mein Herz rutschte in die Magengrube. Der Wolf humpelte ein paar Schritte, trat aber nicht auf das Bein. Alle paar Meter blieb er stehen und leckte sich die Wunde. Der Schwanz, der tief unter den Bauch gezogen war, zeigte deutlich, dass er Schmerzen hatte.
Mein erster Gedanke war, den Erste-Hilfe-Kasten zu holen und das Bein zu schienen. Ich hätte ein paar nette Worte auf den Gips geschrieben: »Gute Besserung, Wolf.« Der Kleine hätte sich erholt und würde in ein paar Wochen wieder munter herumtollen.
Wie ein Hund schüttelte ich mich, um die Tagträume loszuwerden. Die Realität war ungleich brutaler. Mit sehr, sehr viel Glück würde der Bruch heilen. Wölfe haben schon erstaunliche Verletzungen überlebt. Fakt ist aber auch, dass ein Jungwolf mit einem gebrochenen Bein nicht mit seiner Familie jagen kann. Er ist hilflos. Ich sah weit und breit keine anderen Wölfe, was mich wunderte. Vielleicht hatte er sich schon von seiner Familie abgesetzt und war allein unterwegs? Oder die anderen waren weitergezogen und hatten ihn zurückgelassen, was aber sehr ungewöhnlich wäre. Normalerweise kümmern sich Wolfsfamilien sehr fürsorglich um verletzte Mitglieder.
Ein Auto mit New Yorker Kennzeichen hielt neben mir an. Der Fahrer, ein Mann mittleren Alters, ließ das Fenster herunter. Die übliche Frage:
»Was gibt’s zu sehen?«
Ich zeigte auf den Wolf.
»Ist er verletzt?« Seine dunkelhaarige gepflegte Frau stieß die Autotür auf und stieg aus.
»Sieht so aus.«
»Ogottogott, der Aaaarme. Da muss man doch was MACHEN! Arbeiten Sie hier?«, fragte sie mit weit aufgerissenen Augen.
»Ich helfe im Wolfsprojekt aus.«
»Ja, dann rufen Sie doch jemand. Da muss sich doch jemand drum kümmern«, fiel jetzt ihr Mann ein, offensichtlich ganz der Manager, der es gewohnt war, dass sich »jemand kümmert«.
Die beiden sprachen mir aus der Seele. Aber ich musste sie enttäuschen.
»Es wird niemand kommen. Und selbst wenn jemand vom Park Service käme, greifen die nicht ein.«
Empörte Gesichter.
»In den Nationalparks werden die Natur und die Tiere sich selbst überlassen. Menschen greifen nicht regulierend ein. Dazu gehört auch, verletzte Tiere nicht zu versorgen«, versuchte ich zu erklären.
»Das ist doch allerhand. Das arme Tier so leiden zu lassen«, schnaufte der Mann, während die blauen Augen seiner Frau verdächtig zu glitzern begannen. Sie stiegen in ihr Auto und brausten davon.
Zuzuschauen, wie ein Lebewesen leidet, und nichts dagegen unternehmen zu können, ist vermutlich eines der schwersten Dinge für die meisten Menschen. Die Praxis des Nicht-Eingreifens erscheint auf den ersten Blick brutal. Aber sie ist, so schlimm es klingt, die einzig richtige. Zumindest meistens.
Ich hatte einmal ein Erlebnis, das mich tatsächlich an den Rand der Verzweiflung gebracht hat.
Es war im April 2005. Über Funk hatte ich gehört, dass ein Bison in das Eis des Phantom Lake eingebrochen sei. Das geschieht unzählige Mal in jedem Winter und Frühjahr. Einige Tiere können sich retten. Viele ertrinken. Obwohl es schon dunkel wurde, fuhr ich zu der Stelle und sah, dass sich das Tier zwar noch bewegte, aber schon fast bis zum Hals im Wasser steckte.
Am nächsten Morgen wollte ich wieder nach dem Bison schauen. Nach einer kalten Nacht bei minus zwanzig Grad ging ich davon aus, dass er nicht mehr lebte. Umso erschütterter war ich von dem, was ich vorfand. Anhand der Spuren konnte ich mir zusammenreimen, was geschehen war. Offensichtlich hatte das Bisonweibchen ihr einjähriges Kälbchen bei sich, als sie in das dünne Eis des Sees eingebrochen war. Bisons sind eigentlich gute Schwimmer. Aber der See war nicht tief genug. Die Tiere steckten im zähen Schlamm fest. Als ich an diesem Morgen in die kleine Parkbucht direkt oberhalb der Stelle fuhr, sah ich, dass die Bisonmutter schon ertrunken war. Aber das Kälbchen lebte noch. Es stand auf seiner toten Mutter und hielt den Kopf über Wasser. Die Luft, die es verzweifelt aus der Nase stieß, verwandelte den Atem in kleine Eiskristalle. Bei dem Versuch, im eisigen Schlammloch Halt zu finden, vergrößerte sich dieses immer mehr. Über zwanzig Stunden lang hatte das Kleine schon ausgehalten. Ich war verzweifelt, und ich war allein. Nicht bewegen, befahl ich mir selbst. Denn wann immer ich mich in meiner Parkbucht rührte, geriet das Kälbchen weiter unten in Panik, strampelte und verbrauchte so noch mehr kostbare Energie. Mir blieb nur, stillzustehen und ihm beim Sterben zuzusehen. Ab und zu sank sein Kopf ins Wasser, und ich hoffte, dass es endlich vorbei wäre. Aber dann schreckte wieder irgendetwas den kleinen Bison hoch.
Als sich ein Auto des Parkservice näherte, sprang ich auf die Straße und hielt es an. Ich zeigte dem Ranger die Situation.
»Können Sie nichts machen?«, fragte ich.
Der Ranger schaute mich mit einer Mischung aus Mitleid und Besorgnis an.
»Wir greifen nicht ein. Das hier passiert tausendfach im Hinterland von Yellowstone. Dann ist auch niemand da, der hilft. Das ist halt die Natur.«
Natürlich. Er hatte vollkommen recht. Ich verstand es ja. Aber Verstehen und Akzeptieren sind zweierlei. Ich erwartete ja nicht, dass jemand eine Winde holte und das Tier herauszog.
»Können Sie den Bison nicht erschießen? Seinen Todeskampf beenden?«, schluchzte ich.
»Nein! Wenn das im Hinterland passiert, kann ich das auch nicht.«
Aber das hier war kein Hinterland. Das Tier hatte einen langen, qualvollen Todeskampf. Eine Kugel hätte ihn beenden können. Ich war ebenso empört wie die Touristen, die mich zuvor im Hayden Valley angesprochen hatten. Langsam wurde ich hysterisch. Kurz überlegte ich tatsächlich, ob ich dem Ranger die Waffe entreißen und das Tier selbst töten sollte. Offensichtlich sah er mir an, was ich im Sinn hatte. Er sprach beruhigend auf mich ein. Versuchte, mir noch einmal das »Konzept Natur« zu erklären. Mein Kopf verstand. Aber ich war nicht mehr in der Lage, Kopf und Gefühle zu trennen. Ich sprang in mein Auto und fuhr davon. In einer einsamen Parkbucht heulte ich mir die Seele aus dem Leib.
Meine extreme emotionale Reaktion erschütterte mich. Wie konnte mich dieser Vorfall so aus der Bahn werfen?
Ich habe in Yellowstone immer wieder die Erfahrung gemacht, wie sehr es einen Menschen verändert, wenn er sich längere Zeit in der Natur aufhält. Man scheint »aufzubrechen«, empfindsamer zu werden. Ich war definitiv an diesem Punkt angelangt. Nur langsam beruhigte ich mich wieder. Die aufgestauten Emotionen machten der Traurigkeit Platz. Aber auch der Gewissheit, dass alles okay war, so wie es ist. Ich nahm mir ein Beispiel an den Tieren. Sie akzeptierten, was geschah. Sie kämpften bis zum letzten Moment. Dann aber fügten sie sich in ihr Schicksal. Das hatte ich schon oft beobachtet. Kein Schreien und Klagen, wie schrecklich und ungerecht diese Welt ist. Sie verstehen. Sie wissen um den Kreislauf des Lebens. Warum wehren wir Menschen uns so verzweifelt dagegen?
Ich fuhr zurück zu dem sterbenden Bisonkälbchen. Wieder war ich allein. Ich setzte mich auf einen Stein und blieb bei ihm, bis es dunkel wurde. Still betete ich für das Tier und wünschte ihm eine gute Reise in die ewigen Bisonjagdgründe, wo seine Mutter schon wartete.
Dieser Vorfall war eine große Lektion in Demut und Akzeptanz. Was noch lange nicht bedeutete, dass ich nun für alle Zeit von meinem Wunsch, mein Leben möglichst unter Kontrolle zu haben, geheilt war. Ich verzweifle immer noch, wenn ich ein Tier leiden sehe, so wie den Wolf mit dem gebrochenen Bein. Ich möchte immer noch helfen. Aber ich akzeptiere auch, dass ich nicht immer etwas tun kann oder muss und dass ich nicht jeden retten kann. In diesem Moment konnte ich nur hoffen, dass die Familie des verletzten Wolfes zurückkam und sich um ihn kümmerte. Was mir blieb, war, einen Schritt zurückzutreten und der Natur ihren Lauf zu lassen.
Weitere Leseproben
| Beobachtungen |
| Bilanz |
| Die Magie des Augenblicks |
| Führungsqualitäten |
| Neue Wege gehen |
| Rudel-Dynamik |
| Wo sind die Wölfe |
[Zurück zum Buch]
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info




