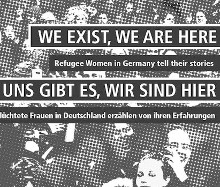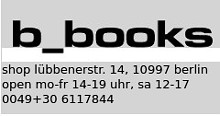Das fragte das McDeutsch-Symposium am vergangenen Freitag. Ich moechte an dieser Stelle auf diese Frage zurueckkommen. Denn selbst wenn sie nicht zentraler Gegenstand der Diskussion gewesen ist, so hat die Veranstaltung dennoch interessante Antworten darauf geliefert. weiterlesen »
- An/Greifbar: Warum BerlinerInnen gegen die digitale Kolonialisierung ihrer St…
- Hacking Women: Ein Blick über den Tellerrand der männlich dominierten Compu…
- Abschaffung der Arbeit? Künstliche Intelligenz, Kapitalismus und Transhumani…
- SILENT WORKS: Berliner Gazette Jahresprojekt zu verborgener Arbeit im KI-getr…
- Gemeinsam machen: Wie die feministischen Prinzipien des Internets entstanden …
- In der Schneekugel: Wie Literatur virtuelle Räume erinnern, erschaffen und n…
- Klimawandel und Selbstkritik: "Wir gedeihen, uneingeladen, wo wir nie wachsen…
- Bild des Monats: Warum wir im Jahr 2020 noch viel mehr Gretas brauchen werden…
- Am Ground Zero des Klimawandels: Green Grabbing, Massenmigration und die Roll…
- Jenseits des Menschengemachten: Indigene Kosmologien als Roadmap für die Kli…
-
Was koennen wir von Afrika und Amerika lernen?
-
Germanisierung der >No-go-area<
Woerter anderer Sprachen in die eigene miteinfliessen zu lassen gilt bekanntlich als sprach- oder gar kulturgewandt. Hier ein
faux-pas
, dort eindeja-vu
und mittendrin nochcanto
undin multa nocte
. Dass es neben den gelungenen Kapriolen, die aus bewusstem Sprachempfinden Eingang in die eigene Rede halten, auch ein Uebermass an zweifelhaften Wendungen gibt, darauf macht ein Projekt der Stiftung Deutsche Sprache aufmerksam: Die >Aktion lebendiges Deutsch< rueckt den Import des Englischen in das Blickfeld und stellt jeden Monat zwei Anglizismen ausunserem
Sprachgebrauch zur Diskussion, die durch deutschsprachige Ausdruecke ersetzt werden sollen. Aus derNo-go-area
wird also dieMeidezone
, aus demBlackout
derAussetzer
. Beispiele wieHingeher
fuerEvent
oder denLaptop
durch den altmodisch anmutendenKlapprechner
zu ersetzen, machen jedoch schnell klar, dass man manche Dinge am besten einfach so belaesst,wie sie sind
. Historisch hat die Idee der Germanisierung von Fremdwoertern eine lange Tradition. Schon im 18. Jahrhundert hat Joachim Heinrich Campe etwa 11.500Eindeutschungen
vorgenommen, von denen beispielsweisefortschrittlich
fuerprogressiv
,altertuemlich
fuerantik
undStelldichein
fuerRendezvous
in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind. Fuer seine Entsprechungen wieZwangsglaeubiger
,Heiltuemelei
undMenschenschlachter
anstelle vonKatholik
,Reliquie
undSoldat
konnte man sich allerdings wenig begeistern in Punkto Uebersetzung ist ihm dieAktion lebendiges Deutsch
wohl einen kleinen Schritt voraus. Hier hat der Prozess den Anspruch, oeffentlich, ja quasi-demokratisch zu sein. -
Rentner, Kampfhunde und Foucault
Am Donnerstag war ich in Friedrichshain, dem Stadtteil mit den grossen Hunden und dem ersten seniorenfreundlichen Supermarkt. Kampfhunde haben wir bei mir in Neukoelln ebenfalls und wachsame aeltere Mitbuerger sind wichtig. Vorgestern wurde mein Vertrauen in die Mechanismen sozialer Kontrolle jedoch erschuettert. Ich war mit einer Bekannten verabredet, die im hippen, studentischen Teil Friedrichshains wohnt.
Ich will dir dein Fahrrad zurueckgeben, ich gehe zurueck nach Schweden
, hatte sie am Telefon angekuendigt. Das Rad war in Topform, es sah besser aus, als ich es ihr ueberlassen hatte. Keine zehn Minuten nach der Uebergabe passierte das Unglueck. Vor einem Laden versenkte ich den Schluessel des abgeschlossenen Fahrrads in einem Luftschacht. Was tun? Ein fast neues, blaues, abgeschlossenes Herrenrad durch halb Berlin schleifen? Ein Rad, das garantiert nicht so aussah, als gehoerte es einer Frau unter Einssiebzig? Sie werden mich festsetzen, dachte ich. Mindestens drei Rentner werden sich auf mich stuerzen und nachfragen. Ich hatte keine andere Wahl. Es war bereits dunkel und einen Ersatzschluessel hatte ich nicht dabei. Ich beruhigte mich: Betrachte es einfach als Selbstversuch, sagte ich mir und teste einfach mal die Mechanismen sozialer Kontrolle als vermeintliche Fahrraddiebin. Die Hypothese, dass man mir bereits in Friedrichshain Schwierigkeiten machen wuerde, bestaetigte sich nicht. Niemand interessierte sich fuer mich. Spaeter in der U-Bahn in Kreuzberg, wurden ein paar Kids auf mich aufmerksam, aber die fanden das Rad wohl einfach nur uncool. Am Bahnhof Schoenleinstrasse stiegen Kontrolleure ein. Fuer die Frau ohne Fahrschein neben mir ein Problem, fuer mich nicht. In Neukoelln ist die Welt noch in Ordnung, dachte ich mir, da werde ich garantiert in eine Polizeistreife hineinlaufen. Nichts. Der Abend endete dann nicht auf der Polizeiwache, sondern auf dem Sofa mit Foucaults Abhandlung >Ueberwachen und Strafen< ueber die Geburt des Gefaengnisses. Die musste ich beim ersten Lesen voellig falsch verstanden haben. -
Zwischen den Assoziationen
Mit fuenzehn hat man ja die verruecktesten Ideen. Bei mir war es das Assoziationsspiel, das mir damals einfiel, als wir an einem Freitagabend mal wieder im Pub
Wild Turkey
rumsassen und nichts zu tun hatten. Wie immer war nichts los in Pritzwalk. Das Spiel funktioniert ganz einfach. Ich sage ein Wort und mein Nachbar muss das erste Wort sagen, dass ihm dazu einfaellt. Ohne zu ueberlegen! Dann ist der naechste dran. Wer zu lange ueberlegt, muss Einen trinken. Das hoert sich bloed an, macht aber Spass. Dieselbe Idee verfolgt der Assoziations-Blaster im Internet. Hier werden nicht nur einzelne Woerter in eine endlose Assoziationskette gesetzt, sondern ganze Texte. Jeder User kann seine Assoziationen zu bestimmten Woertern in Form eines Textes eingeben. Dadurch entsteht ein Text-Netzwerk in dem sich alle eingetragenen Texte mit nicht-linearer Echtzeit-Verknuepfung verbinden. Das hoert sich verworren an, ist im Grunde aber ganz simpel. Auf der Startseite steht zum Beispiel das WortMentalkastrat
. Ich klicke es an und erhalte einen Text, in dem das Wort vorkommt. Dann kann ich auch meine eigene Assoziation eintragen. Bei mir war es das Wortund
. Schwupps sehe ich die Assoziationen von anderen Leuten zum Wortund
. Tomtomcity schreibt zuund
zum Beispiel:Die Banalisierung des Boesen
. Dann kann ich wiederumBanalisierung
anklicken usw. usf. Aber wofuer ist der Assoziations-Blaster eigentlich gut? Man kann ihn zum Beispiel als ein Hilfsmittel fuer das Brainstorming verwenden. Oder man benutzt ihn einfach als ein ein Werkzeug zum Buecherschreiben, oder um diese automatisch geschrieben zu bekommen. Ausserdem erhaelt man Einblick in die komplexen Gedankenwelten seiner Mitmenschen. Und zu guter Letzt stellt der Blaster eine Verbindung zwischen allen Arten von Ansichten, Sprachen, Kulturen und Menschen her, die die ultimative, post-moderne Ambivalenz erzeugt – oder eine Art Zwischen-Fakten-Wissen. -
Symposium im Museum für Kommunikation
Guten Morgen geneigter Berliner Gazette-Leser. Heute ist es endlich soweit. Nein, es ist noch nicht Weihnachten, aber der Tag des McDeutsch-Symposiums ist endlich da! Heute Abend um 20 Uhr im Berliner Museum fuer Kommunikation. weiterlesen »
-
Kaffeepaussi in Finnland
Deutschland ist
Exportweltmeister
– erinnert sich noch jemand an diese Formel, die von Wirtschaftspolitikern gebetsmuehlenartig wiederholt wurde, um die konjunkturelle Lage der Bundesrepublik schoenzureden? Seit der Aufschwung da ist und das vermeintlichezweite Wirtschaftswunder
gefeiert wird, scheint das oeffentliche Interesse an Exporten hingegen nachgelassen zu haben. Anders in der Kulturpolitik. Der deutsche Sprachrat hat sich juengst mit Exportschlagern des Deutschen mit >ausgewanderten Woertern< – beschaeftigt.In einem Sammelband, den das Goethe-Institut nun veroeffentlicht hat, werden rund 6000 Woerter deutschen Ursprungs dokumentiert, die im Rahmen des Wettbewerbs
Woerterwanderung
in der ganzen Welt gesammelt wurden. In Kanada trifft man sich beispielsweise zumkaffeklatsching
, in Finnland hingegen machen Busfahrer einekaffepaussi
. Der am haeufigsten eingereichte Begriff war das in Frankreich verwendete AllzweckwortVasistdas
, das fuer Dachfenster, Oberlicht oder Tuerspion stehen kann.Zwar wollte das Projekt in erster Linie zeigen, dass es neben Begriffen wie
Kindergarten
undSauerkraut
noch viele weitere Worrter deutschen Ursprungs gibt. Doch was auch deutlich wurde, ist, dass viele der entlehnten Woerter auch Besonderheiten der jeweiligen Laender widerspiegeln. In Japan etwa hat der Begriffarbeito
Verbreitung gefunden, in Russland das WortBruederschaft
. Zwar enthaelt die russische Variante keinen Umlaut, doch als Trinkspruch funktioniert sie bestens. -
Germanische Genossenschaft
Ich lebe in Oslo, Norwegen, und arbeite als bildender Kuenstler. Ich veroeffentliche auch Prosa. Mit meiner Freundin und meinen beiden Kindern lebe ich in einer buergerlichen Gegend. Werktags gehe ich in mein Buero und arbeite dort. Am Wochenende haenge ich mit meiner Familie herum oder ich betrinke mich zusammen mit Freunden. Der Sommer in Norwegen ist hell und heiss, aber trotzdem irgendwie frisch, crisp. Der Winter ist sehr dunkel. Die Gesundheitsversorgung ist mehr oder weniger kostenfrei, und in den Kindergaerten soll es fuer jedes Kind einen Platz geben. weiterlesen »
-
Radio Babylon
Wir schreiben das Jahr 1961. Die deutsche Wirtschaft in der Westzone boomt. Man redet nicht von Arbeitslosigkeit, sondern beklagt einen Mangel an Arbeitskraeften. Immer mehr Arbeiter aus anderen Laendern stroemen in die BRD. Zunaechst vor allem aus Italien. Conny Froboess landet einen Charterfolg mit
Zwei kleine Italiener
. Doch so lustig das Getraeller auch sein mag, dieItaliener
, die in dem Song vorkommen, sind, wie die echten Italiener, ganz allein in Deutschland. Ihnen fehlen gemeinsame Treffpunkte, sie sind von Heimweh geplagt und einsam. Der saarlaendische Rundfunk ist der erste Radiosender, der versucht Abhilfe zu schaffen. Am 21. Oktober 1961 beginnt er samstags die SendungMezz’ora Italiana
auszustrahlen, in Zusammenarbeit mit dem italienischen Konsulat und der katholischen Kirche. Es ist die erste Sendung fuerGastarbeiter
in Deutschland und ein riesiger Erfolg. Immer mehr Rundfunkanstalten bieten nun Programme fuer die Zugezogenen an. Vor allem Radiosprachkurse sind gefragt.Deutsch ist gar nicht so schwer
ist der erste Kurs, den der Bayerische Rundfunk 1965 sendet. Am 2. Januar 1966 laeuft im hessischen Rundfunk die sechssprachige Sonntagssendung >Rendezvous in Deutschland< an. Als die 1970er Jahre anbrechen, leben nicht nur viele Italiener in Deutschland, sondern auch Tuerken, Griechen, Jugoslawen und viele mehr. Und eines wird immer deutlicher: DieGastarbeiter
werden zu Mitbuergern. Sie bekommen Kinder in Deutschland und gruenden Familien. Der gesellschaftliche Wandel stellt die Radioprogramme vor neue Herausforderungen: Wie kann man eigentlich die deutsche Hoererschaft in die Programme fuerAuslaender
integrieren? 1994 geht Radio Multikulti auf Sendung. Der Sender stellt sich genau dieser Herausforderung und bringt Programme auf Deutsch und in 18 anderen Sprachen. Hier zeigt sich nicht zuletzt, wie wandlungsfaehig die deutsche Sprache ist. Sie taucht nicht nur in verschiedenen Dialekten auf, sondern wird auch mit den mannigfaltigsten Akzenten gesprochen. -
Frankreichs neu erwachtes Sendungsbewusstsein
Die Franzosen wollen immer alles auf Franzoesisch haben, sagt man. Ferner: Die Franzosen hassen Englisch. Da ist noch etwas: Die Franzosen sind so stolz auf ihre Kultur, dass sie nicht im Traum auf die Idee kommen wuerden, deren Export in einer anderen Sprache als der Franzoesischen zu betreiben. Letzteres duerfte man auch in Deutschland verstehen. Doch waehrend es hierzulande nicht nur Goethe Institute, sondern auch die Deutsche Welle gibt, die die deutschsprachige Kultur in unterschiedlichen anderen Sprachen in die Welt hinaustraegt, war in Frankreich ein internationales Sprachrohr der nationalen Kultur lange Zeit nicht existent. Nun hat das Land aber endlich einen
internationalen
Fernsehsender: >France 24<, seit dem 8. Dezember auf Sendung. Waehrend Praesident Chirac Jahre nur davon traeumte, wird der Welt jetzt eine franzoesische Perspektive auf das globale Geschehen zu Teil. Wohlgemerkt auf Englisch!Die internationale Fernsehwelt wurde lange Zeit von angelsaechsischen Sendern dominiert
, wie der Geschaeftsfuehrer des Senders zu verstehen gibt. Nicht zuletzt waehrend des Irak-Kriegs hatte dieser Umstand negative Folgen: (US-)Fernsehbilder halfen die (US-)Invasion zu legitimieren. Die Position der Gegner – u.a. Frankreich fiel medial so gut wie nicht ins Gewicht. Damit soll Schluss sein. Der Trailer des Senders ist seit laengerem bei >YouTube< zu sehen, ueberzeugt wie ich finde jedoch nicht wirklich: Eine zu rasche Bildabfolge von meist aus Katastrophengebieten entnommenen Szenen. Da broeckelt das Image des ernst zu nehmenden Journalismus. Ist Gegen-Propaganda wirklich das angemessene Mittel? Warten wir ab und hoeren den in nahezu akzentfreiem Englisch berichtenden Sprechern erstmal zu. Es wird allerdings nicht nur in englischer, sondern auch in franzoesischer Sprache gesendet; ab Sommer 2007 vorraussichtlich auch auf Arabisch. Desweiteren ist eine Kooperation mit der Deutschen Welle geplant.








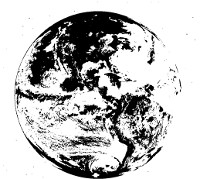





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN