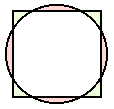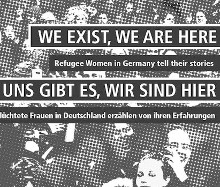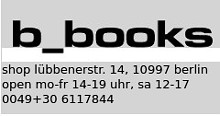Argh! Ich muss es zugeben. Mein Experiment ist fehlgeschlagen. Ich meine mein neues Zeitkonzept, den Tag nicht in Stunden und Minuten zu unterteilen, sondern in Mahlzeiten. Nachdem ich zweimal zu spaet zur Arbeit gekommen, beziehungsweise ueberhaupt nicht aufgetaucht bin (es laesst sich so schlecht zwischen Arbeitstag und Wochenende unterscheiden bei der Mahlzeitrechnung), musste ich mein Selbstexperiment leider aufgeben.
Nun bin ich dem Zeitstress wieder ausgesetzt, wie alle anderen Menschen (wenn man sie ueberhaupt noch so nennen kann!). Wenig Schlaf, immer Termindruck, immer alles schnell, schnell, schnell. Die Diktatur der Uhr, oder kurz: die Diktatuhr. Es ist einfach zum Haare ausbeissen! Deshalb moechte ich jetzt einen Ideenwettbewerb in der Berliner Gazette starten. Ich suche smarte Entschleunigungsstrategien. Verstehen Sie mich recht: nicht Zeitsparstrategien, wie etwa gleichzeitig Fernsehen gucken, essen und Logbuchtraege schreiben, aeh ich glaube das nennt man Multitasking, zumindest, wenn man dabei dann auch noch Zehennaegel kaut.
Nein, der Leser oder die Leserin mit der eindeutig besten Strategie zur Verlangsamung erhaelt ein Exemplar von Guenter Grasss Buchhit Beim Zwiebelschaelen
. (Eine schicke Papierausgabe.) Sie denken jetzt bestimmt: Ich interessiere mich nur fuer den Besten, damit ich den ganzen anderen Mist nicht auch noch lesen muss. Aber nein: Je mehr Konzepte, desto besser. Ich will endlich wieder in einem Berg von Texten baden und dabei die Zeit vergessen.








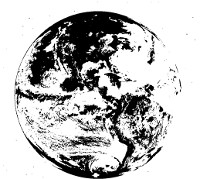





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN