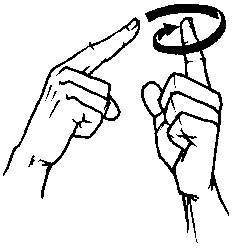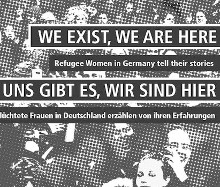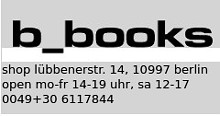Die Befuerwortung einer vorzeitigen Freilassung der ehemaligen RAF-Oberhaeupter Mohnhaupt und Klar hat schon etwas Reizendes. Vor allem wie da auf der Tastatur der Menschenwuerde und Reintegration, die die liberale Strafordnung bietet, herumgespielt wird. Oder wie sich vor allem die Liberalen Baum und Kinkel fuer die Inhaftierten einsetzen. Als ob das das Wichtigste von der Welt waere.

Mir geht es hier gar nicht um die verschiedenen Pros und Kons, die das gibt, und die in den letzten Tagen oeffentlich immer wieder hin und her gedreht worden sind. Interessanter ist vielmehr die Tatsache, dass sich so viele fuer die beiden oeffentlich ins Zeug gelegt haben. Wenn sie frei kommen, kommen sie eben frei. Aber warum so viel Aufhebens darum machen und ausgerechnet fuer sie Partei ergreifen? Mein Verdacht ist, dass es trotz aller oeffentlicher Dementis bei vielen der Verteidiger ein ideelles oder abstraktes Verstaendis fuer die Taten der Delinquenten gibt.
Nicht im Sinne jener bekannten klammheimlichen Freude
, die jener Goettinger Mescalero ausgedrueckt hat, sondern im Sinn einer Art von Verstaendnis, die mit zweierlei Mass misst und in den Taetern vorwiegend Opfer erblickt, ueber die der Rechtsstaat nun seine Guete walten laesst. Der Massenmord, den ein linker Politaktivist begeht, ist in den Augen einiger offenbar etwas voellig anderes als ein normaler Serienmord. Waehrend diesem niedere
Motive unterstellt werden, handelt jener mit edlen
. Und diesen Werten und Motiven, nicht den Taten, fuehlt man sich, gleich ob man FDPler, SPDler oder Gruener ist, zumindest irgendwie nahe.








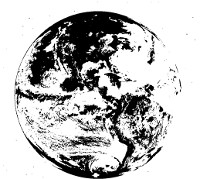





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN