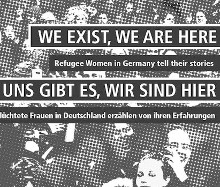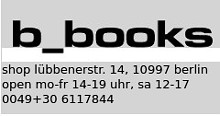Seit 1991 gibt es in Berlin ein Institut, dessen Team sich tagtaeglich auf irrationales Glatteis begibt: das Erratik-Institut. Verirrung, Fehler, Irrtum, Luege, Taeuschung – all das findet hier dankbare Aufnahme, begruendet es doch die so genannte vagabundierende Wissenschaft
der Erratik. Nichts in der Welt geschieht ohne Bedeutung, und alles ist bedeutungslos. So sind typische Forschungsprojekte beispielsweise die erratische Architekturkritik
, die Hubschrauberforschung oder die Materialermuedung
– wo auch immer das uns hinfuehren mag, originell ist’s in jedem Falle. Gruender des Instituts ist der in Kapstadt geborene Heinrich Dubel, der als Berliner Kuenstler und Autor des im Maas Verlag erschienenen Buches Helicopter Hysterie Zwo
bekannt ist.
- An/Greifbar: Warum BerlinerInnen gegen die digitale Kolonialisierung ihrer St…
- Hacking Women: Ein Blick über den Tellerrand der männlich dominierten Compu…
- Abschaffung der Arbeit? Künstliche Intelligenz, Kapitalismus und Transhumani…
- SILENT WORKS: Berliner Gazette Jahresprojekt zu verborgener Arbeit im KI-getr…
- Gemeinsam machen: Wie die feministischen Prinzipien des Internets entstanden …
- In der Schneekugel: Wie Literatur virtuelle Räume erinnern, erschaffen und n…
- Klimawandel und Selbstkritik: "Wir gedeihen, uneingeladen, wo wir nie wachsen…
- Bild des Monats: Warum wir im Jahr 2020 noch viel mehr Gretas brauchen werden…
- Am Ground Zero des Klimawandels: Green Grabbing, Massenmigration und die Roll…
- Jenseits des Menschengemachten: Indigene Kosmologien als Roadmap für die Kli…
-
Auf dem Glatteis der Vernunft
-
Die Kunst, den Faden zu verlieren
Morgens halb zehn in Deutschland. Genauer gesagt: Morgens halb zehn in Eberswalde. Ich bin hier, um an einem Seminar fuer Kulturschaffende teilzunehmen. Da ich selbst aus einer Kleinstadt komme, sehe ich mich mit den noetigen Hinterland-Skills ausgeruestet, um in Eberswalde zu ueberleben. Doch Eberswalde ist viel groesser als erwartet und der Marktplatz (mein Endziel) ist nicht bloss einen Steinwurf vom Bahnhof entfernt, wie in meiner Heimatstadt. Ich muss mich also nach dem Weg erkundigen. Ein Graus. Nicht nur, weil man sich so in der Provinz sofort als Fremdling outet, sondern auch, weil es, wie schon erwaehnt, halb zehn ist. Um diese Uhrzeit ist vornehmlich eine Bevoelkerungsschicht in der Stadt unterwegs: Renter. In der Naehe der Bahnhofsstrasse, die hier Eisenbahnstrasse heisst, entdecke ich einen aelteren Herren, der ganz nett aussieht. >Wo gehts n hier in die Innenstadt?< frage ich ihn. Er laechtelt mich an und sagt laut: >Hee?< Ich wiederhole meine Frage lauter. Er nickt verstaendnisvoll und milde: >Na ja, wissen sie, ich komme eigentlich nicht von hier. Also seit zwanzig Jahren wohn ich nun schon in Eberswalde, damals neunzehnhundertbarundziebzig…< Ich hoere ungefaehr zehn Minuten lang geduldig zu. Warum sollte er einfach antworten, wenn er auch eine Geschichte erzaehlen kann? Ich muss an meinen Zweitlieblingsschriftsteller Sten Nadolny denken, der auch schon meinte: >Verliere den Faden und du gewinnst die Welt.< Ich entferne mich langsam und unauffaellig und erspaehe den naechsten Rentner, der mir vielleicht weiterhelfen kann. >Entschuldigen Sie, wie komme ich denn zum Marktplatz?< frage ich, gleich in der richtigen Lautstaerke. >Meinen Sie das Einkaufszentrum? Einfach immer den Strippen nach!< ist seine Antwort. Was ist denn mit dem los? Spinnen hier alle? Spricht hier keiner Deutsch? Vielleicht redet der alte Herr ja von irgendeiner Verschwoerungstheorie, laut der wir alle nur Marionetten sind, die an Strippen haengen oder so. Dann faellt bei mir der Groschen: Die Busse fahren hier an Oberleitungen, so wie andernorts die Strassenbahnen. Und da die Busse alle den Marktplatz passieren, muss ich nur den >Strippen< folgen und komme irgendwann zwangslaeufig in die Innenstadt! Wer kann hier eigentlich kein Deutsch? Vielleicht gehen die Alten ja ganz anders mit der Sprache um. Sie nehmen sich die Zeit, auszuschweifen oder in Raetseln zu sprechen. Koennte nur unguenstig sein, wenn man zum Beispiel danach fragt, wo der naechste Feuerloescher steht.
-
Charlotte Chronicles.16
In meiner Firma hier in den USA werden kostenlose Deutschkurse fuer Mitarbeiter angeboten und nach den ersten Unterrichtsstunden teilten mir einige meiner Kollegen mit, dass Deutsch doch eine sehr harte Sprache sei, bei der fast die Stimmbaender ruiniert wuerden. Ich kann diese Ansicht bis zu einem gewissen Grad teilen, aber ganz so extrem, wie sie es formulierten, sehe ich es dann doch nicht. Von daher bat ich einen der Amerikaner, mir einmal einen Beispielsatz zu nennen und ich muss gestehen, dass nach dem mir entgegengeschleuderten >Ick spraecke Duitsch!< wirklich beinahe meine Trommelfelle bluteten. Es daemmerte mir, dass viele Deutschanfaenger, die spezifisch deutschen Laute, wie das >ch<, noch haerter ausprechen, als es Deutsche ohnehin tun und damit das (Vor)urteil ueber die >harte Sprache< bestaetigt sehen. Daraufhin beschloss ich, herauszufinden welche deutschen Sprachreferenzen man als normaler Amerikaner beim Heranwachsen mitbekommt und landete natuerlich unweigerlich beim Fernsehen. Zum einen wurden deutschen Schauspielern bis vor etwa 20 Jahren in Hollywoodfilmen nur Rollen als Nazis, Soldaten oder James-Bond-Antagonisten zugestanden, weshalb die meisten Amerikaner Ausdruecke wie >Stillgestanden<, >Haende hoch< oder ein gebruelltes >Ordnung muss sein< beherrschen. Deutsche Originalquellen tauchen fast ausschliesslich auf dem >History Channel< auf, der wegen des riesigen Programmanteils an Zweiter-Weltkriegs-Dokumentationen gelegentlich auch >The Hitler Channel< genannt wird und ebenfalls keine weichen Satzmelodien liefert. Nachdem klar war, welche sprachlichen Vorbilder die meisten Amerikaner haben, gab ich es auf, diesen Punkt entkraeften zu wollen und widmete mich lieber ihrem zweiten Kritikpunkt: Der komplizierten Grammatik, bei der man waehrend der unendlich verschachtelten Saetze die meiste Zeit nicht wisse, was denn eigentlich passiert, bis am Ende schliesslich das erloesende Verb komme. Ich erklaerte ihnen also, dass die deutsche Grammatik wie ein guter Krimi sei. Dort entfaltet sich auch ueber den ganzen Roman ein ungeklaertes Verbrechen und wenn am Ende die Aufloesung erfolgt, breitet sich die ganze wunderbare Konstruktion des Kriminalfalles vor dem Leser aus. Ob ich sie damit restlos von der Schoenheit deutscher Grammatikkonstruktionen ueberzeugen konnte, bezweifle ich nach ihrem kopfschuettelnden Abgang allerdings
-
Eine Frage des Bodens
Gemeinsam mit meiner Frau Alice Atieno und unseren vier Kindern lebe ich am Rand von Nairobi in einem Ort namens Kahawa Sukari. Es ist ein grosses Stueck Land, das sich die Menschen von der Savanne zurueckerobert haben. Mittlerweile leben hier ueber 20.000 Menschen, darunter viele Beamte aber auch viele Arme. Letztere hausen in Slumsiedlungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. weiterlesen »
-
Von der Emailisierung des Deutschen
Man freut sich immer, Post zu bekommen. Hollywood hat das vor Jahren in >Youve got mail< thematisiert. Der Film fuehrte einen Abloeseprozess vor Augen – vom Brief zur Email. Gestern war die elektronische Variante einfach nur die schnellere, billigere Schwester. Die so genannte digitale Revolution hat jedoch ihren Charakter veraendert. Vor allem ihre Form. Gerade da sie so schnell vom Sender zum Empfaenger und bei Bedarf wieder zurueck gelangt. Das Dialogische des klassischen Briefes ist hier laengst Vergangenheit. Damit alles noch schneller geht, werden Grammatik und Ortographie entsprechend angepasst.
Kaum jemand schreibt heute noch korrektes Deutsch. Gross- und Kleinschreibung? Voellig vergessen. Abkuerzungen wie
lg
fuerliebe Gruesse
sind absolut normal. Gefuehlsausdruecke wiegrins
oder Smileys sind in allen vorstellbaren Varianten laengst etabliert: :-), ;-), :-0… Kurz: Schrift wird immer mehr Zeichen. Die Frage, die sich allen aufdraengt: Ist das ein Schritt zurueck oder ein Schritt nach vorn? Hat das was von der primitiven Kommunikationsform der Hoehlenmenschen? Oder aehnelt’s eher der asiatischen Bildsprache mit ihrem festen Platz in der Science Fiction?Wie dem auch sei: Beim Email- oder SMS-Schreiben denkt eigentlich niemand mehr an die schoene Aesthetik des Briefes, sondern hackt einfach drauf los. Fuer die Wissenschaft Grund genug, sich damit zu befassen. Der Sammelband >Von *hdl* bis *cul8r*< zum Beispiel laesst 19 Autoren dazu Stellung beziehen. Jeder fuer sich erforscht den heissen Draht zwischen der geschriebenen Emailsprache und dem Deutschen, wie es im Lehrbuch steht. Einige interessante Thesen werden hier schon praesentiert. Erstaunlich allerdings ist, wie das Banale zur Grundlage hochtrabender Theorien wird. Ob dieser Ansatz ein Schritt zurueck oder ein Schritt nach vorn ist, sei dahin gestellt.
-
Tarnkappenbrowser, Abfreunden, Speicherstaebchen,…
Wie wuerde der Duden aussehen, wenn er von sprachverspielten Kulturkritikern verfasst wuerde? Also, wenn man ein paar intelligenten Irren oder auch wahnsinnigen Wissenschaftltern die Redaktion ueber das zentrale Nachschlagewerk der deutschen Sprache ueberlassen wuerde? Eine Antwort darauf bietet die Wortistik-Datenbank von Detlef Guertler. Der selbsternatte
Wortwart der Nation
versteht es, archivarische Ansaetze mit den Anspruechen der Kolumne zu verbinden. Das Ganze nennt sich danntazblog
. Ja, die gute alte taz, sie hat mal wieder Gespuer bewiesen, auch wenn mir persoenlich das Labelingblog
in diesem Zusammenhang missfaelt. Wie auch immer. Der Autor zeigt sich taeglich mindestens einmal von seiner besten Seite: Mal als Wortfluesterer, mal als Wortwizard, mal als Wortchronist, mal als Wortschoepfer. Immer geht es ihm um die unerforschten Dimensionen des alltaeglichen Sprachgebrauchs. Seine Kategorien lautenEntdudung
(u.a. rote Listen ausgemusterter Begriffe),Kindermund
(echte Zukunftsfragen),Leservorschlag
(echte Partizipation),Neubewortung
(echte Innovation),Sprachloch
(fuer Freunde der Schwarzen Loch-Theorie),Unword
(hier darf laut gepfiffen werden). Neugierig geworden? Einfach ein paar der knackigeren Begriffe in die >Blogsuche< geben und sich ueberraschen lassen, was der gute Mann aus ihnen so herausholt: Tarnkappenbrowser, Abfreunden, Speicherstaebchen, Klinsmanagement, Alegal, Ultrakurzhaendler, Massstabation, Grubbegugge, salzpfeffern. -
Miniaturen des Moments
Letzten Freitag: Ueberraschend schoenes Junior Boys-Konzert in der Diamond Lounge. Samstag: Denkwuerdiger Justin Timberlake-Auftritt bei >Wetten dass..?<. Sonntag: Kuenstliches Tageslicht und verspiegelter Boden im Streitraum der Schaubuehne. Montag: Dritter Teil der Falk-Krimiserie
Die dritte Gewalt
– wahrhaft duester-realistsch. Dienstag: Popmusik und aristokratische Dekadenz mit >Marie Antoinette< im Sony Center. Mittwoch, Donnerstag, uswusf. Taeglich ein Highlight. Taeglich ein Anlass fuer einen Eintrag im Logbuch der Berliner Gazette? Aber das Logbuch ist kein Tagebuch wie etwa eine gaengige Definition des Blogs nahe legt. Hier ueberlegen alle sorgsam, bevor sie schreiben. Selektion wie in der Tageszeitung. Was ist relevant? Was ist oeffentlichkeitsfaehig? Doch wir wollen keine Tageszeitung sein. Nicht zuletzt, weil wir keine sind. Martin Hufner brachte in seiner letzten Mail an mich den Begriff desoeffentlichen Notizbuchs
auf. Passt gut zu unserem Logbuch. Steht da nicht sogar Notizen zur Zeit? Forderte ich letzte Woche eine Sprache der Beschleunigung und Vernetzung, so geht es mir heute um eine Sprache des Fluechtigen, eine Sprache, die den Moment in sich aufgenommen hat. Das wuerde den primaeren Unterschied zur Tageszeitung markieren. Selektion, ja. Filtering, yes. Aber statt dann Texte zu schmieden, die geschliffenerweise ihren Prozess verschleiern, soll hier das Prozesshafte zu Tage treten. Der Entwurfscharakter des Notizbuchs erhalten bleiben. Und das Skizzenmaessige. Formal. Inhaltlich dagegen soll die Selektivitaet der Massenmedien – soweit moeglich – ueberboten werden. Schlichtweg zu viel los da draussen. Und hier? Junior Boys und Justin Timberlake im Streitraum der dritten Gewalt von Marie Antoinette. Den Zusammenhang moechte ich an dieser Stelle offen lassen. -
Im Verschwinden begriffen
Ich bin Russlanddeutscher. So eine Art Halbblueter. Deutsch koennte eigentlich meine zweite, oder auch erste, Muttersprache sein. Aber meiner Generation wurde die Muttersprache meiner Eltern leider nicht mehr beigebracht. Immer wenn ich in meiner Kindheit mit meinem Vater im Haus meiner deutschen Oma zu Gast war – meistens in der Urlaubszeit – kam ich mit der deutschen Sprache in Beruehrung. Alle sprachen untereinander Deutsch. Es war die Sprache, die sie am besten beherrschten und der sie am naechsten standen. weiterlesen »
-
Videoueberwachung in meinem Kopf
Obwohl ich in den letzten Wochen Fieber hatte, musste ich letzte Woche nach London fahren. Der Grund: Ich wollte offizielle Pruefungen fuer Aufnahmen an amerikanischen Universitaeten machen. Was ich in dem Pruefungsbuero erlebt habe, war ziemlich beeindruckend und sicherlich bezeichnend fuer ein Land wie England, in dem es geschaetzte 20 Millionen CCTVs (Sicherheitskameras) gibt. Sicher, das Pruefungsbuero, wie auch jede offizielle Pruefung, kommt ohne Regeln nicht aus. Aber die Sicherheitsmassnahmen dieses Bueros im finanziellen Stadtteil Londons erinnerten an
Mission Impossible
. Man musste sich wie ueblich zuerst registrieren lassen. Die Kandidaten mussten dann ihr persoenliches Eigentum in den Schliessfaechern hinterlassen.Very organised, indeed
, dachte ich. So richtig kafkaesk wurde es allerdings erst noch: Ich wurde informiert, dass man bei der Pruefung, nichts bei sich haben darf. Kulis, Schmierpapier, Taschentuecher und sogar Wasser sind im Pruefungssaal verboten. Nur ein Personalausweis ist erlaubt. Bevor ich mich zu diesen Bedingungen in den an eine Gefaenigniszelle erinnernden Pruefungsraum begeben habe, musste ich mich (ohne Brille) photographieren lassen und ein offizielles Dokument unterschreiben, in dem ich eidesstattlich erklaerte, dass ich mich an gewisse Regeln halten wuerde. Waehrend der Pruefung wurde ich mit Sicherheitskameras ueberwacht, der ganze Raum war voll von Hohlspiegeln. Ich wurde zusaetzlich von einem Raum aus ueberwacht, der nebenan lag und vom Pruefungssaal nur durch eine riesige Fensterscheibe getrennt war. Es fehlte eigentlich nur noch, dass mein Hirn bei der Arbeit durchleuchtet wurde. Denn die Architektur der Ueberwachung implizierte nichts anderes als die totale Kontrolle. Und damit auch die Kontrolle ueber meine Gedanken. Ein solches Szenario duerfte in der ersten Generation Misserfolge am Fliessband hervorbringen. Schliesslich: Wer erlebt sich bisweilen nicht als ein Subjekt, das Ideen produziert, welche der Pruefung eines hochgeruesteten Ueberwachungsstaates nicht standhalten wuerden?








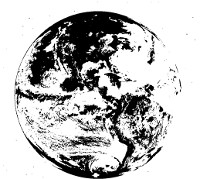





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN