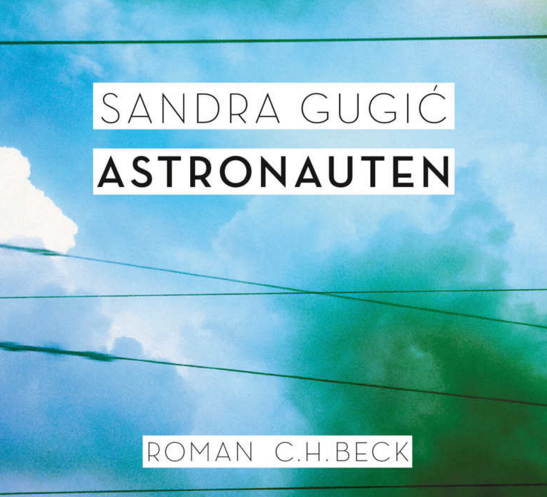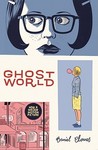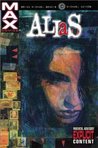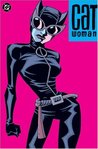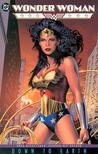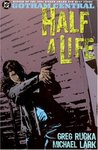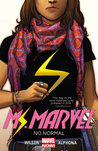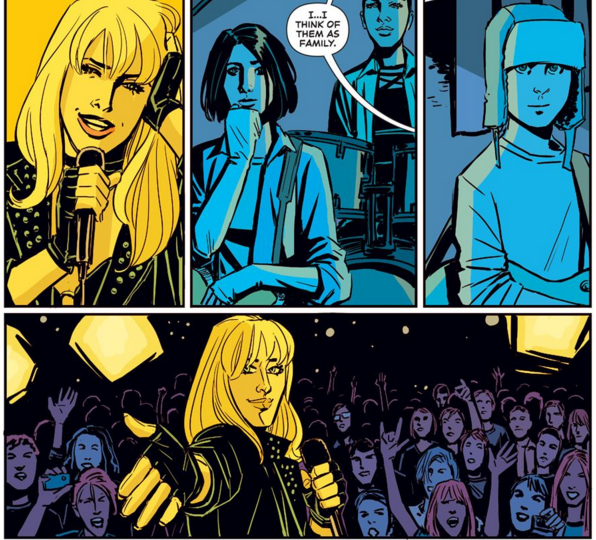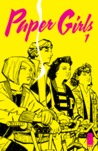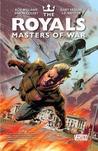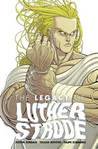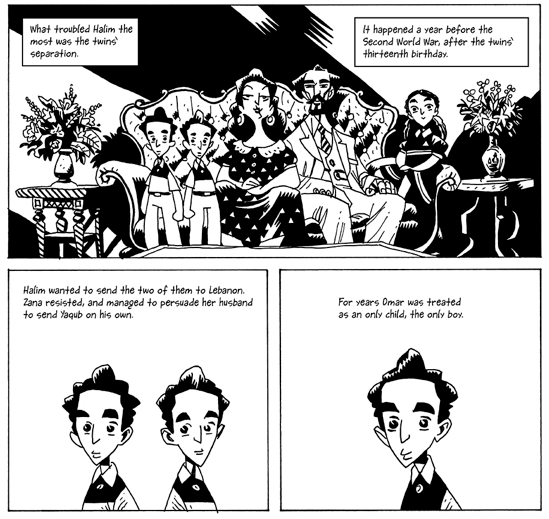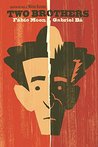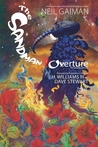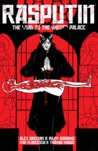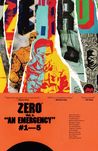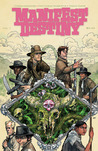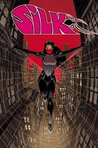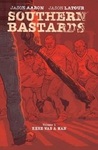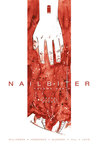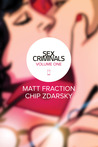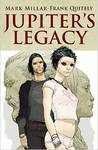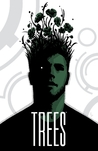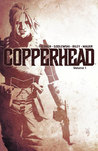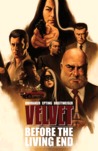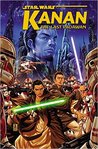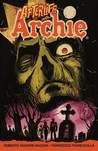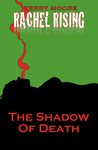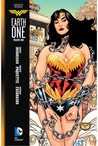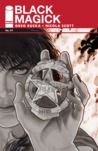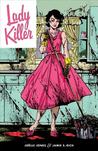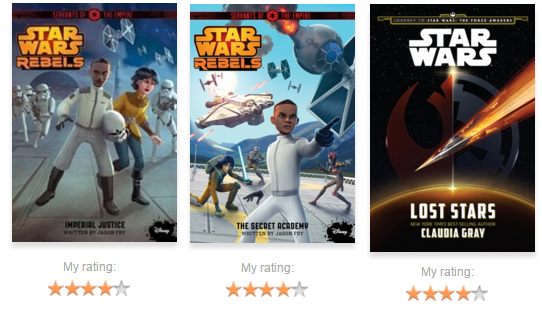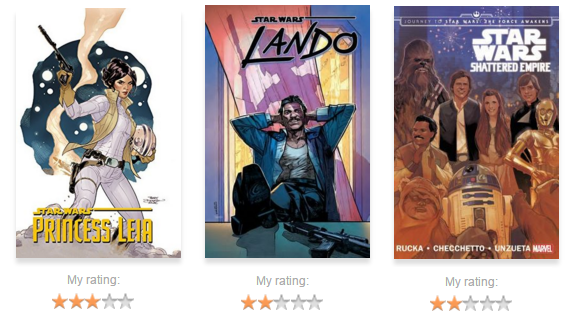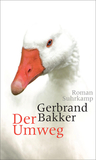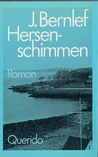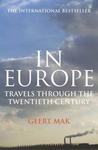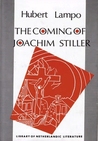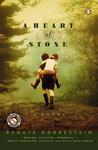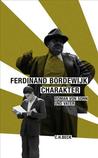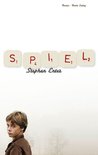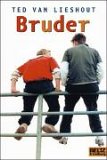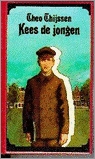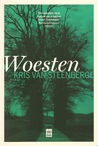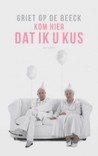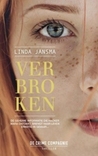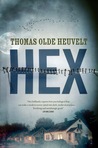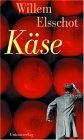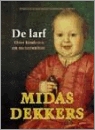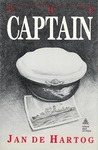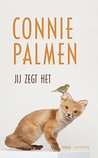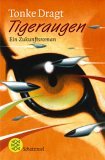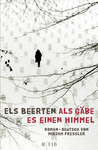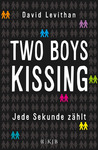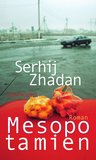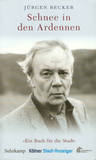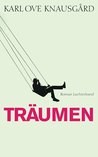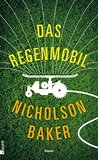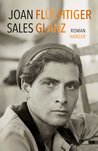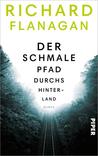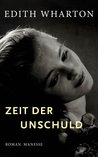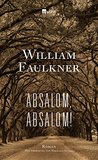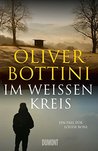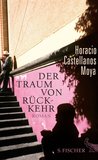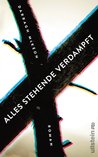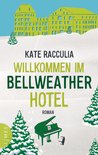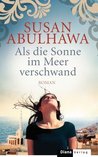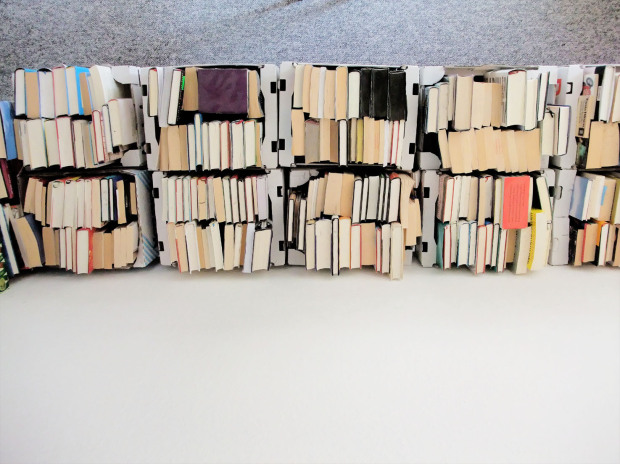.
Die (immer gleichen) Debatten über Qualität und Selbstverständnis von Buch- und Literaturblogs verlieren – zum Glück – langsam an Schwung: Niemand, der online über Lesen und Bücher schreibt, muss sich dauernd neu erklären, entschuldigen, rechtfertigen.
Trotzdem habe ich viele Fragen an Rezensent*innen und Blogger*innen – und sammelte Ende September 2015 eine erste Runde: 15 #blogfragen zum Mitnehmen und Beantworten.
über 20 Buch- und Literaturblogs haben seitdem geantwortet:
- „Schöne Seiten“, Caterina Kirsten
- „Literaturen“, Sophie Weigand
- „Flying Thoughts“, Verena (Teil 2 hier)
- „Der Buchbube“, Christoph Walter
- „Mokita“, Fabian Neidhardt
- „Lust zu Lesen“, Sonja Graus
- „Buchimpressionen“, Devona
- „aus.gelesen“, (Link zu Facebook)
- „Zürcher Miszellen“, Gregor Lüthi
- „A Million Pages“, Rosa
- „Literaturina“, Katharina „Rina“ Jach
- „Lust auf Lesen“, Jochen Kienbaum
- „Buchstäbliches“, Tanja Mandelt
- „Muromez“, Ilja Regier
- „Leckere Kekse“, Silvia und Astrid
- „Schlaue Eule“, Sophie und Agnes
- „Booknerds.de“, Chris Popp, Dominik Nüse-Lorenz, Laurent Pichaczek, Norman R.
- „Reingelesen“, Madame Flamusse
- „Nur Lesen ist schöner“, Stephanie „Steffi“ Sack
- „Buchkolumne“, Karla Paul
- „Die Reparatur“, Dr. Guido Graf
- „Denkzeiten“, Dr. Sandra Matteotti
.
Chris Popp von Booknerds.de hat eine Liste mit „unbequemen, stachligen, kratzigen“ Fragen veröffentlicht. Ich habe hier (Link) geantwortet. Eva Maria Höreth hat einen Fragenkatalog an Autor*innen zusammengestellt. Auf ihrem Blog Steglitzmind stellt Gesine von Prittwitz schon seit Jahren Fragen an Blogger: Empfehlung!
Meine 50 Lieblings-Buch- und Literaturblogs habe ich im Juli hier gesammelt und verlinkt.
.
.
Ich habe alle Antworten gelesen, wollte ein paar Lieblings-Statements sammeln und verlinken…
…und habe jetzt, in den letzten sechs Stunden, folgende (monströs lange!) Antwort-Collage montiert. Meine Fragen – und eine Reihe von Antworten, manchmal um einige Sätze gekürzt.
.
01 Das Lieblingsbuch meiner Mutter:
Buchimpressionen: „Ob sie EINS hat, weiß ich nicht, auf jeden Fall liebt sie die Lyrik von Eva Strittmatter und stand mit der Schriftstellerin bis zu ihrem Tod in (hand)schriftlicher Verbindung.“
Zürcher Miszellen: „Wahrscheinlich ein 500-Seiten-Paperback, in dem jemand sein Gedächtnis verliert.“
Muromez: „Sie kann sich als Vielleserin nicht festlegen. Vielleicht eins von Iwan Bunin. Kein Konkretes. Meint sie. Wechsle ja ständig.“
Schlaue Eule: „Sie konnte sich nicht entscheiden und ihr sind immer mehr eingefallen! „Das besondere Gedächtnis der Rosa Masur“ – Vladimir Vertlib, „Glasperlenspiel“ – Hermann Hesse, „Der Fuchs war immer schon der Jäger“ – Herta Müller, „Eine liebevolle Sicht auf die Erde“ – Elisabeth Loibl.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Wann schafft endlich mal jemand den Begriff „Lieblingsbuch“ ab? Wer kann sich denn für ein Buch entscheiden und warum müssen wir das eigentlich? Meiner Mutter geht es da wie mir und sie hat verschiedene Bücher gern gelesen – z.B. „Nicht ohne meine Tochter“ oder auch das von mir empfohlene „Drachenläufer“ von Khaled Hosseini sowie „Das karmesinrote Blütenblatt“ von Michel Faber. Sie versinkt gern in Geschichten, Schicksalen und lässt sich dann von fremden Erlebnissen, Charakteren umarmen.“
Denkzeiten: „Meine Mutter las keine Bücher, ging aber jede Woche mit mir in die Bibliothek – so hat sie mich quasi in die Sucht getrieben.“
.
02 Das Lieblingsbuch meines Vaters:
Schöne Seiten: „Mein Vater liest alles, was im Haus herumliegt, die Bücher meiner Mutter und die, die ich ihm mitbringe. Vorzugsweise aber Spannungsliteratur. Und er sagt zu allem unterschiedslos: »Ja, war gut.« Er ist kein Mann der großen Worte. Nur Franzens „Unschuld“ fand er ein bisschen anstrengend und Wolf Haas gewöhnungsbedürftig. Ansonsten ist er jedoch leicht zufriedenzustellen.“
Lust auf Lesen, Jochen Kienbaum: „Mein Vater ist ein herzensguter, aber auch ein sehr rationaler Mann, ein Ingenieur, kein Mann der Worte. Die Kraft des Positiven Denkens von Norman Vincent Pearle war vor vielen Jahrzehnten sein Lieblingsbuch, damals vielleicht das einzige, das er wirklich mehr als einmal gelesen hat. Der Titel wurde zum geflügelten Wort in der Familie. Und wie eine Mahnung stand Vaters einziges Buch im Regal. Seit er Rentner ist liest er mehr, viel mehr, auch mit gesteigertem Genuss und gutem Lesegeschmack; gerne politische Sachbücher, Biographien, aber auch viel Belletristik.“
Denkzeiten: „Mein Vater las Zeitungen, jede, die er in die Hände kriegte. Bücher las auch er kaum. Er hatte aber eine ganze Reihe grüner Bücher (wir nannten sie nur „die grünen Bücher“) im Regal stehen mit dem Titel „Die Kulturgeschichte der Menschheit“. So lange ich denken kann, sagte er, dass er die dann mal lesen wolle, wenn er pensioniert sei. Das ist er nun seit bald 20 Jahren, gelesen hat er sie noch immer nicht (was ich nicht anders erwartet hatte 😉 ). Noch immer liebt er aber Zeitungen und Nachrichten, ist der wohl informierteste Mensch, den ich kenne, wenn es um das aktuelle Geschehen auf der Welt geht.“
Nur Lesen ist schöner: „Mein Vater liebt fränkische Krimis. Ich glaube, ihm gefällt dabei besonders der regionale Bezug der Geschichten. Sie sind für ihn viel greifbarer und authentischer. Er hat eben gern handfeste Beweise!“
.
03 Ich führe einen typischen Buchblog, weil…
Zürcher Miszellen: „Ich schreibe keinen typischen Buchblog, eher einen Feuilleton-Blog, in dem auch Bücher besprochen werden. Als studierter Journalist, der gerade noch ausschliesslich mit klassischen Medien sozialisiert wurde, neige ich weiterhin auch eher zum klassischen Journalismus. Ich experimentiere aber auch mit freieren Textsorten.“
Lust auf Lesen, Jochen Kienbaum: „…ich eigentlich keinen typischen Buchblog führen möchte. Ich ziehe auch die Bezeichnung Literaturblog vor, weil mir das schärfer und präziser erscheint. Im tausendfachen Heer der Blogs steche ich dann aber doch nicht wirklich hervor. Manchmal bereitet mir das Sorgen, doch die werfe ich schnell über Bord. Dafür macht mir das Bloggen zu viel Spaß, selbst wenn es tausende Andere auch machen. Fußball spielen ja auch tausende Menschen, es ist und bleibt dasselbe Spiel und doch spielt es jeder anders und jeder entwickelt seine individuellen Techniken, seinen Stil, findet sein persönliches Vergnügen.“
Muromez: „…sich hier genügend Rezensionen finden lassen. Damit wird der Vorwurf unterstützt, dass Blogger im Prinzip nichts anderes machen als die professionellen Literaturkritiker (nur schlechter), die medialen Potentiale nicht erkennen und lediglich – und das auch noch vermehrt in der bösen Ich-Form – tippen. Verwerflich, dass ich die Form der Literaturkritik (insofern hier eine stattfindet und das ist eine andere Frage!) benutze und nicht weiterentwickle. Im Übrigen bezeichne ich Muromez als Literaturblog. Buchblogs sind für mich solche, die über wenig bis gar keine literaturkritische Gattungen verfügen, mehr mit Bildern (von Büchern) arbeiten. Zeigen, wie sich ihre Stapel ungelesener Bücher vergrößern, Gewinnspiele anbieten und so weiter.“
Reingelesen: „tue ich das? nö glaub nicht – angefangen hat es als Leseliste für mich selbst, früher eine Exceltabelle heute eben hier, allerdings lasse ich die Sachen, die mir nicht gefallen meistens weg und schreib nur über das, was ich mochte.“
Buchkolumne, Karla Paul: „… ich nicht anders kann? Ich bin damals über das Studium zum ersten Onlineprojekt rund um Literatur gekommen und stieß auf Tausende Leser, die sich im Internet über Bücher austauschen. Hier erreiche ich all die Bibliomaniacs, völlig unabhängig von Zeit und Ort und bekomme sofortige Rückmeldung auf meine Beiträge, Tweets, Statusupdates rund um die schönste Nebensache der Welt: Lesen. Auf meiner Webseite kann ich alles dazu versammeln, Buchtipps, Interviews und Kolumnen. Ob er typisch ist, das weiß ich nicht (was ist ein typischer Buchblog, Stefan?) – er wächst seit Jahren mit mir mit, ich baue ihn um, finde mal mehr und mal weniger Zeit dafür. Es ist mein digitales Zuhause.“
.
04 Ich bin anders als die Blogs, die ich gern lese, weil…
Lust auf Lesen, Jochen Kienbaum: „… ich hinter meinem Blog stehe, mit meinen Leidenschaften, Vorlieben und Macken. Hinter den anderen Blogs stehen andere Menschen, mit ihren anderen Leidenschaften, Vorlieben und Macken. Deshalb sind wir alle irgendwie anders, selbst wenn wir über dieselben Bücher schreiben sollten.“
Buchimpressionen: „Vielleicht bin ich inhaltlich ein wenig minimalistischer als andere: keine Blogtouren, keine Lesevents, keine Verlosungen, keine Spielchen, kein Sub, keine Listen, was ich wann mal noch lesen will oder nie geschafft habe, zu lesen, weil…eben all das, was ich woanders auch nicht lese, weil es mich vom Wesentlichen ablenkt. Höchstwahrscheinlich bin ich auch nicht ganz so gut vernetzt wie andere, sehe das aber entspannt.“
Buchstäbliches: „Gerade bei jüngeren Buchbloggern sehe ich häufig sehr bunte Seiten, viele Fantasyromane und eine dynamische Startseite. Dies wollte ich so für mich nicht. Mein Blog hat eine statische Startseite, auf der ich Orientierung bieten möchte, phantastische Literatur bildet nur einen kleinen Teil meiner besprochenen Bücher und das Ganze ist auf jeden Fall sehr textlastig und ohne Bling-Bling.“
Silvia, Leckere Kekse: „…wir den Blog zu zweit machen und dadurch mehr Vielfalt in der Buchauswahl zeigen können. Ausserdem bringen wir noch andere Themen die uns bewegen. Zum Beispiel Kekse…“
Chris Popp: „…unser Ich multipel ist. Derzeit sind wir zu siebzehnt, mit unterschiedlichsten Interessen und Schwerpunkten. Wir legen uns weder auf Genres noch auf Medien fest. Wir schreiben über Bücher, über Hörbücher, über Filme, über Musik, über Serien, schreiben Kolumnen, haben Specials, machen Außenschalten. Und wir haben unseren eigenen Groove. Wir ticken anders. Wir betreiben kakophonen Medienhalbjournalismus. Wir sind awesome. Wir riechen gut und sind der gute Geschmack. Alle wollen uns. Wir nehmen uns nicht immer ernst.“
Muromez: „…der Fokus vermehrt auf osteuropäischer Literatur liegt und regelmäßig Klassiker näher gebracht werden, die sonst scheinbar niemand mehr liest oder über die niemand mehr schreibt/schreiben will. Amerikanische Werke werden hier zum Beispiel kaum behandelt. Auf Short-/Middle-/Long-/whatever-Lists habe ich genauso wenig Bock. Ein Marketing-Preis, den ich wenig bis kaum beachte und der mir nicht diktieren soll, was ich zu lesen habe, um up to date zu sein. Da verzichte ich und pflege lieber eine individuellere Auswahl, genieße meine Freiheit. Ansonsten findet sich hier viel Häftlingsliteratur (Nationalsozialismus, Stalinismus), gerne werden auch Werke behandelt, die von Süchten und Kriegen/Konflikten handeln.“
.
.
05 Am Bloggen überrascht mich / beim Bloggen habe ich gelernt, dass…
Sophie Weigand: „…es einen Alltag und die Art, wie man Bücher liest und rezipiert, völlig verändern kann. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man nicht nur gelegentlich mal irgendwas ins Internet schreibt und mal ein Buch liest, sondern das Ganze eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommt. Man nimmt es dann auch ernster, stellt Ansprüche an sich, die man vorher nicht hatte.“
Lust auf Lesen, Jochen Kienbaum: „…es viel Zeit und Herzblut kostet. Ein Buch zu lesen ist eine Sache, darüber einen Text zu verfassen, eine andere. Sicher ist: Ich lese inzwischen etwas aufmerksamer, sammle und sortiere bereits bei der Lektüre Gedanken zum Buch. Allerdings: Wenn’s ans Schreiben geht, sind die meist schon wieder entfleucht. Texte, Besprechungen, Kurzkritiken zu formulieren ist harte Arbeit für mich und fordert mich extrem. Am Ende seufze ich oft: Das versteht jetzt niemand, das ist doch gequirlter Unsinn. Bloggen lehrt Demut und Präzision. An beidem mangelt es mir (noch).“
Norman R., Booknerds.de: „…die Resonanz meist nur an der Klickzahl des jeweiligen Beitrags erkennbar wird. Wir sprechen hier zwar von einem dreistelligen Bereich an Leserinnen und Lesern, aber Kommentare kommen dann doch meist nur bei den ohnehin strittigen Themen.“
Mokita: „Immer wieder lehren mich der Blog, das Internet und die direkten und indirekten Folgen für mich, dass selbst meine kleine Spielwiese hier die Leben anderer Menschen beeinflussen kann. Wenn ich sie dabei ein bisschen erfreuen, bereichern oder unterhalten kann, kann ich Gutes tun. Schön, nicht?“
Lust zu Lesen, Sonja Graus: „…sich das Lesen nachhaltig verändert, weil ich durch das Verfassen der Besprechungen noch sensibler und aufmerksamer mit dem Text umgehe. Man wird kritischer bei der Vorabauswahl und lernt durch die Vernetzung mit den anderen Blogs und der persönlichen Auseinandersetzung mit den anderen Meinungen die eigenen Einschätzungen noch mal zu hinterfragen. Überrascht hat mich die Geschwindigkeit, mit der neue Kontakte in sämtliche Bereiche des Literaturbetriebs entstehen.“
Guido Graf: „…mich, wie sonst auch, das am meisten interessiert, was ich nicht verstehe.“
A Million Pages: „Am Bloggen überrascht mich, wie sehr es mich entspannt. Ich konnte mir angesichts meines hektischen Jobs zu Beginn gar nicht vorstellen, dass ich für dieses Hobby viel Zeit erübrigen kann, aber es funktioniert – ganz einfach, weil es Spaß macht und einen guten Ausgleich bietet.“
Buchstäbliches: „…viel Schreiben zu besseren Texten führt. Wenn ich meine ersten Rezensionen lese (die eigentlich ja noch gar nicht so alt sind), juckt es manchmal sehr in meinen Fingern und ich würde sie am liebsten komplett umformulieren. Mache ich aber nicht, weil ein Blog auch sehr schön eine persönliche Entwicklung aufzeigen kann. Die Artikel sind schließlich ein Teil von mir, meine Vergangenheit gehört dazu. Außerdem habe ich gelernt, geduldig zu sein, es dauert, bis man Leser gewinnt und manche Artikel, in die ich sehr viel Energie gesteckt habe, interessieren immer noch niemanden. Damit umzugehen ist ein Lernprozess und klappt nicht immer.“
Muromez: „…ich auch einfach mal auf Veröffentlichen drücken muss, statt weiter stundenlang zu redigieren, herumzudoktern und zu verändern – irgendwann ist gut. Ich verdiene keinen Krümel damit. Es ist nicht mein Lebenswerk, mehr ein sinnvolles Hobby, ein Trainingsplatz und ein Gedankensortiergerät, das gleichzeitig einem persönlichen Literatur-Archiv gleicht. Ehrgeiz ist förderlich, hemmt manchmal aber dennoch.“
Chris Popp: „Überrascht hat mich die Dynamik der Bloggerszene und die beeindruckende Möglichkeit des Netzwerkens. Wenig Konkurrenzdenken, viel Gemeinschaftsdenken. Und wenn Konkurrenz, dann auf eine freundschaftliche, neidlose Art. Auch überrascht hat mich, dass so manche Künstler, Verlage oder was auch immer auf uns zukommen, von denen ich es niemals gedacht hätte. Auch habe ich gelernt, dass man sehr schnell instrumentalisiert und als Werbemultiplikator benutzt werden kann. Da bin ich doch sehr vorsichtig geworden, zuweilen kommt da auch der Zickerich in mir durch.“
.
06 Helfen Amazon-Rezensionen? Wobei? Wie?
Literaturina: „Ich lese keine Rezensionen auf Amazon (ups). Nur der Score auf Goodreads lässt mich manchmal aufhorchen. Dort sind die Rezensionen allerdings oft mit Spoilern aller Art gespickt, so dass ein Reinlesen einem Marsch durch ein Minenfeld gleichkommt.“
Astrid, Leckere Kekse: „Nein, mir nicht! Ich kenne die Personen nicht, die sich dahinter verbergen, es ist sehr anonym und immer häufiger vermute ich hinter den Rezensenten Profischreiber. Bücher kaufe ich immer in einer Buchhandlung.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Den Oberflächlichen, den ‚Sternenguckern‘, helfen sie in Fastfood-Manier, der Masse zu glauben. Da wird nicht nachgeschaut, was am Buch beziehungsweise am Artikel gut oder schlecht ist, sondern entschieden: „Oh, hat viereinhalb Sterne, muss gut sein, wird gekauft!“. Als ich noch einen Amazon-Account hatte, habe ich eine Kurzversion meiner Rezensionen zu diversen Titeln eingestellt – und musste feststellen, dass die Texte wohl kaum gelesen werden, wenn Du nicht einer der allerallerallerersten Verfasser bist. Es steht in keiner Relation zum Aufwand. […] Ganz schlimm ist die Mauschelei unter diversen Selfpublishing-Autoren, die sich sogar in Facebookgruppen organisieren, um sich gegenseitig mit 5-Sterne-Bewertungen zu pushen.“
Muromez: „Zumindest schaden sie nicht, wenn sie einige mehr Sätze enthalten und über gut, schlecht, herzzerreißend oder todtraurig hinausgehen. Mir helfen sie vor allem zu erkennen, ob ein Werk überhaupt aufgenommen und gekauft wird. Bei null Bewertungen tendiere ich dazu, zu behaupten, dass dieses Werk nur wenige Leser hat. Ist das (eigentlich) so?“
Guido Graf: „Sie helfen Amazon.“
.
07 Hilft Literaturkritik in Zeitungen und Magazinen? Wobei? Wie?
Zürcher Miszellen: „Ja. Dort schreiben kluge Köpfe, die sich irgendwann und oft zurecht durchgesetzt haben. Wer Literaturkritik als Beruf betreibt, schreibt oft anders und mit mehr Erfahrung als ein Blogger, der in seiner Freizeit schreibt (mich nicht ausgenommen).“
Norman R., Booknerds.de: „In meinem Alltag spielen Kritiken eine große Rolle, weil sie im besten Fall die Augen öffnen und Denkanstöße geben oder zumindest eine grobe Richtung anzeigen, was ich von etwas zu erwarten habe. Dazu gehört allerdings, dass die Kritik in einen Kontext eingebettet wird. Welche Zielgruppe soll angesprochen werden? Wofür steht der Rezensent? Was sagen die anderen? Dann kann Kritik ein hilfreicher Begleiter sein, aber kein Helfer, der einem die Arbeit abnimmt.“
Lust zu Lesen, Sonja Graus: „Sie kann helfen. Dabei, sich einem Buch mal aus einer völlig anderen Perspektive zu nähern. Ich schätze an den Kritiken im Feuilleton vor allem die, in denen dem Autor, seinem Lebenshintergrund und der Entstehungsgeschichte entsprechend Platz eingeräumt wird. Dadurch kann sich die Sicht auf den Text verschieben und ein neues, anderes Lese-Erleben entstehen.“
Buchimpressionen: „Lese ich sehr selten (am ehesten noch „Perlentaucher“), für mich ist das Randinfo und meist nicht hilfreich. Ich denke, da werden Bücher aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, als ich ihn habe. Ich habe keinen hyperintellektuellen Anspruch und muss ein Buch nicht en detail tot analysieren, für mich ist Lesen immer noch zu einem großen Teil Entspannung, das Verlassen des Alltags, Eintauchen in andere Welten. Das darf mich gerne unterhalten und muss mich nicht permanent zu geistigen Höchstleistungen herausfordern.“
Silvia, Leckere Kekse: „Bei manchen Kritikern weiß ich auch: Wenn der das Buch lobt, ist es nichts für mich.“
Chris Popp: „Es kommt ganz darauf an. Hochgestochene Feuilletonschreibe und hochnäsigen Magazinschrieb mag ich gar nicht, und der hilft zumindest mir nicht. Selbiges gilt für schlichtweg schlechte Literaturkritik – die ist gedruckt auch nicht besser, nur weil sie auf Papier ist. Aber wenn Literaturkritik bodenständig, ehrlich und mit Herzblut geschrieben ist, ist sie doch sehr hilfreich – in puncto literarischer Selbstfindung. Wobei mir da weniger um Kauftipps geht, sondern um einen – wenn auch einseitigen – Austausch. Mich interessiert die Meinung einfach.“
Muromez: „Schöne Frage. Ich schreibe gerade an meiner Master-Arbeit zu diesem Thema und könnte jetzt ganz, ganz weit ausholen. Dabei will ich das Verhältnis von Literaturbloggern und professionellen Literaturkritikern herausstellen und zeigen, welche Funktionen beide Parteien haben und ob sie nebeneinander ergänzend existieren können oder im Haifischbecken Literaturbetrieb schwimmen. Und können beide sogar voneinander profitieren, ist das vorzustellen? Um es kürzer zu machen: Wenn die Literaturkritik, die zweifelsohne Platz und Zeilen im Gegensatz zu Literaturtipps benötigt, eine Orientierungs- sowie Informationsfunktion einnimmt und gleichzeitig als Entscheidungshilfe agiert, kann sie helfen. Wobei? Ich glaube, es war Adorno, der gesagt hat, dass Kunstwerke zu ihrer Entfaltung auf Interpretation, Kritik und Kommentare angewiesen sind. Mich muss professionelle Literaturkritik überraschen und sie muss von Expertise geprägt sein. Ich will daraus etwas entnehmen, was mir nach der Lektüre bisher noch nicht bewusst war und damit meine ich nicht den Inhalt oder die Biografie des Autors. Es muss Klick machen, ein Aha-Erlebnis muss sich formen.“
.
08 Helfen Blogs? Wobei? Wie? Wem?
Schlaue Eule: „Ja, ich finde schon. Blogger sind wie du und ich. Wir lesen alles, nicht nur Literatur. Wir sind glaube ich mehr zugänglich als Rezensionen in einer Zeitung.“
Lust zu Lesen, Sonja Graus: „Wenn ich über längere Zeit einem Blog folge, kann ich seinen Verfasser einschätzen, kenne seine Interessen und Schwerpunkte und weiß seine Besprechungen zu deuten. Das muss nicht automatisch heißen, dass ich nur den gerne lese, der sich mit meinen Vorlieben deckt.“
Buchimpressionen: „Sie helfen, Informationen zu bekommen, die mir ein Verkaufsportal nicht bietet. Blogs sind bunt und so verschieden, dass für Jeden etwas dabei ist: der Eine mag es strukturiert, der Andere eher chaotisch mit viel Bling-Bling. Ich hab die Möglichkeit, schnell das zu finden, was mir persönlich liegt und für mich das heraus zu ziehen, was für mich wichtig ist. Unabhängige Blogger sind zum Großteil mit Herzblut bei der Sache und haben kein wirtschaftliches Interesse, von daher messe ich ihren Meinungen eine beachtenswerte Bedeutung bei.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Blogs helfen, weil man innerhalb kürzester Zeit unzählige Informationen und Meinungen zu einem Buch lesen kann, man muss nur etwas googlen und sich durchklicken. Die unglaublich unterschiedlichen Schreibstile und Gedankengänge helfen einem dabei, „Seelenverwandte“ zu finden – das ist im Virtuellen um einiges einfacher. Jede „Leserschicht“ hat ihre eigenen Anlaufstellen. Blogs helfen aber auch den finanziell nicht so gut betuchten Menschen, die sich nicht ständig Zeitungen und Literaturmagazine kaufen können.“
Zürcher Miszellen: „Ich hatte die Hoffnung, dass man viele kunst- und literaturinteressierte Leser findet. Bisher habe ich vor allem kunst- und literaturinteressierte Schreiber gefunden. Blogger lesen Blogger. Und vielleicht sollte ich Frisch zitieren: Schreiben heisst: sich selber lesen.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Ich mache zwischen der klassischen Literaturkritik und Buchblogs keinen Unterschied – verschiedene Medien und Autoren schreiben über Literatur und ich setze mir über das Internet meine Auswahl als Filterbubble zusammen. Die oft sehr persönlichen Empfehlungen der Blogger sind dabei ebenso wichtig wie die meist sachlicheren Bewertungen der Literaturkritik und beide für mich als Leserin gleichwertig notwendig für die tägliche Entscheidung für oder gegen ein Buch. Zudem sind die Menschen hinter den Blogs inzwischen zum größten Teil zu persönlichen Freunden geworden und der Austausch geht weit über die Bücher hinaus. Ein Punkt mehr für das „sozial“ in „soziale Netzwerke“.“
Norman R., Booknerds.de: „Blogs können dabei helfen, die Meinungsbreite zu erhöhen. Gerade heutzutage wird das immer wichtiger, weil im Kulturbereich generell und damit auch im Kulturjournalismus immer weniger Geld vorhanden ist. Kaum jemand kann heute noch ausschließlich davon leben, und wenn doch, muss er sich mit Arbeit überhäufen. Es liegt die Vermutung nahe, dass Kulturgüter dadurch immer oberflächlicher und schematischer oder aber viel zu überschwänglich und im Konsens analysiert werden. Blogger haben in der Hinsicht die besseren Karten, weil sie ihre Freizeit und damit eher ihr Herzblut investieren und sich etwas mehr Zeit nehmen können als die professionellen Kollegen. Allerdings glaube ich, dass es sowohl Profis als auch „Amateure“ geben muss, damit die Varianz und die Breite der Meinungen erhalten bleibt. Die Frage wird nur sein, ob wir genug für den Erhalt unserer Kulturlandschaft tun, die uns doch eigentlich so am Herzen liegt.“
.
.
09 Wahr oder falsch: “Ich blogge vor allem, weil ich mich über Bücher austauschen will und im persönlichen Umfeld nicht genug Menschen habe, mit denen ich das könnte.”
aus.gelesen: „falsch. ich blogge, damit ich auch in zwei jahren noch weiß, was in dem buch stand und was mich interessierte daran. der austausch über bücher ist ein (sehr) angenehmer nebeneffekt, wobei diskussionen auf meinem blog eher selten sind.“
Dominik Nüse-Lorenz, Booknerds.de: „Es gibt in meinem direkten Umfeld Menschen, mit denen ich mich über Literatur austauschen kann – doch aufgeschrieben, ausformuliert und vielleicht auch etwas tiefergehender analysiert, ist der Blog für mich das ideale Medium.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Das war der ursprüngliche Grund, weshalb ich mit dem Bloggen angefangen habe. Oft werden Witze über die Nerds gemacht, die tage- und wochenlang nur mit Büchern im Bett liegen und alles um sich herum vergessen und mit mehr Charakteren als normalen Menschen befreundet sind. Hello, that’s me! So bin ich aufgewachsen und deswegen war das Internet mit all seinen Möglichkeiten der kurzfristigen Vernetzung eine wahre Entdeckung. Seit vielen Jahren lebe und arbeite ich in der Literaturbranche und inzwischen hat es sich umgedreht – ich kenne eigentlich kaum mehr Menschen, die nicht irgendwie etwas mit Büchern zu tun haben. Aber dieser Büchernerd, der bleibt man im Herzen trotzdem und so brauche ich regelmässig meine Wochenenden ohne menschliche Kontakte, tief vergraben in Texten!“
Nur Lesen ist schöner: „Falsch. Ich blogge, weil ich mich mit so vielen Menschen wie möglich über Bücher austauschen möchte. Ich möchte Leidenschaft entflammen und Bücherempfehlungen in die Welt streuen. Ich möchte Büchern, Autoren und Verlage zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen und mit ihnen die Liebe zur Literatur feiern. Da sind genügend Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich mich über Bücher austauschen kann. Ich lebe die Devise: Je mehr, umso besser.“
.
10 Mein persönlicher Geschmack und meine Prinzipien beim Lesen und Bewerten:
Der Buchbube: „Da Lesen für mich ausschließlich eine Freizeitbeschäftigung darstellt, verfolge ich nur ein einziges Prinzip (dieses aber sehr konsequent): Das, was ich lese, darf mich nicht langweilen.“
Sophie Weigand, Literaturen: „Ich schätze gute und besondere Sprache, die für mich irgendwo zwischen zu opulent (Thomas Wolfe!) und zu karg liegt. Ich mag’s poetisch, aber nicht pathetisch. Mir gefällt es, wenn Literatur mir entweder eine Welt zeigt, die ich nicht kenne oder die Welt, die ich zu kennen glaube, auf eine ganz neue Art (wie im Augenblick Clemens J. Setz!). Wenn sie aktuelle Themen aufgreift. Wenn sie das Allgemeine im Besonderen sichtbar macht und das Besondere im Allgemeinen. […] Je mehr man liest, desto besser kann man Bücher einschätzen, desto besser weiß man, welcher Verlag für was steht und in welche Richtung ein Buch geht. Ob es bloß Trends aufgreift, ein Aufguss von irgendwas anderem ist oder einen eigenen Ton entwickelt.“
A Million Pages: „Ich lese quer durch alle Genres, stelle aber prinzipiell nur die Bücher vor, die mich begeistert haben. Wenn mir ein Roman absolut nicht gefällt, halte ich es für vertane Zeit, ihn vorzustellen und aufzuzeigen, warum er mir nicht zusagt.“
Guido Graf: „Es muss weh tun.“
Lust auf Lesen, Jochen Kienbaum: „Ein Buch darf alles; nur nicht langweilen. Langeweile ist tödlich. Ein Roman kann anstrengend sein, schwierig, komplex, er darf mich fordern, ja sogar überfordern, aber ebenso gut auch einfach nur unterhaltsam sein. In jedem Fall muss er etwas anschlagen in meinem Inneren, etwas zum Klingen bringen, meine Gedanken auf Reisen schicken. Lesen bedeutet für mich, eintauchen zu können in fremde Welten, neue Lebens- und Denkbilder entdecken zu dürfen und meinen Horizont zu weiten. Ein besondere Vorliebe hege ich für die „dicken Dinger“, Bücher, in denen mich die Autoren auf mehr als tausend Seiten in hochkomplexe Geschichten verwickeln. Das können und dürfen auch sehr intellektuelle und abgehobene Bücher sein, solche von denen behauptet wird, sie seien eigentlich unlesbar, total verkopft oder ohne wirkliche Handlung. Nur langweilen, das dürfen sie mich nicht. Wenn ich über Bücher schreibe, auch über die komplexen und herausfordernden, dann möchte ich Neugier wecken, nicht belehren. Ich möchte auf ein Buch zeigen und sagen: Seht her das gibt es, mir gefällt das, versucht es auch einmal, egal ob sofort oder später. Bei der Bewertung von Literatur verlasse ich mich auf meine Intuition, meinen Geschmack und einige Werkzeuge, mit denen ich im Literaturstudium gelernt habe umzugehen.“
Muromez: „»Scheiße, warum bin ich schon am Ende angelangt?«, wenn sich dieser Gedanke festigt, ist ein Buch auf jeden Fall gelungen und kann was. Das muss nicht immer vorkommen, aber Bücher dürfen mich nicht quälen. Damit meine ich nicht, dass sie keinen Anspruch haben sollen, nein. Schwere Kost und komplex darf es ganz im Gegenteil sein, aber sie müssen mich anlächeln und gleichzeitig kein Muss verursachen. Ich muss mich mit dem Stoff anfreunden können, sprachlich, stilistisch, ästhetisch, Logik schätze ich dabei. Ein Buch muss mich weiterbringen, sonst hat es den Zweck verfehlt, und dann auch noch unterhalten. Ich muss entdecken können, worauf der Verfasser hinaus will, was er der Welt und mir als Empfänger senden möchte. Die Prinzipien können beim Lesen und Bewerten immer variieren. Ein Debüt hat z.B. einen Sonderstatus und darf vorsichtiger angefasst werden als ein hochgelobter und etablierter Verfasser.“
.
11 Wer liest mich? Habe ich eine Zielgruppe?
Zürcher Miszellen: „Gute Frage. Meine Wunschzielgruppe ist der NZZ-Feuilleton-Leser, die SZ-Feuilleton-Leserin, der/die das Internet entdeckt – und dann mich und meinen Blog. Diese Zielgruppe ist noch relativ klein, darum bin ich auf der Suche nach weiteren.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Laut der Liste der Facebook-Liker*innen sind 70% der Leser weiblich, wobei 50% unserer „Leserschaft“ Frauen zwischen 25 und 54 Jahre alt sind. Schade ist das irgendwie, da dies das Klischee der nicht lesenden Männer doch beinahe bis zum Platzen füttert. Ich will das nicht so ganz glauben. Ich denke generell, dass uns die lesen, die qualitativ gute Artikel lesen möchten und nicht viel von Mainstream halten.“
Reingelesen: „mmh das wüsste ich auch gern, vor allem, da sich so viele der Follower nicht äußern, kann ich das schlecht einschätzen.“.
.
.
12 Habe ich Vorbilder?
Schöne Seiten: „Uwe Wittstocks Die Büchersäufer mit der schönen Kolumne »Buch & Bar«. Oder die Wilmvorlesungen von Jan Wilm, wo monatlich je zwei Bücher gemeinsam besprochen werden – stets ein älteres im Paartanz mit einem neueren.“
Lust zu Lesen, Sonja Graus: „Jetzt oute ich mich mal: Ja, definitiv! Und zwar den Literaturblog Günter Keil. Mir sind viele Besprechungen schlichtweg zu lang, verraten zu viel, auch wenn sie ansonsten richtig, richtig gut sind und ich auch die Blogger dahinter sehr schätze. Wenn ich alle Namen der Protagonisten schon kenne, sämtliche Besonderheiten und die meisten Handlungsstränge – warum soll ich das Buch dann noch lesen? Günter Keil bringt es immer fertig, in ein paar Sätzen alles Wichtige unterzubringen, seine Meinung dazu durchschimmern zu lassen und noch Lust auf das Buch zu machen – oder eben auch nicht. Da denke ich dann immer „Yesss, so muss das!“.“
Denkzeiten: „Nein. Ich hatte nie Vorbilder oder Idole. Verehrte auch nie Schriftsteller oder Stars. Ich achte die Arbeit, das Können, finde die Menschen vielleicht spannend, aber: kein Vorbild.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Nein. Ich sammel mir im Alltag gute Eigenschaften von tollen Menschen, die mir nahe sind. Von Freundinnen, Geschäftskollegen, von Autoren oder beeindruckenden Dokumentationen. Ich versuche mir von jeder Begegnung und Erfahrung etwas Positives mitzunehmen und all dies fließt natürlich auch in meine Blogarbeit ein. Ich schätze viele Blogger- und Journalistenkollegen, habe aber keine festen Vorbilder.“
.
13 Welche Ratschläge würde ich meinem früheren Lese-Ich geben? Kann man lernen, Bücher besser auszusuchen, zu entdecken und zu genießen? Wie?
aus.gelesen: „offen bleiben. die fähigkeit behalten, sich überraschen zu lassen. Bereit sein, ein buch auch wieder ungelesen oder nur angelesen, wegzulegen.“
Literaturina: „Suche dir Leute, die einen ähnlichen Geschmack haben wie du. Vertraue auf ihre Wahrnehmung. Lass dich zu anderen Genre überreden. Lese Bücher, von denen du immer dachtest, du würdest sie nie anfassen. „
Schöne Seiten: „Früher, als Jugendliche und zu Beginn meines Studiums, habe ich Bücher wahllos gekauft und gelesen, ich hatte keine Kriterien und keine Orte, wo ich mich informieren konnte. Inzwischen wähle ich sehr sorgfältig aus, scanne zunächst die Verlagsvorschauen und warte dann die Kritiken ab. Zudem kaufe ich oft nicht sofort bei Erscheinen, sondern mit ein paar Monaten oder gar Jahren Abstand, vieles erledigt sich dadurch von selbst, weil ich das Interesse verloren habe.“
Flying Thoughts: „Kommt drauf an, wie alt mein früheres Lese-Ich ist. Dank des Internets ist es ja noch einfacher geworden, Bücher zu entdecken. Als wir noch keins hatten oder ich das nicht so genutzt habe, wie heute, bin ich in die Buchhandlung gegangen. Etwas, was ich zwar heute auch noch mache, aber wahrscheinlich sind die Besuche eher anders. Dann nehme ich mir ein englisches Buch in die Hand, sehe den Preis und denke mir „Bei Amazon ist das günstiger“.“
A Million Pages: „Mein früheres Lese-Ich hat im Studium streng nach Literaturkanon – Klassiker aller Epochen – gelesen. Zeit für spontane Lektüre hatte ich kaum. Heute suche ich nach für mich interessanten Büchern zwar oft im Internet, aber so richtig Spaß macht es mir, entweder in einer großen Buchhandlung oder auch in einem kleinen traditionellen Buchladen ganz entspannt nach Büchern zu stöbern. Ich glaube im übrigen nicht, dass man lernen kann, Bücher besser auszusuchen, da man sie zumeist nach Interessenlage bzw. nach sehr individuellen Kriterien (manchmal sogar nur nach dem Cover) auswählt. Auf Klappentexte verlasse ich mich nicht mehr allzu sehr, denn es ist mir schon oft passiert, dass ich nach Lektüre eines Romans dachte, dass der Verfasser des Klappentextes das Buch wohl nicht gelesen hat.“
.
14 “Verlage brauchen mich für PR. Sie brauchen mich mehr, als ich sie brauche” …oder “Toll! Autoren und Presseabteilungen suchen Kontakt und bieten mir Bücher an. Was für ein Glück!” Was überwiegt?
Schlaue Eule: „Eher das zweite. Ich finde es toll, Vertrauen geschenkt zu bekommen und Bücher zu lesen, auf die ich sonst vielleicht länger warten hätte müssen. Natürlich mache ich eine Art von PR, aber ich sage trotzdem noch meine ehrliche Meinung!“
Buchstäbliches: „Letzteres. Ich denke nicht, dass PR-Agenturen und Verlage gerade mich brauchen, es gibt genug andere Blogs mit viel größerer Reichweite. Umso mehr freue ich mich, wenn ich von Menschen angesprochen werde, die möchten, dass ich ihr Werk rezensiere, gibt es mir doch ein bisschen das Gefühl, dass es richtig ist, was ich mache.“
Sophie Weigand, Literaturen: „Ich freue mich immer über Verlagskontakte, bin aber auch nicht so blauäugig zu vergessen, dass das nicht aus reiner Mildtätigkeit geschieht, sondern weil entsprechende Interessen dahinterstehen. Dass diese Interessen da sind, sehe ich aber nicht als problematisch, so lange man sich ihrer bewusst ist. Auch Blogger haben schließlich Interessen: Kontakte, Vernetzung, Steigerung der Reichweite usw. Im besten Fall haben alle was davon und wissen darum. Nicht die Interessen sind schwierig, sondern womöglich unausgesprochene oder eingebildete Erwartungen, die damit einhergehen.“
Chris Popp: „Mir ging es viele Jahre finanziell dreckigst. Hätte ich nicht wenigstens Rezensionsexemplare in Buch-, Film- oder Musikform bekommen, die ich stets gewissenhaft und so professionell wie möglich rezensiert habe, wäre ich kulturell verkümmert – so war ich gerade in diesen schwierigen Jahren wenigstens ein wenig näher am Puls der Zeit. Dafür bin ich den Verlagen und Labels unendlich dankbar – ich versuche immer, möglichst viel zurückzugeben. Selbst negative Kritiken möchte ich stets so gut und fundiert wie möglich schreiben. Man stellt mir etwas zur Verfügung, und dies behandele ich immer mit Respekt. Heute verdiene ich endlich wieder ausreichend Geld, um mir Bücher und Musik auch kaufen zu können, und meine Sammlung ist ein guter Mix aus Rezensions- und Kaufexemplaren. Ein schlechtes Gewissen habe ich trotzdem nicht – denn es ist nach wie vor auch eine Form der Arbeit – wenngleich sie in Hobbyform betrieben wird.“
.
.
15 Was soll sich tun in meinem Blog und in meinem Leser-/Schreiber-Leben in den nächsten fünf Jahren:
Buchimpressionen: „Gute Frage. Da ich den Blog hobbymäßig betreibe und kein Berufsblogger bin, kann ich mich treiben lassen. Vom Zeitgeist, von persönlichen Vorlieben, vom Spieltrieb bei den technischen Möglichkeiten von WordPress, ich bin da sehr entspannt. Das ein oder andere unausgegorene Projekt geistert schon durch meinen Kopf (Stichwort „Indie“), momentan aber nichts Konkretes.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Hoffentlich so viel, dass ich es mir jetzt noch nicht einmal wünschen kann. Im letzten Jahrzehnt hat sich jährlich jeweils sehr viel getan und ich hätte vorher nie gewagt oder gedacht, dass es so kommt, wie es dann kam. Dies hat mich gelehrt, dass ich weniger wünsche und einfach mehr mache und auf mich vertraue. Ich kann hoffentlich weiterhin alle Literaturprojekte gestalten, die mir in den Kopf kommen und damit möglichst viele Leser erreichen. Ich werde in den kommenden fünf Jahren mein erstes Buch veröffentlichen und hoffentlich auch noch ein zweites und drittes. Ich werde eine große Lesereise machen und hauptberuflich einige Digitalprojekte rund ums Buch umsetzen. Ich werde weiterhin möglichst viele Netzwerke für Literatur entdecken und erobern. Ich werde in fünf Jahren hoffentlich immer noch hier schreiben und dann rückblickend sagen – das war verrückt, fabelhaft, großartig – weitermachen!“
.
Bei wieviel Prozent der Bücher, die ich gelesen habe, denke ich danach: Mist. Ich wünschte, ich hätte das nie gelesen…? Steigt oder fällt diese Prozentzahl, Jahr für Jahr? Warum?
Der Buchbube: „Bei Büchern niemals, bei Kommentaren in den Sozialen Netzwerken dagegen immer.“
Zürcher Miszellen: „Weniger als ein Prozent. Auch das Lesen von schlechten Büchern bringt einen weiter und naja: Es ist immer leichter, einen Verriss zu schreiben als ein fundiertes Lob, das wissen wir ja alle.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Uff. Zwei Prozent?!? Es gibt wirklich kaum Bücher, die ich wirklich für Zeitverschwendung gehalten habe. Geändert hat sich in all den Jahren nichts. Klar, es ist immer mal wieder ein Buch dabei, bei dem ich denke: „Der arme Baum…“, aber offenbar habe ich bei der Auswahl der Bücher, die ich lesen möchte, recht viel Glück. Oder habe andere Ansprüche. Oder andere Maßstäbe. Ich weiß es nicht wirklich.“
Nur Lesen ist schöner: „Es kommt wirklich selten vor, dass ich denke, „Ich wünschte, ich hätte das nie gelesen“, aber am Ende des Jahres sind es schätzungsweise 30 % der Bücher, deren Geschichten zwar nett waren, mich aber nicht vom Hocker gehauen haben.“
Muromez: „Die Prozentzahl sinkt durch eine gründlichere Vorbereitung. Warm machen! Anlesen, prüfen, vorfühlen, vergleichen! Mit einer voranschreitenden Kompetenz verfliegt der Mist danach. Das hat auch damit zu tun, dass man lernen muss, häufiger Nein zu sagen.“
.
Bonusfragen:
Ein Buch, das fast niemand mag – aber das ich liebe: [warum?]
Nur Lesen ist schöner: „„Tiere essen“ von Jonathan Safran Foer. Viele Menschen finden es eklig, die vielen erschreckenden Details aus der Lebensmittelindustrie zu erfahren, mich haben sie fasziniert und ungemein bereichert. Auch wenn ich immer noch gern Fleisch esse, lege ich heute viel mehr Wert auf die Herkunft des Tieres und eine artgerechte Haltung.“
Denkzeiten: „Alles von Thomas Mann… weil ich ihn halt mag.“
.
Ein Buch, das fast alle mögen – aber das mich wütend oder ratlos macht: [warum?]
Chris Popp, Booknerds.de: „Ohne zu zögern: „Der Fänger im Roggen“ von J. D. Salinger. Selten ein langweiligeres, nichtssagenderes, blöderes, deprimierenderes und überbewertetes, nervtötendes Buch gelesen. Und DAS soll zahllose Autoren inspiriert haben? An DAS soll Herrndorfs „tschick“ erinnern? Was soll „Der Fänger im Roggen“ denn bitteschön an sich haben, was so fasziniert? Was tun mir die Bäume leid…“
Guido Graf: „Francois Julien: Über die Wirksamkeit“
Buchkolumne, Karla Paul: „Davon gibt es sehr viele – angefangen mit der Schulpflichtlektüre „Die Blechtrommel“ von Günter Grass bis hin zu sämtlichen Romanen von David Safier oder Kerstin Gier, Richard David Precht … Alle paar Wochen stoße ich auf von Anderen so geliebte Bücher und finde selbst keinen Zugang. Deswegen sind die Bücher nicht schlecht, nur eben nicht für mich geschrieben. Viele Leser sollten das vielleicht weniger persönlich nehmen. Manchmal verstehe ich nicht, was sich der Autor dabei gedacht hat und ab und an bin ich ein bisschen angefressen, wenn er/sie es für mein Gefühl schlichtweg hätte besser schreiben können. Ich freue mich, wenn sich andere dafür begeistern und deswegen ist mir die Zeit auch zu kurz für Adjektive wie „wütend“ oder „ratlos“.“
.
Ein Buch, das ich bekannter gemacht habe:
Nur Lesen ist schöner: „„Lieblingsmomente“ von Adriana Popescu, weil es wie eine berauschende Fahrt mit der Gefühlsachterbahn ist und es mich so unfassbar glücklich gemacht hat. Meine Ausgabe ging allein durch sechs Hände, und hat sogar einen anderen Kontinent bereist. Jeder einzelne Leser hat es mir mit einem Lächeln zurückgegeben.“
Denkzeiten: „So wichtig bin ich nicht.“
.
Ein Buch, vor dem ich oft und gern warne:
Buchkolumne, Karla Paul: „Das gibt es nicht. Bücher, vor denen ich warnen würde, stehen meist zurecht auf dem Index. Der Rest hat eher etwas mit persönlichem Geschmack zu tun und da können die Leser ruhig selbst für sich entscheiden.“
.
.
Ein schlechtes Buch, das ich gut fand:
Guido Graf: „Pierre Clastres: Archäologie der Gewalt“
.
Ein gutes Buch, das ich schlecht fand:
Kurt Drawert: Schreiben
.
Ein Geheimtipp, der bisher in Blogs noch kaum besprochen wurde:
Schlaue Eule: „Auf dass uns vergeben werde“ von A.M. Homes.
Chris Popp, Booknerds.de: „Nilowsky“ von Torsten Schulz.
Guido Graf: Franz Josef Czernin – Beginnt ein Staubkorn sich zu drehn. Ornamente, Metamorphosen und andere Versuche. (Brueterich Press)
.
Ein Buch, das viel zu oft überall besprochen wurde:
Chris Popp: „„Weil ich Layken liebe“. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Aber jedes gottverdammte „Schnuffelpupsis Bücherrappelkiste“-Blog hat dieses Buch rezensiert, es fand so eine entsetztliche Hysterisierung statt… grauenvoll.“
Buchkolumne, Karla Paul: „„Girl on the train“ von Paula Hawkins. Nett aufgemachter Psychothriller, dennoch ein reiner Marketinghype – lest und besprecht lieber „Leona“ von Jenny Rogneby, das kann wesentlich mehr!“
.
Ein gutes Buch von/über jemandem/n, der ganz anders ist als ich selbst:
Denkzeiten: „Oh, ich denke, die meisten Bücher wurden von jemandem geschrieben, der ganz anders ist als ich, und sie handeln auch von jemandem, der anders ist als ich. Sonst könnte ich ja ständig mein eigenes Tagebuch lesen.“
.
Ein gutes Buch von/über jemandem/n, der ganz anders denkt als ich selbst:
Karla Paul: „Der österreichische Autor Thomas Glavinic beschreibt in seinen Romanen und vor allen Dingen in „Das größere Wunder“ eine Lebenseinstellung, eine Hoffnung, die ich nicht in mir trage. Ich kann sie nachvollziehen und wir reden oft darüber, ich versuche mich beim Lesen ranzutasten. Aber es bleibt mir stets ein bisschen fremd, ich komme nicht völlig ran, kann es nicht greifen. Trotzdem oder vielleicht deswegen hat mich kaum ein Roman so sehr beeindruckt.“
.
Ein Buch, von dessen Gestaltung/Cover/Design sich Verlage eine Scheibe abschneiden könnten:
Mokita: „Kein Buch, aber ein Designer, der öfter mal eingesetzt werden könnte: Levente Szabó. Er illustriert Klassiker neu, auf eine sehr tolle Weise.“
Denkzeiten: „Mir gefallen Die Bücher des Verlags Hermann Schmidt sehr gut. Zum Beispiel Felix Scheinbergers Mut zum Skizzenbuch.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Besonders (haptisch) schöne Bücher fertigt auch der Verlag Hermann Schmidt, wie z.B. „Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen“ von Frank Berzbach. Der Verlag beschäftigt sich auch als Grundthema mit Design und Typografie und zeigt die Expertise in jedem einzelnen Buch.“
.
Ein anderes Produkt, von dessen Gestaltung/Cover/Design ich Verlage eine Scheibe abschneiden könnten:
Mokita: „Erinnert ihr euch an das Design aller Sachen auf der Insel in der Serie „Lost“? Stellt euch einen Buchladen vor, wie sie heute so sind, und mittendrin ein Buch, welches so minimalistisch gestaltet ist.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Shape-CDs. War ein nicht allzu langlebiger Trend, aber ich finde so etwas witzig. Diskettenformat, Sägeblatt, an ein Scheunentor genageltes Huhn. Fände ich auch in Buchform cool, wenn es thematisch passt. Gibt es leider viel zu selten.“
Guido Graf: Arduino (www.arduino.cc)
.
.
Das netteste Presseteam / die schönste Erfahrung mit einem Verlag:
Sopie Weigand, Literaturen: „Die Teams von Hanser, Suhrkamp, Dumont, Diogenes, Kiepenheuer & Witsch und der Kirchner Kommunikation (vertritt z.B. Dörlemann) sind schon wirklich ein Kennenlernen wert.“
Chris Popp, Booknerds.de: „Bislang habe ich die Verlagsmenschen ja nur online kennen gelernt, aber von denen gibt es einige, die ich wunderbar finde. Katharina Waltermann von DuMont, Wiebke Maren Ratzsch und Ruth Geiger von Diogenes, Carina Gerner von Loewe, Thomas Vogt von Rapid Eye Movies, Anko Gniwotta von polyband Medien, die Leute von berlinieros, Frau Liebl von Random House, der wunderbar direckte Bertram Reinecke von Reinecke & Voß, die sind schon alle ziemlich klasse.“
Nur Lesen ist schöner: „Die Teams von Dumont, Magellan, arsEdition und Piper sind mir wirklich unfassbar sympathisch. arsEdition und Piper haben mir zwei wunderbare Bookup-Abende geschenkt, die mir sicherlich noch lange im Gedächtnis bleiben werden. Ich freu mich grundsätzlich aber über jede Begegnung mit Herzensmenschen.“
Mokita: „Vor fünf Jahren hatte ich mal die Freude, mit den Leuten vom Argon Verlag zu arbeiten, das war wirklich wunderbar. Und bis heute sind die Leute supernett, wenn ich sie treffe. Tatsächlich hatte ich aber bisher mit keinem Presseteam von Verlagen schlechte Erfahrungen gemacht. Immer auf Augenhöhe.“
.
Autor*innen, die tolle Inhalte auf Facebook und Twitter posten:
Chris Popp, Booknerds.de: „Benedict Wells und Oliver Uschmann, Berni Mayer ebenso. Ich denke, Du redest von Buchautoren, oder? Dann fällt mir noch Richard Lorenz ein. Und Ruprecht Frieling. Und Guido Rohm postet manchmal so herrlichen Unfug.“
Guido Graf: Jan Kuhlbrodt
Buchkolumne, Karla Paul: „Gibt es noch eine Definition von „tolle Inhalte“ dazu? Liebe Autoren, lasst Euch nichts einreden, wie und ob Ihr Social Media zu gestalten habt. Macht es so, wie es sich für Euch richtig anfühlt, geht den Leuten nicht mit zu viel Eigenwerbung auf die Nerven und beachtet die im Internet übliche Netiquette – das wird schon. Ernsthaft, jeder macht das anders, ganz nach Gefühl und Leben und Genre und ich freue mich, dass langsam so viele ihren Platz finden.“
.
mein(e) Lieblingskritiker*in/Journalist*in:
A Million Pages: „Meine Lieblingskritiker sind Marcel Reich-Ranicki und Hellmuth Karasek. Das werden sie auch immer bleiben, denn so kluge, streitbare und unterhaltsam-witzige literarische Experten wird es meines Erachtens nicht mehr geben. Auch wenn ich ihre Ansichten nicht immer nachvollziehen konnte, fand ich doch ihre Wortduelle stets großartig. Für mich müssen Literaturkritiker neben einem profunden literarischen Wissen immer auch Primadonna-Flair haben und sich selbst schon recht wichtig nehmen. Das macht schließlich ihren besonderen Reiz aus, denn Literaturkritiker sollten schon auch Provokateure und keine handzahmen Nacherzähler sein.“
Denkzeiten: „Marcel Reich-Ranicki und Helmut Karasek – das waren sie.“
Buchkolumne, Karla Paul: „Günter Keil, Richard Kämmerlings, Daniel Bröckerhoff, Sonja Peteranderl, Nils Minkmar, Julian Heck, Wolfgang Blau, Moritz von Uslar, Ulrike Klode, Jochen Wegner, Anita Zielina, Stefan Niggemeier, Kathrin Weßling …“
.
ein toller Text/Beitrag aus einem Verlagsblog:
Guido Graf: http://www.logbuch-suhrkamp.de/jacob-teich/der-open-mike-rap-battle-der-literatur
Buchkolumne, Karla Paul: „Bitte abonnieren Sie an dieser Stelle sofort die beiden Blogs hundertvierzehn (Fischer Verlag) und Resonanzboden (Ullstein Verlag) – herzlichen Dank. Sehr schön und redaktionell toll aufbereitete Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Verlagen als auch der sonstigen Buchbranche, spannende Kooperationen und Gastautoren,“
.
ein Lieblings-Blogbeitrag (kein ganzer Blog):
Buchkolumne, Karla Paul: „Ich habe in meinem Herzen ein kleine, dunkle Ecke für Verrisse und dazu gehört der sehr unterhaltsame Rant von meinem Freund Tilman Winterling auf 54books gegen die Büchergilde bzw. deren aktuelles Design.“
.
ein Blogbeitrag von mir selbst, auf den ich stolz bin:
Guido Graf: http://grafguido.de/access-to-awesome-30-thesen-zur-zukunft-der-literaturvermittlung/
Buchkolumne, Karla Paul: „Auf einen Blogbeitrag kann ich schwer stolz sein, aber vielleicht auf die Aktion „Blogger für Flüchtlinge“ aus diesem Jahr, die ich gemeinsam mit anderen Bloggern startete – dies findet hoffentlich bei mir selbst und Anderen Nachahmung.“
.
mein erfolgreichster Text/Beitrag:
Lust zu Lesen, Sonja Graus: „Bisher das Interview mit der Übersetzerin Gabriele Haefs. Die Zugriffszahlen und das Tempo des Teilens haben mich völlig überrascht.“
.
ein Text/Beitrag von mir, der wenig Beachtung fand, aber mehr Beachtung verdient:
Chris Popp, Booknerds.de: „Kann ich pauschal gar nicht sagen. Bei vielen Artikeln denke ich mir: Mensch, eigentlich müsste das die Leute doch interessieren! Aber die Onlineleserschaft ist unberechenbar.“
.
eine Frage, die diesem Fragebogen fehlt:
Mokita: „Zweifelst du an deinem Tun? Und wann sind die Momente, an denen du mit dem Bloggen aufhören willst?“
Guido Graf: „Wann fängst Du endlich an?“
Buchkolumne, Karla Paul: „Was macht Literatur mit Dir, mit Deinem Leben?“
.
.
und, zum Vervollständigen:
“Das neue literarische Quartett…”
Chris Popp, Booknerds.de: „…interessiert mich genau so wenig wie das alte. Ranickis Empörung auf Knopfdruck fand ich eher lachhaft als unterhaltsam. Aber auch so gibt mir das Format nicht viel. „Was liest du?“ mit Jürgen von der Lippe fand ich da irgendwie schöner und unterhaltsamer. Und nach den Meinungen zur ersten Aufgabe habe ich wohl auch nichts verpasst.“
Laurent Piechaczek, Booknerds.de: „Warum muss Maxim Biller eigentlich überall seinen Senf hinzugeben?“
Denkzeiten: „Ich mag keine Remakes und Kopien. Wenn eine Literatursendung, dann eine neue. Alles andere wird eh zu nichts führen.“
.
“Auf der Buchmesse…”
Buchkolumne, Karla Paul: „… bin ich zuhause.“
.
“Ich bin sehr überraschend und unerwartet auf ein gutes Buch gestoßen. Und zwar…”
Buchstäbliches: „…auf mehrere Bücher, von Self-Publishern geschrieben.“
Flying Thoughts: „„The Eyre Affair“ von Jasper Fforde ist so ein Buch. Ebenso „The Invisible Library“ von Genevieve Colman. Beides Genre, die ich eigentlich fast gar nicht lese. Aber es hat sich gelohnt.“
Buchkolumne, Karla Paul: „… „The Art of Asking“ von Amanda Palmer aus dem Eichborn Verlag. Die Musikerin, Künstlerin und Frau von Fantasybestsellerautor Neil Gaiman beschreibt darin ihren Lebensweg mit der Musik und wie sie gelernt hat, andere Menschen in ihr Leben zu lassen und sie um Hilfe zu bitten, wie sie die mit 1,2 Millionen Dollar bisher erfolgreichste Kickstarter-Kampagne initiierte und die sozialen Netzwerke für sich nutzt, sie lebt. Ich hielt es erst für ein esoterisch angehauchtes Selbsthilfebuch – stattdessen stieß ich auf eine äußerst spannende Biografie mit der besten Nutzungsanleitung für soziale Medien und gemeinsames Miteinander on- als auch offline.“
.
weitere Buchtipps aus den bisher 22 verlinkten Blogposts:
.
Schöne Seiten: David Grossmans „Stichwort: Liebe“, Jonathan Safran Foers „Alles ist erleuchtet“, Vladimir Nabokovs „Lolita“, Gabriel García Márquez’ „Hundert Jahre Einsamkeit“, Salman Rushdies „Mitternachtskinder“. Hard-boiled Krimis und Noirs, der Liebeskind Verlag hat in dieser Hinsicht einige aufregende Bücher im Programm. Nino Haratischwilis Das achte Leben. Deutscher Meister von Stephanie Bart.“
Literaturen: Clemens J. Setz, „Sieben Minuten nach Mitternacht“ von Siobhan Dowd und Patrick Ness. „Gotthard“ von Zora del Buono. „Die Verschwundenen“ von Wolfgang Popp. „Der amerikanische Architekt“ von Amy Waldman. „Limonow“ von Emmanuel Carrère. „Deutschland überall“ von Manuel Möglich. „Lust und Laster“ von Evelyn Waugh. „Lucky Newman“ von Carl Nixon. Wenn es nicht sowieso ein tolles Buch wäre, hätte ich es wegen des Covers gekauft. Sechs Personen suchen einen Autor” von Luigi Pirandello.
A Million Pages: Henry James: Porträt einer jungen Dame. Helmut Berger: Ich. Die stille Frau von A. S. A. Harrison. Erika Robuck. The Curiosity vom amerikanischen Autor Stephen P. Kiernan: Ich kann nicht nachvollziehen, warum dieses außergewöhnliche Buch noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, denn es würde meines Erachtens mit Sicherheit auch hier die Bestsellerlisten stürmen.
Der Buchbube: “Der Fliegenfänger” von Willy Russell.
Mokita: Das Gefängnis der Freiheit von Michael Ende.
Chris Popp: „Nilowsky“ von Thorsten Schulz, „Amerika-Plakate“ von Richard Lorenz, die David Foster Wallace-Biographie „Jede Liebesgeschichte ist eine Geistergeschichte“ von D. T. Max, Juha Vuorinens „Göttlich versumpft“, Christoph Poschenrieder – Die Welt ist im Kopf; Wolfgang Welt – Fischsuppe; Georges Perec – Das Leben Gebrauchsanweisung; Lothar Baier – Jahresfrist usw., usw…
Guido Graf: Georges Didi-Hubermann: Das Nachleben der Bilder, Helen Hester: Beyond Explicit: Pornography and the Displacement of Sex, Ernst Gombrich: über Schatten, Steffen Popps Beuys-Buch
Buchkolumne, Karla Paul: Scarlett Thomas: „Troposphere“, „Was wir fürchten“ von Jürgen Bauer, die Romane der irischen Chick-Lit-Autorin Marian Keyes, JJ Abrams: „Das Schiff des Theseus“, „Shakespeare and Company“ aus dem Suhrkamp Verlag.
Nur Lesen ist schöner: „„Wir sind die Könige von Colorado“ von David E. Hilton. “Schloss aus Glas” von Jeannette Walls. „Zwiterschende Fische“ von Andreas Séché. „Im Schatten des Vogels“ von Kristin Steinsdóttir. „Das hat alles nichts mit mir zu tun“ von Monica Sabolo. „Wir haben Raketen geangelt“ von Karen Köhler. „Liebten wir” von Nina Blazon. Es war eine reine Bauchentscheidung, das Buch zu kaufen, weil mich das Cover so ansprach. Hinter dem Buchdeckel habe ich eine weitaus facettenreichere Geschichte entdeckt, als ich anfangs vermutet habe.