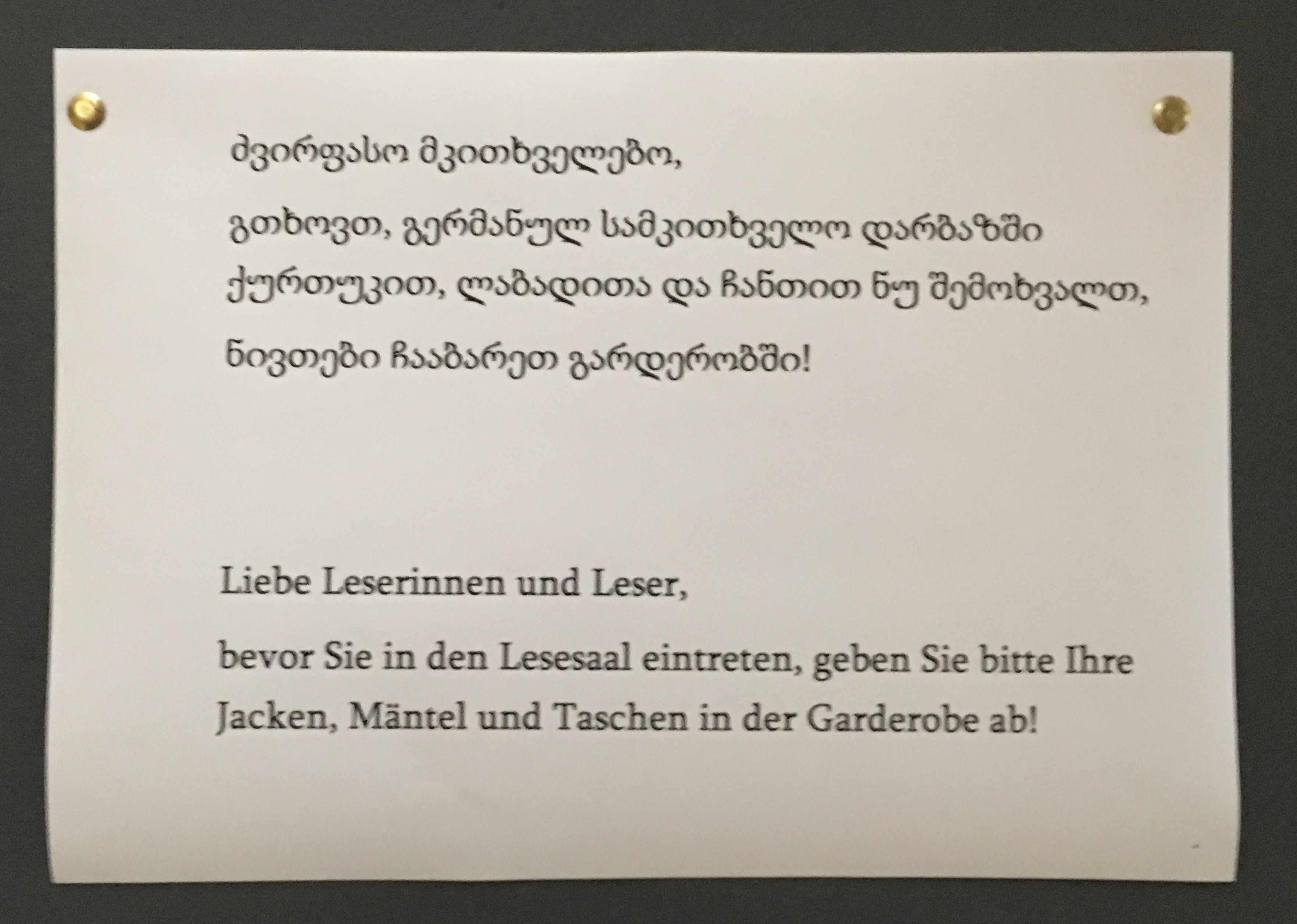Ulf Poschardt ist für die deutsche Social-Media-Landschaft das Paradigma des unangreifbaren Trolls. Es gibt viele, die im Netz eine eitle und lächerliche Figur abgeben, es gibt viele mit einer Biografie voller krachender Misserfolge, die im Medienbetrieb dennoch unaufhaltsam aufsteigen, es gibt viele Mächtige und Reiche, die kompromisslos öffentlich Partei für die Reichen und Mächtigen ergreifen, aber niemand vereint dies alles wie »Drulf«.

Selbstverständlich macht es das nicht zu einem unmoralischen Akt, seine Bücher zu lesen. Im Gegenteil ist es eine horizonterweiternde Erfahrung, sich tief in sein Denken hineinzubegeben, gerade wenn man ihn vor allem als Verfasser grammatikalisch mangelhafter Einzeiler kennt, in denen das Wort »Moral« ausschließlich pejorativ gebraucht wird.
Man muss davon ausgehen, dass Poschardt, der einer der paar mächtigsten Medienmenschen in Deutschland ist und seine Macht doch stets konsequent herunterspielt, sein Gehabe durch sein intellektuelles Gewicht legitimiert sieht. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich habe Mündig (Klett-Cotta, 271 S.) gelesen, um die Rück- bzw. Innenseite des Twitterclowns Poschardt kennenzulernen, und ich habe es nicht bereut. (Am Rande bemerkenswert: Der Rücken des – sehr schönen – Buchs ist so gestaltet, dass man nach gängiger Konvention davon ausgehen müsste, hier habe jemand namens Mündig eine Biographie über Ulf Poschardt geschrieben. Honi soit qui mal y pense.)
Der Band ist eine lose Sammlung teils bereits veröffentlichter Texte, die Poschardt an die kantische Tradition des »Sapere aude« angeschlossen sehen will. In den schlaglichtartigen Betrachtungen auf locker bedruckten Seiten geht es der Reihe nach um Intellektuelle, Pädagogik, Demokratie, Konsum, Mediennutzung, Digitalisierung, Unternehmertum, Autorennen, Liberalismus, Partykultur, Linke, Männer, Frauen, Künstler*innen und Leben insgesamt. An diesen Themen möchte Poschardt aufzeigen, was Mündigkeit bedeutet, immer im Gegensatz zu einem angeblichen Zeitgeist, in dem (seit irgendwann zwischen 1980 und 1990) freiwillige Unmündigkeit gesellschaftlicher Trend sein soll.
Das Kapitel über Motorsport (130–141), das weitgehend vom Tod Ayrton Sennas 1994 handelt, darf dabei als Schlüssel gelten:
Natürlich ist es gut, dass […] niemand mehr tödlich verunglückt, aber der Formel 1 wurde damit ihre existenzielle Beglaubigung genommen, es mit der Fortschrittserzählung radikal ernst zu meinen. (138)
Poschardt, der sich gerne auf Heidegger bezieht und Senna fast zur Christusfigur hochstilisiert, sieht Mündigkeit in ihrer höchsten Ausprägung dort, wo man »in der Gefahr nicht umkommt, sondern in ihr das Rettende erkennt« (140). Sie ist für ihn letztlich eine gelebte Gesinnung: eine praktische Disposition zur Veränderungsbereitschaft, zur Offenheit, zum existenziellen Risiko, zur Erkenntnis- und Erlebnisfreude. Verschiedene Genusspraxen wie etwa exzessives Feiern und spontaner Sex (158–168), Skaten (143 ff.) oder das Wohnen in Lofts (93–97) gelten hierfür als paradigmatisch, vor allem aber das schnelle und riskante, aber souveräne Autofahren. Beständiges Raunen, das unverantwortliche Fahren als Inbegriff der Freiheit könnte im Zuge der angeblichen allgemeinen Bewegung hin zur Unmündigkeit verboten werden, ist ein Leitmotiv des Buchs und ergänzt sich gut mit den Autometaphern (v.a. »Drift«), die ebenso durchgehend die Sprache prägen.
Die Trennwand zum voluntaristischen Wahnsinn ist da natürlich dünn. Der Mündige, wie Poschardt ihn (und sich in ihm) imaginiert, ist jemand, der nicht nur kein idealer Verkehrsteilnehmer sein will (12), sondern der »aus Lust mehr riskieren« will als andere, »Panikmacher und Angsthasen« (18) verachtet und sich in der Verweigerung um der Verweigerung willen gefällt: »Ich glaube nicht, dass es eine Angst davor geben sollte, etwas nicht zu machen, von dem man glaubt, man müsse es machen« (17f.; nebenbei bemerkt kein Ruhmesblatt für das Lektorat bei Klett-Cotta, dass ein so ungeschlachter Satz durchgekommen ist). Die para-epikureischen Vorüberlegungen dazu, dass man sich aus Gründen der Genussoptimierung und »Abweichungsverstärkung« halt auch mal zurückhalten müsse, statt immer nur aufs Gas zu drücken (18), wirken wie eine nachträgliche verlegene Ergänzung, die zudem von Poschardts enthusiastischer Übernahme der Parole »Never lift«, die gerade dazu auffordert, niemals den Fuß vom Gas zu nehmen, am Schluss wieder konterkariert wird (254).
Im Deutschen gibt es kein Wort für »contrarianism«, was schade ist, weil dies einen wichtigen Zug von Poschardts Denken beschreibt. Er ist im Zweifel für und gegen alles. Er bringt Adorno mit der Inneren Führung der Bundeswehr zusammen (66ff.), lobt und kritisiert das klassische Preußentum, weil es irgendwie sowohl zur Mündig- als auch zur Unmündigmachung des Bürgers tendiert (45ff./253), oder teilt flammend gegen Bildungsungerechtigkeit aus, um genau an dem Punkt, wo er tatsächlich etwas über die traurige Realität des archaischen gliedrigen Schulsystems sagen müsste, zu einem Angriff auf die hessische Bildungspolitik nach 1970 überzugehen (57). Rassistische Antidemokrat*innen wie Ayn Rand und Peter Thiel sind für Poschardt ebenso positive intellektuelle Bezugspunkte wie der Antisemit Jean-Luc Godard, sogar noch nationalsozialistischer Black Metal hat seine kulturelle Berechtigung (231f.): »Schönheit ist wichtiger als die Moral, wenn es der freie Weg sein soll. Und alles kann schön sein« (255).
Das Stakkato von Popkulturphänomenen, auf die reflektiert wird, wirkt allerdings über weite Strecken merkwürdig angejahrt. Poschardt fällt schon online damit auf, deutsche Mentalitäten der Gegenwart hartnäckig an Kulturprodukten zu messen, von denen schon Mittdreißiger heute wenig bis nichts mehr wissen (z.B. die ZDF-Serie Diese Drombuschs). Auch in Mündig orientiert er sich gern an Phänomenen der 80er- und 90er-Jahre: Kirchentagsrhetorik, Holger Börner (178), Guido Westerwelle, Rennfahrer der Zeit vor Michael Schumacher, Marxistische Gruppe (174), Unser Lehrer Doktor Specht (58), Sex and the City, immer wieder Popmusik der frühen 80er. Bei aller zwangscoolen Aufgedrehtheit haben Poschardts Überlegungen daher etwas merkwürdig Antiquiertes (er selbst würde vielleicht das Wort »überholt« bevorzugen). Die Passagen, die sich dann geballt an Fernsehserien von 2011 oder Hip-Hop und Autowerbung von 2018 abarbeiten, wirken bemüht und haben etwas von Sichbeweisenwollen eines Gealterten.
Das Ziel der ganzen Übung der »Mündigwerdung« ist letztlich eine Form der Lebensführung, zu deren Beschreibung Poschardt im Schlusskapitel auf vier Seiten nicht bloß Kant, sondern gleich auch noch Xenophanes, Sokrates, Descartes, Wittgenstein, Camus, Popper, Jeffrey Young und Ignatius von Loyola mobilisiert (245–248). Hier wird keine Abhandlung geschrieben, hier wird »gedriftet«, zwischen Feuilletonismus und Unternehmensberater-Lingo (»VUCA-Welt«, 250). Es ist aber relativ einfach, auf den Punkt zu bringen, was den hier gefeierten und geforderten Lebensstil ausmacht: Er bietet Individuen die Möglichkeit, an eigenständig dosierten Unvernunfterfahrungen in radikal subjektiver Weise zu wachsen. Dabei gibt es prima facie keine moralischen oder ästhetischen Grenzen, alles ist erst einmal erlaubt oder kann zumindest ausnahmsweise einmal ausprobiert werden, sofern das in einem Rahmen von bedeutsamer Selbsterfahrung geschieht. Dies verteidigt Poschardt gegen einen imaginierten, protestantisch-grünen Megatrend hin zum Sichbeugen ins moralische Diktat, in dem die Subjekte die Möglichkeit, sich frei für die Vernunft zu entscheiden, mit der Kenntnis anderer Optionen aufgeben, also in eine selbstverschuldete spießige Unmündigkeit marschieren (und dafür das Auto, »das dynamische Etui des Einzelnen und seiner Freunde und Familie« stehen lassen, 13).
Dieser Blick auf die Conditio humana ist natürlich nur möglich, solange es nicht irgendwelche echten existenziellen Bedrohungen gibt, die von der Menschheit gemeinschaftlich bewältigt werden müssen. Das Bewusstsein bestimmt hier das Sein. Die Notwendigkeit etwa, die Zivilisation als solche je wieder in einem kollektiven Existenzkampf verteidigen zu müssen, wie es im Zweiten Weltkrieg geschehen ist, kommt nicht vor. Das verwundert, da Poschardt doch die geistigen Wurzeln der Nachkriegs-BRD so wichtig scheinen und er sich immer wieder kompromisslos gegen die AfD stellt. Es erklärt aber, warum er keine Probleme damit hat, immer wieder mit hart rechten Intellektuellen zu kokettieren. Dabei ist er selbst alles andere als »rechts«, sondern tut über lange Strecken seine Bewunderung für ausgewählte Ausschnitte des linken theoretischen Erbes sowie insbesondere den Linksliberalismus der Bundesrepublik vor 1982 kund und plädiert für zahlreiche klassisch sozialdemokratische Politikziele.
Vor allem aber ist es für Poschardt denknotwendig, dass es keine tatsächliche existenzielle ökologische Bedrohung gibt, weil dies seine Wertehierarchie umstieße. Windkraftanlagen (die immerhin mehr als ein Fünftel des deutschen Stromverbrauchs decken) sind für ihn nur »großgewordene[] Kindergartenpropeller[]« (13) und die vermutlich unabwendbare Unbewohnbarwerdung der Erde durch die Klimakatastrophe taucht bei Poschardt nur im Konditional und als Zweitmotivation ohnehin wünschenswerter Veränderungen im Konsumverhalten auf. Als lebensbedrohliche Realität ist sie für ihn lediglich ein Popanz der Grünen, eine »Angstreligion« (251).
– Wenig ist so alt wie das politische Buch von vorletztem Monat. Poschardts Buch wurde sichtlich vor der Pandemie geschrieben, und etwa die Behauptung, in jeder Krise würde »als Erstes die Freiheit des Einzelnen problematisiert, um dann im nächsten Schritt die Entmündigung als wohlwollende Einschränkung der Freiheit vorzubereiten« (16) wirkt heute, da an jeder Ecke, ob nun von Spitzenpolitikern, reichen Zeitungsherausgebern oder kleinen Facebooknazis, gefordert wird, Einschränkungen der individuellen Freiheit aufzuheben, und wenn es noch so viele Todesopfer fordert, noch antiquierter und formelhafter als ohnehin schon.
Die zentrale Prämisse ist der schon mehrfach genannte angebliche regressive gesellschaftliche Zug hin zur freiwilligen Unmündigkeit, zur Staatsgläubigkeit und zum Paternalismus. Woher Poschardt diesen Befund genau nimmt, ist unklar; er wird nie hergeleitet, sondern von der ersten bis zur letzten Zeile vorausgesetzt. Möglicherweise hat er vor allem mit seinen persönlichen Geschmacksurteilen zu tun; böse gesagt: Wer als Werkzeug nur ein Gaspedal hat, sieht in jedem Problem ein Tempolimit. Ich halte Poschardts optimistische Prämissen ansonsten für genauso falsch wie seine gesellschaftspolitische Voraussetzung. Die westliche Zivilisation und die Menschheit als ganze sind beide akut bedroht und große Kraftanstrengungen zu ihrem Erhalt sind notwendig. Knappe Ressourcen, zuvörderst Zeit und das winzige verbliebene Klimagasbudget, müssen notwendigerweise prioritär für diese Anstrengungen eingesetzt werden.
Selbstverständlich stimmt es, dass eine Welt ohne Möglichkeiten zur individuellen Lebensgestaltung auch nicht mehr lebenswert wäre, aber Poschardts Implikation, dass bereits eine Welt, in der es nicht mehr möglich ist, aus freier Entscheidung mit einem benzingetriebenen Auto lebensgefährlich schnell zu fahren, so wenig lebenswert wäre, dass sie auch genauso gut gleich untergehen kann, ist nicht nur spleenig, sondern mindestens ebenso nihilistisch wie die transgressiven Kulturprodukte, die dieses Buch feiert. Die wenigen Augenblicke, die der Menschheit welthistorisch gesehen noch bleiben, sind sicherlich besser darauf verwendet, ihr Ende abzuwenden oder es (was wahrscheinlicher ist) zumindest etwas hinauszuschieben und palliativ auszugestalten, als zur persönlichen Sinnstiftung von 911er-Fahrern beizutragen.
Mündig ist ein Buch, das Fahrlässigkeit predigt. Das ändert jedoch nichts daran, dass es immerhin diskutabel ist, also: einen Beitrag darstellt und nicht etwa desinformiert. Die Ungenauigkeiten, die man darin findet (so impliziert Poschardt, die Idee der Presse als »vierter Gewalt«, die zu Balzac, Carlyle und Burke zurückreicht, sei irgendwie spezifisch für die Nachkriegsbundesrepublik, 102; seine Falschschreibung von Dirk Roßmanns Namen lässt erkennen, dass Poschardt weitgehend ohne Recherche aus dem Kopf schreibt, 123), sind im Vergleich zu anderen politischen Büchern, die ich in den letzten Jahren in Händen gehalten habe, harmlos; ich habe Poschardt insgesamt mit erheblich mehr Gewinn gelesen als etwa Richard David Precht oder Thea Dorn. Dass er einer essayistischen Tradition angehört, in der sich an Phänomenen abgearbeitet wird, denen man Allgemeinheit und Wirkmacht einfach unterstellt, ohne sie je mehr als anekdotisch zu belegen, wirkt heute, da man selbst zu komplexen Trendfragen mit drei, vier einfachen Google-Eingaben wenigstens empirische Anhaltspunkte gewinnen kann, veralteter denn je. Aber ihm als Einzelperson kann man nicht vorwerfen, dass er das alte Spiel weiterspielt.
Zum Schluss verdient die sprachliche Manieriertheit des Buchs noch ein paar Sätze. Der vielfach karikierte Poschardt-Stil enttäuscht auch im Buchformat nicht. Der unbedingte Wunsch, auf Teufel komm raus allem größtes Gewicht zu geben, wenn beispielsweise aus dem deutschen Finanzminister mal eben ein »Schatzkanzler« wird (151), paart sich mit dem unwiderstehlichen Willen zur überraschenden Phrase und bringt Blüten hervor, die sich selbst eine Poschardt-Parodie der TITANIC nicht trauen würde (vgl. Anhang). Poschardts »Drift«, im ganzen Buch die Leitmetapher für »mündiges« Denken und Leben, geschieht ganz buchstäblich stets kurz vor dem Abriss seiner eigenen intellektuellen Bodenhaftung.
Was aber vielleicht das Allerwichtigste ist: Das alles ist komisch, aber es ist nicht unfreiwillig komisch. Auch wenn Poschardt als Person im realen Leben ungeheuer steif und linkisch sein kann, weiß er doch zumindest als Schriftsteller um das Groteske seiner Pose, ja forciert es sogar, weil für ihn »die Existenz eben auch ein Karneval ist, das Denken eine Clownerie, das Schreiben ein Gezappel« (33). Da kann dann auch das Lehrer- und Predigerkind Poschardt über andere »Lehrer- und Pfarrerskinder[]« herziehen (106) – denn:
Darum geht es: lachend zur Witzfigur zu werden. (196)
qed 🤡
Anhang: Die zehn größten Quatschsätze in Mündig
- »Der Türsteher vergibt die Mündigkeitshouseaufgaben.« (161)
- »In rhizomatisch geführten Betrieben sind die unterschiedlichen Tentakel eben auch Wahrnehmungsassistenten.« (125)
- »Heideggers Dystopie von der Herrschaft des Gestells ist als eine Art infames Entlastungs-Spa mächtig geworden.« (12)
- »[Jürgen] Klopp weiß, dass er nur mehr eine Anti-Aging-Cremetube entfernt ist von seinem kulturellen Schatten.« (196)
- »Godard hat den Linksradikalismus als Bi-Turbo für seine Überlegungen stets missbraucht.« (37)
- »Je feiner es [das Fahrwerk des mündigen Intellektuellen] justiert ist, umso besser die Straßenlage in den Debatten und die Traktion aus den Argumentationskurven hinaus.« (32)
- »Im Nachtleben wären mehr Kontrollen tödlich, zumindest für den freien Geist des Nachtlebens, jene Mischung aus Balz, Bordeaux und Petting.« (160)
- »Das belegen Jay-Z und Dirk Rossmann, Dr. Dre und Nicola Leibinger.« (123)
- »Teile des Buches bestehen aus einer Consommé von Texten, die in der ›WELT-Gruppe‹ erschienen sind.« (4)
- »Pop ist jetzt staatstragend, geht ein und aus im Weißen Haus (reimt sich)« (223).
Beitragsbild (unverändert): Lothar Spurzem (CC BY-SA 2.0 de)










 Der Autor erklärte uns, dass in Ostdeutschland viele Menschen noch auf dem Land wohnten, dass es wichtig sei, sich das zu vergegenwärtigen; an einem Trafohäuschen ein Graffito »ENERGIEZONE #judendynamo«. Irgendwo im Bus redeten ein Blogger und ein Richtigjournalist so über Ostdeutschland, als wäre es ein fremdes Land. 28 Jahre nach der Wende.
Der Autor erklärte uns, dass in Ostdeutschland viele Menschen noch auf dem Land wohnten, dass es wichtig sei, sich das zu vergegenwärtigen; an einem Trafohäuschen ein Graffito »ENERGIEZONE #judendynamo«. Irgendwo im Bus redeten ein Blogger und ein Richtigjournalist so über Ostdeutschland, als wäre es ein fremdes Land. 28 Jahre nach der Wende.