Gestatten, Kästner!

Eine Erich Kästner-Ausstellung des Literaturhauses München vom 25.9. bis 14.2.2016
»›Gestatten, Kästner‹, sagt der Spiegelmensch. Mein rechtes Auge lächelt aus seiner linken Augenhöhle.«
(»Briefe an mich selber«)
Ob Lyriker, Dramatiker, Romancier, Journalist, Kritiker oder Kinderbuchautor – jeder Leser schätzt eine andere Seite des Schriftstellers Erich Kästner. Seine Beliebtheit zeigt sich an den anhaltend hohen Verkaufszahlen seiner Kinderbücher oder dem großen Publikumserfolg der Urfassung des »Fabian«, die Ende 2013 unter dem Titel »Der Gang vor die Hunde« erschien.
Das Literaturhaus München zeigt 2015 die erste große Ausstellung, seitdem der Nachlass in Marbach vollständig erschlossen zur Verfügung steht und nicht zuletzt im Bereich der Fotosammlung beträchtlich gewachsen ist. In unveröffentlichten Manuskripten und weitgehend unbekannten Fragmenten lassen sich neue Facetten Kästners finden. Sie rücken den Autor stärker in den Kontext der Moderne, zeigen ihn aber auch zerrissener in den historischen Wogen, als bisher vermutet. In den wichtigen Stationen seines Lebens, den Großstädten Dresden, Leipzig, Berlin und München, zeigt sich neben dem multimedial agierenden Erfolgsautor ein Zweifler, der versucht, sich den Unsicherheiten der Moderne schreibend zu stellen.
Als Erich Kästner 1899 in Dresden geboren wurde, wünschte sich seine Mutter für ihn nichts sehnlicher als den gesellschaftlichen Aufstieg. Eine Hoffnung, die der Sohn nach Kräften zu erfüllen suchte – zunächst mit dem Besuch des Lehrerseminars, ab Beginn der 20er Jahre dann mit einer Karriere als Redakteur und Schriftsteller in Leipzig.
Erich Kästner begann schon früh mit verschiedenen schriftstellerischen Identitäten zu experimentieren. Bereits unter seinen ersten journalistischen Arbeiten aus den frühen 1920er Jahren finden sich so, ganz nach dem Vorbild Tucholskys, auch unter Pseudonym verfasste Artikel.
Nach diesen ersten spielerischen Versuchen des Identitätswechsels begann Kästner, der ab 1927 in Berlin lebte, sich gezielt selbst in den Medien zu inszenieren. Frühe Radio- und Filmaufzeichnungen verdeutlichen, wie geschickt Kästner Ton und Bild nutzte, um den Erfolg von »Emil und die Detektive« voranzutreiben. Auch seine Lyrik vermarktete er auf innovativen Wegen. Anhand der Kästnerschen »Versfabrik« lässt sich zeigen, wie erfolgreich er mit seiner Sekretärin den Versand seiner Gedichte über Jahrzehnte hinweg organisierte.
»Unser Gast, meine Damen und Herren, ist gar kein Schöngeist…«
(»Kästner über Kästner«)
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das, was als Spiel mit der eigenen Identität begonnen hatte, Teil der Überlebensstrategie. Der »verbrannte Autor« Kästner durfte ab 1933 nicht mehr unter seinem Namen veröffentlichen und musste auf die Pseudonyme seiner Freunde ausweichen.
An seinen quasi-autobiografischen »Briefen an mich selber« oder den Romanprojekten »Die Doppelgänger« und »Der Zauberlehrling« wird eine zunehmende Angst vor dem Selbstverlust deutlich. Die Stoffsammlungen und Fragmente machen erfahrbar, wie Kästner immer wieder an seinen Stoffen arbeitete, ohne dabei aber zu einem Ende zu gelangen. Gleichzeitig lassen sie erahnen, welch großartige Texte unvollendet blieben.
Zu den geplanten Projekten zählte auch der von ihm öffentlich angekündigte »Große Roman« über den Nationalsozialismus. Tagebuchaufzeichnungen sollten die Grundlage für diesen Roman bilden – der Schriftsteller, der mitunter als Chronist in Deutschland geblieben war, scheiterte jedoch an seinem Vorhaben. Stattdessen arbeitete Kästner mit all seiner Kraft als Feuilletonist, Kabarettist und Autor für die Jugend am Wiederaufbau mit.
Ende der 1950er Jahre war Erich Kästner ein Autor von Weltruhm und galt in München als eine bedeutende Persönlichkeit des literarischen Lebens. Die schriftstellerische Virtuosität der frühen Berliner Jahre erreichte er jedoch nicht mehr. Neben der Veröffentlichung seiner gesammelten Werke und unterschiedlicher Anthologien fiel es Kästner schwer, neue Romane zu schreiben. In seinen sorgfältig konzipierten Kindheitserinnerungen »Als ich ein kleiner Junge war« literarisierte er jedoch noch einmal seine eigene Geschichte.
*
Eine Ausstellung des Literaturhauses München
Kuratorium:
Leitung: Reinhard G. Wittmann
Kuratorinnen: Karolina Kühn & Laura Mokrohs


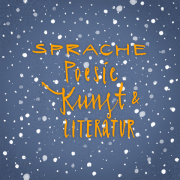
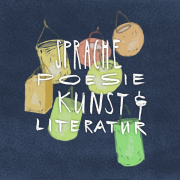
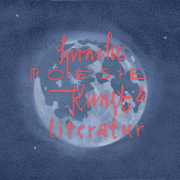
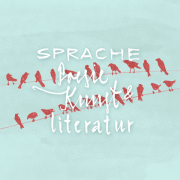
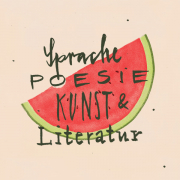
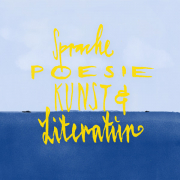
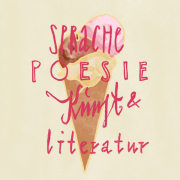

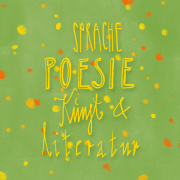
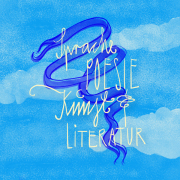
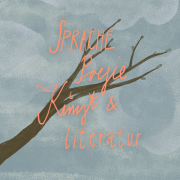
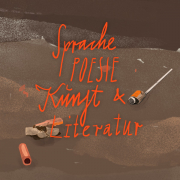
Neuen Kommentar schreiben