Back to the USSR
Gerade neu erschienen: Wespennest 171, „Back to the USSR – 2017“:
 Wer träumt heute noch vom kommunistischen Vielvölkerimperium? Während für die Literaturen der Nachfolgestaaten von einer Sehnsucht nach der Sowjetunion nicht gesprochen werden kann, hat das Schlagwort „Back to the USSR“ in der zeitgenössischen russischen Literatur durchaus ideologische Bedeutung und Sprengkraft, so Erich Klein in seiner Einleitung zum aktuellen Themenschwerpunkt, für den er Prosatexte wie auch Beiträge aus den genreüberschreitenden Bereichen der Literatur versammelt hat.
Wer träumt heute noch vom kommunistischen Vielvölkerimperium? Während für die Literaturen der Nachfolgestaaten von einer Sehnsucht nach der Sowjetunion nicht gesprochen werden kann, hat das Schlagwort „Back to the USSR“ in der zeitgenössischen russischen Literatur durchaus ideologische Bedeutung und Sprengkraft, so Erich Klein in seiner Einleitung zum aktuellen Themenschwerpunkt, für den er Prosatexte wie auch Beiträge aus den genreüberschreitenden Bereichen der Literatur versammelt hat.
Der Aufforderung zur Erinnerung setzt der ehemalige Underground-Autor und Moskauer Konzeptualist Lew Rubinstein zum Auftakt eine Wunschliste des Vergessens entgegen und widmet sich in einem zweiten Beitrag den generationsgebundenen Spielformen von Stalinismus im heutigen Russland. Der frühere Dissident und nachmalige Politikberater Gleb Pawlowski zeichnet die Erinnerungen des russischen Historikers und Philosophen Michail Gefter (1918–1995) auf. Diese umfassen beinahe die gesamte Dauer der UdSSR. Als führendes Mitglied des Instituts für Geschichte der Akademie der Wissenschaften arbeitet Gefter nach dem Zweiten Weltkrieg an vorderster ideologischer Front und wird gerade dort zum „Andersdenkenden“. Sergej Lebedews Beitrag „Verantwortung tragen“ geht von der Prämisse aus, dass die Straflosigkeit der sowjetischen Verbrechen den heutigen autoritären russischen Staat hervorgebracht hat. Das diffuse Konzept einer allgemeinen, unbestimmten Schuld und Reue, wie es während der Perestroika verbreitet war, sei der Entwicklung konkreter juristischer und politischer Strategien von Strafverfolgung im Weg gestanden.
Fragen der Vergangenheitsbewältigung stellen sich für Russland und für die ehemaligen Sowjetrepubliken gleichermaßen, wenn auch nicht unter denselben Vorzeichen. Die heutige litauische Elite etwa, so Tomas Venclova, sei im Vergleich zu den Siebzigerjahren einigermaßen gut informiert über die jüdische Geschichte und über die litauische Kollaboration mit den Nationalsozialisten. Wie jedoch in Litauen Gedenktage begangen und Denkmäler inszeniert werden, bringt viel Antisemitismus und damit auch eine tiefe Kluft zum Vorschein: innerhalb der litauischen Gesellschaft, aber auch als gespaltene Reaktion auf eine europäische/internationale beziehungsweise eine national geprägte Erwartungshaltung. Die Heroisierung der einen und das Vergessen von anderen Bevölkerungsgruppen ist auch in der Ukraine kein unbekanntes Phänomen, wie Boris Chersonskij, ein aus Czernowitz stammender Dichter und Psychologe, in seinen Notizen aus Odessa deutlich werden lässt. Und auch in Minsk, so die Erfahrung des schwedischen Journalisten und Autors Richard Swartz, scheint über die Juden niemand gerne sprechen zu wollen. Swartzs Spaziergänge durch Stalins symbolische Hauptstadt der Utopie machen deren enorme Ausmaße sichtbar – und deren nicht minder große Probleme mit ihren öffentlichen Plätzen. Ein Platz muss schließlich von der Statue einer bedeutenden Person eingenommen werden. Doch wer wäre dafür heute, eine Generation nach der Unabhängigkeit Weißrusslands, geeignet?
Der Spaziergänger-Perspektive verdanken sich auch die Texte von Kirill Kobrin und Michail Eisenberg. Kobrin, der in Nischni Nowgorods Autofabrikbezirk aufwuchs und heute in der Emigration in London lebt, vermittelt in seinem Text einen deutlichen Eindruck davon, dass sich utopische Dimensionen dem Heranwachsenden in erster Linie als Rätsel und Hürden zeigen. Eisenberg hingegen lebt bis heute in seiner Heimatstadt Moskau. Inmitten des städtebaulichen Wandels, der sich als „eine von Glas und Marmor umhüllte Erbärmlichkeit nach der anderen“ vor ihm auftürmt, wird er auf der Suche nach den richtigen Proportionen ausgerechnet in der monumentalen Architektur der Stalinzeit fündig.
In den Norden geht es in einem Ausschnitt aus Zakhar Prilepins Roman Obitel („Das Kloster“). Dessen Protagonist Artjom, wegen Vatermordes angeklagt, wird zur Lagerhaft im Solowezki-Kloster verurteilt, dem im Weißen Meer gelegenen Prototyp des sowjetischen Gulags. Polina Barskowas deutlich minimalistischere literarische Form rekonstruiert Szenen aus der Leningrader Intelligenzija der 1930er-Jahre als biografische Annäherungen an die beiden Brüder Jakow und Michail Druskin. Wie weit die „Energie des kosmischen, weltumspannenden Projekts für Gerechtigkeit und Güte“ ausstrahlt, erfahren wir schließlich in der ironischen Erzählung des in Moldawien aufgewachsenen Autors Wladimir Lortschenkow. Komischer wurde ein ungarisches Garnisonsstädtchen als Kindheitsort und Außenposten der sowjetischen Idee von einem „Stammhalter des Roten Reiches“ selten besichtigt.
Für den Bildteil des Schwerpunkts haben sich Studierende des Master-Studiengangs Critical Studies der Akademie der bildenden Künste Wien zum Thema Revolution Gedanken gemacht.
Außerdem in diesem Heft: Stephan Steiner zeigt auf, dass das Verbot protestantischer Bewegungen in der Habsburgermonarchie einen regen Schmuggelhandel mit Büchern in Gang setzte. Valentin Groebner berichtet von seinen zwiespältigen Erfahrungen in einem Schriftsteller-Erholungsressort in Sri Lanka. Barbara Köhler behandelt in ihrer Poetikvorlesung die Polyvalenzen und Übersetzungsschwierigkeiten in Homers Odyssee, und Zsuzsanna Gahse befasst sich mit dem durch und durch modernen Schreiben der „unbekannt bekannten“ Gertrude Stein.
Weiters stellt das Wespennest Dichtung und Prosa von Georgi Gospodinov, Michael Hammerschmid, Jean Portante, Barbara Rauchenberger, Levin Westermann und Lina Wolff vor und beschließt das Heft wie immer mit einem ausführlichen Buchbesprechungsteil.

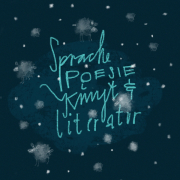

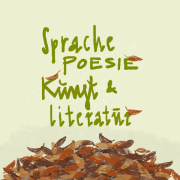
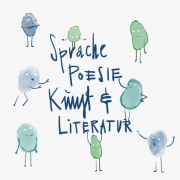
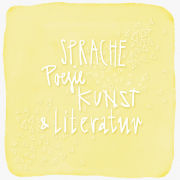
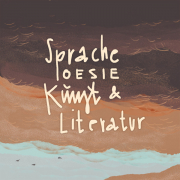
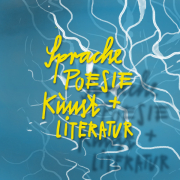
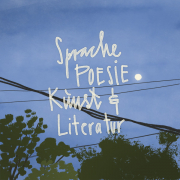
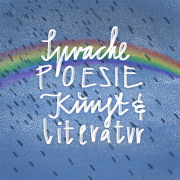
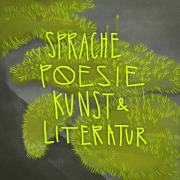
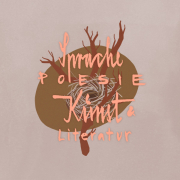
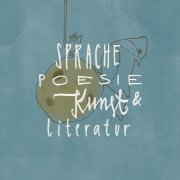
Neuen Kommentar schreiben