|

Vasile V. Poenaru
bardaspoe [at]
rogers.com
geboren
1969, zweisprachig
aufgewachsen, Studium der
Germanistik in Bukarest,
darauf Verlagsarbeit und
Übersetzungen. Lebt
in Toronto.
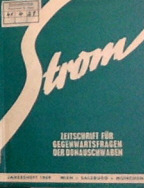
Der Strom.
Jahreszeitschrift für Gegen-
wartsfragen der Donau-
schwaben. (Wien-Salzburg-
München, 1959.)
"Deutsche Inseln im
Völkermeer" – fast siebzig
Jahre später gilt diese Vor-
stellung, dieser Wahlspruch,
dieses abkapselnde Ver-
ständnis der Identitätsfrage
fast immer noch voll
und ganz.

(c)
kulturportal-west-ost.eu
Adalbert Karl Gauß
(1912-1982)
Tunlichst die Donau
runter und dann
irgend-
wann
wieder nichts wie
die Donau rauf. Wie
macht man das? Ein
Chronist soll her!
Das Abenteuer "setzte ein,
als im frühen Mittelalter
deutsche Burgleute und
Handwerker in die Zips,
nach Siebenbürgen und
bis hinunter auf den
Balkan vordrangen."
"Das Bild vom insel-
deutschen Donauschwaben
wurde durch eine völkische
Politik so einfältig mit der
Vorstellung von Groß-
bauern verknüpft, dass
selbst klare statistische
Unterlagen diese Schematik
nicht zu beeinträchtigen
vermochten."
In Sachen "Donau-
schwäbisches Schicksal
zwischen Ost und West"
wusste A. K. Gauß
offensichtlich schon 1959
ein nuanciertes Lied zu
singen. Ein besseres Lied.
|
|
"Donauschwäbisches
Schicksal zwischen Ost und West", so der
anregende und aufschlussreiche Titel
des von dem jahrzehntelang im Dienste der Vertriebenen engagierten Lehrers,
Verlegers, Journalisten und Volkskundler s
Adalbert Karl Gauß in Der Strom. Zeitschrift für
Gegenwartsfragen der Donauschwaben (Wien-Salzburg-München, 1959, S.
61-80) veröffentlichten Artikels
–
bedeutsam auch im gegenwärtig wieder intensiv bedachten Zusammenhang des
tieferen, ureigenen Selbstbewusstseins, des wesentlichen
Identitätsparadigmas der deutschsprachigen Minderheiten in Osteuropa.
Der Autor selber hatte sich wohlgemerkt 1945 mit seiner Frau und den drei Söhnen
auf den windigen Weg von Ost nach West gemacht (ein vierter Sohn, der sich
noch zum preisgekrönten Schriftsteller entwickeln
sollte, wurde neun Jahre später in Salzburg geboren: Karl-Markus).
Bestellt ein
Großbauer deutschsprachiger Ausdrucksweise den Acker, so wird großartiges
deutsches Kulturgut gesät. Klar. Vieles wird deutsch, nein, alles wird
deutsch, soweit der Pflug die Erde nur tief genug durchschneidet. Wie
deutsch? Die Antwort fällt einem (nach der entsprechenden Lektüre des
Artikels von A. K. Gauß) nicht schwer: Sehr deutsch, ja vielleicht sogar
ein klein bisschen zu deutsch. Aber das
will natürlich erläutert werden.
" Da
sagt der Landmann: Es ist gut." Schon Georg Trakl wusste das
in seinem "Verklärten Herbst." Und dass die Germanisten "umgromm und
umgromm und umgromm", hat Jandl vorzüglich
methodologisch (und vor allem ja auch mit viel Witz) dann
seinerseits prompt auf den
Punkt gebracht –
und wenn schon nicht auf Hochdeutsch, so doch jedenfalls auf gut Deutsch.
Bodenständigkeit.
Roden. Urbarmachung. Pflügen. Durchschneiden. Umgromm. Umgromm. Umgromm.
The old country. Lauter Begriffe, die da irgendwie
mit hinein gehören, wenn wir mal hören wollen, wo unsere
Sprache denn eigentlich herkommt, ja
wo wir selber herkommen. Unsere Diskussion, die
Diskussion rund um das donauschwäbische Schicksal ist
aber allen geographischen Berücksichtigungen zum
Trotz hundertprozentig auf deutschem Grund und Boden verankert,
oder?
Mal sehn: Ein
aus Bácspalánka zugewanderter
Salzburger donauschwäbischen Schlages bedenkt schon Ende der Fünfziger das
(bis auf den heutigen Tag)
gerne romantisierend-national geprägte Selbstbild der
Donauschwaben wie dasjenige der sonstigen deutschstämmigen
Volksgruppen. Deutsche Inseln im Völkermeer, diese Vorstellung, diesen
Wahlspruch, dieses abkapselnde Verständnis der Geschichtlichkeit im großen
Ganzen und des eigenen Werdegangs jeweiliger
Völkerschaften inmitten der Stürme,
der brausenden Wogen, der eiskalten Winde des Völkermeers de-konstruiert
A. K. Gauß im Jahre 1959, indem er die ihm durch
Herkunft, Ausbildung, Erfahrung und Einfühlungskraft
so durch und durch vertraute Kulturlandschaft des Donauschwäbischen an sich
und für uns mit seinem scharfen Blick tief durchschneidet. Fast siebzig
Jahre später gilt diese Vorstellung, dieser Wahlspruch, dieses abkapselnde
Verständnis der Identitätsfrage fast immer noch voll und ganz
–
wie als wäre sie nie de-konstruiert worden.
Eine unverkennbare Aktualität. Ein ungetrübter Blick. Ein
grenzübergreifendes Geschick. Adalbert Karl Gauß.
Das
Deutschtum so pflegen, dass auch all die vielen sinnvollen Wechselwirkungen
mit allerlei sonstigen Völkerschaften
so richtig auf ihre Rechnung kommen: kein leichtes Stück.
Inwiefern ist das gelungen? Ist das überhaupt
gelungen? Besser: Hätte das denn überhaupt gelingen können?
Schließlich handelt es sich ja
hier um ausgesprochen trübe Zeiten
–
und um trübe Wasser rund um diese trüben Zeiten und um
unsere Inseln, auf denen wir uns unser Deutsch zurechtflickten, stets die
eine ewige Wahrheit im Ärmel: dass die Sprache uns gehöre, dass die Insel uns
gehöre. Ja, klar. Im Konjunktiv.
Und "wir": das sind die anderen.
Deutsch zwischen
West und Ost, zwischen Ost und West.
Alles brav ausloten und die Inseln schön
heimelig einrichten. Tunlichst die Donau runter und dann
irgendwann
wieder nichts wie die Donau rauf. Wie macht
man das? Ein Chronist soll her! Nur, das vermag ein Chronist?
"Das Schicksal
der Restgruppen deutschsprachigen Insel-Volkstums
in Südosteuropa nach den katastrophalen Erschütterungen zwischen 1933
und 1945": Inwiefern konnte man anno 1959 vom Standpunkt Salzburg
aus darüber sprechen? Gauß geht dieser Frage über die Seitenwege der
Selbsterkundung nach. Sein Unterfangen macht ein geistiges Abenteuer
(mit argumentativ-kritisch gestalteten Abstechern in den großen, zu der
Zeit noch keineswegs zureichend aufgearbeiteten Themenkomplexen
Vaterland-Mutterland, Nationalismus, Kommunismus usw.) aus. Das diskursive
Abenteuer, auf das sich der Verfasser des Artikels einlässt, dreht sich um
die Wurzeln, um die Urbarmachung, um das Pflügen
–
aber eben auch um die intrinsische Gewachsenheit deutschsprachiger
Inselgruppen, in der natürlich wesentlich mehr mit drin steckt als
die Wurzeln, die Urbarmachung und das Pflügen. Mehr als das sogenannte
Deutschtum und seine praktische Vernunft und Unvernunft.
Ein
Abenteuer der Wahrnehmung feinfühlig gehandelter
Selbstbewusstseinskonstrukte, die von einengenden, ihrer vielfältigen,
jeweils im Kontext definierten, mehr oder weniger methodologisch klar
umrissenen Verortung kaum zur Genüge reichenden herkömmlichen
Zugehörigkeitsprinzipien befreit werden. Ein
Abenteuer, das im gewissen Sinne das historische Abenteuer der
deutschstämmigen Osteuropäer im weitesten Sinne
widerspiegelt –
oder doch jedenfalls begrifflich fundiert erfasst. Und dieses Abenteuer
"setzte ein, als im frühen Mittelalter
deutsche Burgleute und Handwerker in die Zips, nach Siebenbürgen und bis
hinunter auf den Balkan vordrangen." Und irgendwann hörte
es dann wieder auf.
In seiner
Analyse des Selbstbildes der Donauschwaben bemängelt der
Autor, dass die autochthone
Perspektive im Rahmen der ethnographischen Forschungsarbeiten der Zeit
gezwungenermaßen den Kürzeren ziehen musste, dass sie sich einfach dem
Mainstream der alten Heimat fügte, ohne die Selbstverständlichkeit und die
Voraussetzungen bzw. die Herangehensweisen der binnendeutschen Forschung zu
hinterfragen.
"Die bodenst ändigen
volksdeutschen Kräfte", so Gauß,
"die mit einer wissenschaftlichen Fragestellung aus den milieubedingten
Zusammenhängen des Raumes heraus selbst angetreten wären, konnten nicht
ausreifen. Sie blieben in einem hoffnungslosen Provinzialismus stecken oder
übernahmen kritiklos die wissenschaftliche Fragestellung der binnendeutschen
Forschung." In diesem Zusammenhang spricht der Autor von einer "nachhaltigen
Beeinflussung der inseldeutschen Volksforschung mit einem unverkennbaren Zug
zur Romantifizierung", in deren Rahmen sich der Nationalismus leider als
"sprengende Kraft" zu behaupten vermochte.
"Der hypertrophe
Nationalismus, den alle in den ethnischen Mischräumen des Südostens lebenden
Volksgruppen mit besonderer Sorgfalt kultivierten, musste schließlich
zwangsläufig den Raum politisch sprengen."
Eine
gewisse Einseitigkeit in der Wahrnehmung ihrer spezifischen Umstände, eine
gewisse Ausblendung ihrer gesellschaftlichen Rolle und ihrer Berufung als
Kulturvermittler im pluriethnischen Raum wirkte sich demzufolge
denkbar verhängnisvoll auf die
Art und Weise aus, in der die Donauschwaben sich selbst betrachteten. "Das Bild vom inseldeutschen Donauschwaben wurde durch eine völkische
Politik so einfältig mit der Vorstellung von Großbauern verknüpft, dass
selbst klare statistische Unterlagen diese Schematik nicht zu beeinträchtigen
vermochten."
Und als die
Donauschwaben sich dann schließlich in den Wirren der Geschichte nach den
katastrophalen Erschütterungen zwischen 1933 und 1945 wenigstens zum Teil
wieder stromaufwärts retten durften, fanden sich unter ihnen Menschen, die
es als ihr Amt, als ihre Pflicht, als ihre Berufung betrachteten, den
Leidensgenossen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen
–
und dabei auch stets ihr Schicksal, ihr Vermächtnis mit zu reflektieren.
Leute wie Adalbert Karl Gauß. In Sachen "Donauschwäbisches Schicksal
zwischen Ost und West" wusste A. K. Gauß
offensichtlich schon 1959 ein nuanciertes Lied
zu singen. Ein besseres Lied. Ein (Donau)Schwabenlied,
das weit über die Metaphernwelt der "deutschen Erde" und des "Völkermeers"
hinweg setzt.
Nichtsdestoweniger:
"Von deutscher Erde
sind wir abgeglitten
auf diese Insel weit im Völkermeer.
doch wo des Schwaben Pflug das Land durchschnitten,
wird deutsch die Erde, und er weicht nicht mehr."
(Adam Müller-Guttenbrunn, Banater
Schwabenlied)
|
|
