|

Vasile V. Poenaru
bardaspoe [at]
rogers.com
geboren
1969, zweisprachig
aufgewachsen, Studium der
Germanistik in Bukarest,
darauf Verlagsarbeit und
Übersetzungen. Lebt
in Toronto.
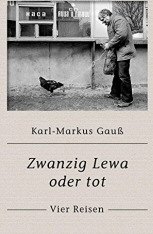
Karl-Markus Gauß.
Zwanzig
Lewa oder
tot: Vier Reisen.
Zsolnay, 2017, 208 S.
ISBN: 3552058230
Ein Gedanke aus purem
Sinn: Das Ding will ich
haben, werde ich haben!
Ich wusste es einfach.
Reiseberichte von Karl-
Markus Gauß, das sind,
wie der hochverehrten
Leserschaft in deutschen
Landen mittlerweile bereits
wohlbekannt sein dürfte,
partout keine bloßen
Reiseberichte.
"Und plötzlich, im tiefen
Wald, begriff ich, daß ich
mitten im Dorf stand."
Plötzlich, sozusagen
mitten drin in Bessarabien,
merken wir, dass wir ja
eigentlich schon wieder
in Salzburg sind. Und auf
einmal geht’s die Salzbur-
ger Bessarabienstraße
entlang.
Gauß' Menschen werden
Brüder. Dieser Autor ver-
steht sich auf Götterfunken.
Er weiß, wie man das
Große aus dem Kleinen
birgt und wie man die
Landkarten der Seele liest.
"Wenn ihr mir nicht
zwanzig Lewa schenkt,
bin ich bald tot."
Irgendwie gewinnt man
bei Karl-Markus Gauß
bisweilen den Eindruck,
er sei der letzte europä-
ische Romantiker, der
letzte letzte Romantiker
Europas.
Irgendwo jenseits des
neuen Limes ballt sich
was zusammen. Es ist das
Gefühl, von der Weltge-
schichte fallen gelassen zu
werden, aus dem kollektiven
Gedächtnis der Menschheit
getilgt worden zu sein.
|
|
"I
miss you so much. There is this longing inside I just can’t figure out."
Ungefähr so könnte man Gauß’ inneren Drang zum transkontinentalen
Je-ne-sais-quoi donauschwäbischer Art und Weise, die konnotationsreiche
Mega-Reise zurück zu seinen osteuropäischen Wurzeln, das
Schnell-wieder-mal-weg-zu-mir-selber ins Englische übersetzen, wenn
–
ja wenn man sowas überhaupt ins Englische übersetzen wollen würde.
Right! Longing.
Also
Sehnsucht nach was? Nun gut, wenn die Frage jetzt so leicht zu beantworten
wäre, bräuchten wir keine
Zwanzig Lewa. Keine Multi-Kultur-Trips zum
Europäischen Tellerrand, kein "Wechselspiel von Erinnern und Vergessen",
kein "Europa im Kleinen", keine "zu Herzen gehende Reiseliteratur, wie sie
kein anderer zu schreiben weiß". Okay, das ist jetzt der Klappentext.
Der Klappentext hat nie recht. Karl-Markus Gauß hingegen hat immer recht.
Dafür ist er aber freilich auch kein Text, sondern bloß ein Mensch. Und
hundertprozentig recht hat er streng genommen ja eigentlich auch wieder
nicht immer, wie die Gauß-Forschung angeblich in ihren neueren
Positionierungen nach einigem Hin und Her weitgehend einräumte. "Ich bin
nicht immer meiner Meinung", verriet der Autor übrigens einst in seiner
eiskalten Wut gegen festgenagelte, unabdingbar etablierte Meinungen. Doch
das ist nun schon eine Weile her.
"Meine moldawische
Sehnsucht", so der Titel des ersten der vier Teile des Buches. Ein Titel,
der auch als Titel des Ganzen hätte herhalten sollen, können und dürfen. Und
nun wissen wir’s: Es ist die moldawische Sehnsucht. Eine moldawische
Sehnsucht. Seine moldawische Sehnsucht. Gauß’ Sehnsucht. Die
Sehnsucht nach
–
Ja, nach.
Unsinn.
Wir wissen nichts.
Vier Reisen. Zweihundert Seiten. Zsolnay
Verlag, 2017. Zwanzig Euro. Intrinsiche Fragezeichen als
Weltanschauung-Wegweiser. Achselzucken. Bejahen. Verkünden. Bezweifeln.
Kultur-Scout, fährst du nach Ga...?
Sehnsucht
nach demjenigen, "der ich einmal war oder der ich, ehe ich es vergessen
hatte, gerne geworden wäre"? Da hilft nur eins: Man begebe sich auf
authentische Reisen. Mit Verstand und Gemüt. Alteuropäisches Tempo. Spärlich
gehupt. Augen offen. Richtung Gauß.
Jajaja! Oder besser gesagt: Jajajajaja!
Seitdem
ich nämlich irgendwie in wundersam rätselhafter Manier spürte, dass es
dieses tolle Buch der zwanzig Lewa gibt, dass es diese eigenartige
Devisen-Lektüre schlechthin geben muss, zerrte irgendwas in mir. Ein
Gedanke aus purem Sinn: Das Ding will ich haben, werde ich
haben! Ich wusste es einfach. Ebensogut wie Seine Durchlaucht der Sultan
einst, vor ein paar wenigen Jahrhunderten, ganz genau wusste, dass er am
allerliebsten ganz Bulgarien sein eigen nennen würde, als er eines schönen
Morgens (es ward bald Frühling; türkisch: Bahar), den berühmten Spruch von
sich gab: "Bulgaria jajaja!"
Gesagt, getan. Und jetzt winkten mir zwanzig fröhliche Euro aus einem
reichlich mit Mehrwert bestückten Verlagsprodukt ohne Verfallsdatum. Welcher
Leser würde das nicht gern haben? Einen Zwanzig-Euro-Schein als Lektüre!
Zwanzig Euro oder tot. Nein, nicht zwanzig Euro. Zwanzig Lewa. Alles klar.
Und ganz lebendig. Nulldefizit in Sachen Besitz und Bildung.
Hand
aufs Herz: Reiseberichte von Karl-Markus Gauß, das sind, wie der
hochverehrten Leserschaft in deutschen Landen mittlerweile bereits
wohlbekannt sein dürfte, partout keine bloßen Reiseberichte, sondern
anspruchsvolle, kulturwissenschaftlich fundierte Kundschafter-Ritte. Ritte,
die wo hin führen. Total harmlos. Im erzählenden Stil verabreicht. The price
is right. Die story sitzt. Sowas gelingt nicht jedem.
Auf dem Schutzumschlag ist
ein älterer Herr zu sehen, der eine Henne an der Leine führt. Nun gut, es
handelt sich ja eigentlich gar nicht um eine Leine, sondern um eine Schnur.
Und dieser Ansatz ist es denn auch, der uns schnurgerade ins Innere des
Buches führt. In vier Welten, die Gauß genauestens ausmisst, um sie uns
näher zu bringen, und in die fünfte: in sein, nein, in unser good old
Salzburg. Alles ist super.
"Und plötzlich, im tiefen Wald, begriff ich, daß ich mitten im Dorf stand."
So hatte uns der Autor vor ein paar wenigen Jahren veranschaulicht, was ein
Perspektivenwechsel bewirken kann bzw. was es so alles mit dem schönen
Begriff Standpunkt und mit seiner transeuropäischen Gewachsenheit auf sich
hat. (Die
sterbenden Europäer)
So
auch hier. Man schreibt das Jahr 2013 (oder 2014; wer nimmt das schon so
genau? ). Man liest Seite 19. Vorne Seite 20, hinten Seite 18. Alles scheint
brav linear vor sich zu gehen. Man befindet sich in Bessarabien. Hinten die
Vergangenheit, vorne die Zukunft. Genau wie erwartet.
Wir wenden das Blatt. Und
plötzlich, sozusagen mitten drin in Bessarabien, merken wir, dass wir ja
eigentlich schon wieder in Salzburg sind. Und auf einmal geht’s die
Salzburger Bessarabienstraße entlang. So hinreißend kann eine Reise in die
Ferne geraten. So nah kann sie enden.
Stets mit Gauß, nie ohne ihn.
Solche
Wege, die immer wieder gerade dann zu einem selbst führen, wenn man
felsenfest davon überzeugt ist, mal wirklich ganz weit weg zu sein und
gewissermaßen in den exotischeren Winkeln des Gemüts die Erfahrung des
Fremdartigen par excellence gemacht zu haben, verbinden in der Tat wieder,
was die Mode streng geteilt. Zu solchen Ärmeltricks greift Gauß öfters, wenn
er sich flink zu den anderen schleicht, um zu sehen, mit welchen Augen sie
uns sehen.
Freilich sind es keine
eigentlichen Ärmeltricks, keine billigen Tricks im wörtlichen Sinne, die da
bei einem scharfsinnigen und sprachlich begabten Gauß ihre belehrende
Wirkungskraft mitspielen lassen, wenn er aus Worten Bedeutung schöpft,
sondern eben diejenigen Konnotationen des Begriffs, die etwa im englischen
Ausdruck "That’ll do the trick" stecken. Das sitzt.
Und
eins steht jedenfalls fest: Gauß' Menschen werden Brüder. Dieser Autor
versteht sich auf Götterfunken. Er weiß, wie man das Große aus dem Kleinen
birgt und wie man die Landkarten der Seele liest. Das ist nur recht und
billig. Karl-Markus Gauß erweist sich jederzeit als sehr detailfreundlich
–
und eben auch als sehr detailkundig; nicht jedermanns Sache.
Er versteht es immer wieder, für die Schwächeren, für die Benachteiligten,
für die sozusagen in Acht und Bann Geratenen zu sprechen, selbst wenn sie
mal gerade nicht in Acht und Bann stehen. Geschickt baut der Autor
Vorurteile und Mythen des modernen Europäers ab, etwa in der Art und Weise,
wie er die "Zirkulation" des Geldstücks verfolgt, das er den drei
Roma-Kindern gibt und das von diesen wider Erwarten zunächst in
erstaunlicher Besonnenheit entsprechend umgetauscht und alsdann brüderlich
aufgeteilt wird. Auf jeweils ein paar wenigen Seiten gelingt es dem Autor
mehr als nur einmal, uns davon zu überzeugen, dass unsere Vorurteile
möglicherweise selbst dann fehl am Platz sind, wenn sie auf Anhieb
bewahrheitet zu werden scheinen.
Der Schein trügt. Auch
der Zwanzig-Lewa-Schein. "Zwanzig Lewa oder tot" bedeutet in diesem Buch:
"Wenn ihr mir nicht zwanzig Lewa schenkt, bin ich bald tot."
Dieses
unentwegte Bestreben, die Menschen vom Tellerrand und eben auch die Länder
der Peripherie mit in die Diskussion zu holen, sie ins Gespräch zu retten,
ihren Standpunkt zu vertreten, auf dass sie nicht verkommen, auf dass wir
uns nicht von ihnen, unseren Mitmenschen, lossagen, ist eine lobenswerte
humanistische Leistung. Dieses Bestreben spricht den Leser umso mehr an, als
es konsequent stilvoll
–
und oft genug mit viel Witz
–
inszeniert wird. Auch deswegen zieht einer da gern seinen Hut.
Und irgendwie gewinnt man bei Karl-Markus Gauß bisweilen den Eindruck, er
sei der letzte europäische Romantiker, der letzte letzte Romantiker Europas,
unseres guten alten Kontinents. Und wenn wir mit ihm durch diese seine
irgendwie doch recht rätselhafte Seelenlandschaft der Peripherie wandern,
hier das Gegacker einer verwunschenen Innenstadt, da das Schweigen eines
vergessenen Friedhofs erkunden, wenn wir uns mit Gauß lesend zwischen den
Schlaglöchern der Geschichte sehnsuchtsstrotzender Orte hindurch schleichen,
so wie er sie uns erzählt, ja dann kommt langsam, aber sicher jene Mutation
der Anschauungsweise zustande, anhand derer wir Gauß’ Europa auch mal selber
mit abstauben und dabei ganz gemächlich, ja ganz beiläufig unser eigen
nennen. Und so werden denn auch wir, die eigentlich im Denken wie im
Empfinden völlig anderswo verankerten Leser, gleichsam unwillkürlich zu
einem Teil von jener Kraft.
"Hoppla!", würde der Autor jetzt sagen. Und er würde natürlich recht haben.
Denn der Autor hat ja wie gesagt immer recht. Oder jedenfalls fast immer.
Und
irgendwie, irgendwo, irgendwann muss der Leser wennschon auch nur im
Flüsterton (ich aber sag’s ja wie immer ganz laut) bekennen: So eine
alternative Wirklichkeit unserer selbst hätten wir uns, ganz auf uns allein
gestellt, nicht im Traum ausmalen können. Nostalgisch gefärbt, romantisch
verklärt, und doch immer wieder so durch und durch modern, so sachlich, so
naturgemäß aus den Dingen heraus geschrieben.
Irgendwo jenseits des neuen Limes ballt sich was zusammen. Es ist das
Gefühl, von der Weltgeschichte fallen gelassen zu werden, aus dem
kollektiven Gedächtnis der Menschheit getilgt worden zu sein, das Gefühl,
nicht mehr voll und ganz dazuzugehören. Voller Sehnsucht nach einer
alternativen Existenz greift ein
Österreicher namens Karl-Markus Gauß zu seinem rotweißroten Bleistift – und
schreibt sich den Weg frei, der ins Innere führen soll.
Das ist so sein Ding. Unser Europa.
|
|
