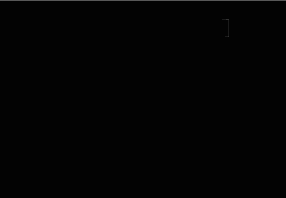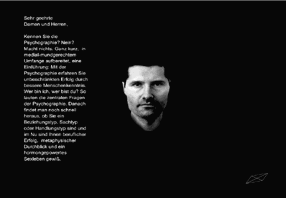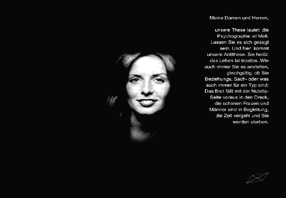|
|
|
|
von Roberto Simanowski Jürgen Daibers und
Jochen Metzgers Der Text
startet wie eine Bühnenshow: schwarzer Hintergrund,
eine Tür öffnet sich oben rechts und
läßt ein weißes T hinein, das sich
über die Bühne bewegt, unter dem T ein
weißer Lichtkegel. Plötzlich ein weiterer
Lichtkegel, dann ein dritter. Drei Spots und ein T
füllen nun die schwarze Bühne. Aus dem T löst
sich ein zweites, zwischen beiden wächst ein O heran,
bald kommen weitere Buchstaben hinzu, bis der Titel geformt
ist. Eine grandiose
Eröffnung in technischer und ästhetischer
Hinsicht. Der Leser fühlt sich in einen dunklen Saal
vor eine Bühne versetzt und erwartet den Fortgang der
Performance. Da nichts weiter geschieht, bewegt er
schließlich die Maus auf jenes mit markierten
Diagonalen versehene Trapez unter dem Titel, das sich nun
als Menü herausstellt. Bei Mouseover-Kontakt erscheit
ein grün ausgefülltes Dreieck am rechten
Trapezrand mit dem Wort >weiter<, Mouseover auf der
anderen Seite des Trapezes ergibt ein blau ausgefülltes
Dreieck mit dem Hinweis >zurück zum vorigen
Abschnitt<. Dem Zuschauer obliegt es also selbst, die
Sache voranzutreiben. Die nächste Szene
ergibt ein Männergesicht im schwarzen Hintergrund und
einen weiß geschriebenen Text, der genau so beginnt,
wie eine Bühnenshow beginnen könnte: "Meine Damen
und Herren, kennen Sie die Psychographie? Nein? Macht
nichts. Ganz kurz, in medial-mundgerechtem Umfange
aufbereitet, eine Einführung: Mit der Psychographie
erfahren Sie unbeschränkten Erfolg durch bessere
Menschenkenntnis". Der/die Sprecher/in, das ist bald klar,
hält nicht viel von der Psychographie. Der Klick auf >weiter<
bringt es an den Tag. Neben einem Wer nach
dieser Erinnerung an den eigenen Tod im Programm bleiben
will, wird schließlich eingeladen, sich durch einige
Geschichten trösten zu lassen. Der Trost, so die
Botschaft hier, liegt also nicht im Bild, sondern im Wort.
Um
herauszufinden, welche Geschichten für den Leser am
geeignetsten sind, soll mittels sechs Multiple-Choice-Fragen
dessen Persönlichkeitsprofil erstellt werden. Das alles ist sehr
beeindruckend in technischer Hinsicht. Was aber
transportiert es darüber hinaus? Was soll die Rede vom
Elektro-Therapeuten, der nach erfolgter Testauswertung
individuell zugeschnittene Trostgeschichten verordnet. Zum
einen stimmt es nicht, denn der Therapeut verordnet keine
Trostgeschichten, sondern legt, was ein großer
Unterschied ist, lediglich deren Reihenfolge fest. Zum
anderen fragt man sich, ob dieser Test nicht insgesamt ein
Betrug ist. Ergeben unterschiedliche Antworten
tatsächlich unterschiedliche Reihenfolgen? Ja; sie tun
es. Aber gibt es wirklich eine Logik hinter dieser
Differenz? Es sieht ganz danach aus.
Wer z.B. zugibt, dass der Parter stöhnt, man sei eine
Schlaftablette, erhält ein steigendes Sport-Icon, bei
>Workaholic< fällt das Autos-Icon, empfindet der
Partner einen als >der/die Falsche<, sinkt das
Kinder-Icon. Natürlich verbraucht Sport nicht nur
Energie, sondern macht auch energischer und natürlich
liegt der Trost nicht gerade in Kindergeschichten, wenn die
Beziehung davor steht auseinanderzubrechen. Von ebenso
überrumpelnder Plausibilität ist das Ergebnis bei
der Frage nach der am meisten bewunderten Person des
öffentlichen Lebens: Mutter Theresa verursacht ein
steigendes Liebe-Icon, Lady Di nichts, Helmut Kohl ein
steigendes Sport-Icon; wer der schnellen Zustimmung
widersteht, fragt sich freilich, welche Logik in dieser
Zuordnung liegt: warum lässt Mutter Theresa, die
für ihre Liebe bekannt ist, das Liebe-Icon steigen,
warum Kohl, der nicht als Sportler berühmt wurde, das
Sport-Icon. Wenn indes auf die Frage
"Was spricht Sie positiv an" die >Bundestagswahl< das
Kinder-Icon fallen läßt, ist der Bezug schon
schwerer zu erstellen. Auch das steigende Sport-Icon beim
ebenfalls zur Auswahl stehenden >Armageddon<, der
biblischen Metapher für politische Katastrophe, leutet
wenig ein. Und warum verursacht der Bauernhof als
Wunschlebensort eigentlich steigende Autos- und
Sport-Icon? Bedenkt
man die Willkür der Reaktionen und hat man einmal ihre
Inkonsistenz Die Frage
des digitalen Kitsches werden wir noch ausführlich
behandeln. Ein gewichtigeres Argument
ist allerdings der Unernst, den die Autoren immer wieder
betonen. Dies beginnt im
"Klappentext" Man
hat bald begriffen, dass der Witz darin liegt, die Leser,
nachdem sie gerade belehrt wurden, dass die Psychographie
Müll ist, zu einem Psychotest zu verführen, der
ganz offensichtlich auch Müll ist. Die
Gutgläubigen, die wirklich meinten, dieser Test werde
sie den für sie richtigen und wichtigen Geschichten
zuführen, werden als Dummköpfe vorgeführt
(wenn es tatsächlich eine Bühne gäbe, auf der
sich die Show abspielte) bzw. erkennen sich selbst als
solche. Sie wenden vielleicht ein, dass der Witz nicht
aufgeht, weil er auf einer falschen Voraussetzung beruht:
wenn keine Alternative besteht, diesen ominösen Test
des Persönlichkeitsprofils zu umgehen und direkt zu den
Geschichten vorzuschreiten, ist der Lacher freilich leicht
zu haben und die implizite Publikumsbeschimpfung nicht viel
wert. Jedoch, die Alternative besteht. Sie ist kaum
sichtbar, aber sie existiert: im Menütrapez gibt es die
Funktion "diesen Absatz überspringen". Dass sie so
versteckt ist (die Funktion wird erst bei Mouseover
sichtbar) ist kein Zeichen nachlässiger Programmierung,
im Gegenteil: wer wirklich die Abneigung gegen diesen dummen
Text spürt und nach der Alternative sucht, der wird mit
dem Ausweg belohnt. Die anderen müssen eben den Spott
ertragen. Wie steht es nun aber um die
Trostgeschichten im einzelnen? Und was haben diese mit dem
ganzen Vorspiel zu tun? Der zweiten Frage ist an
späterer Stelle |