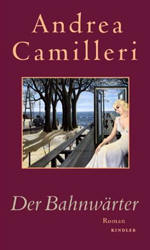|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links |
Von Georg Patzer Jetzt hat er sich endgültig zum Vielschreiber entwickelt. Wie viele Bücher schreibt er pro Jahr? Drei? Vier? Leider merkt man das auch. Selbst seine Krimis um Commissario Montalbano werden schwächer und schwächer, und die anderen Bücher dünner und dünner – es scheint so, als hätte sich Andrea Camilleri gerade richtig leergeschrieben. Schwach und substanzlos ist auch sein neuestes Buch, eine am Ende mythisch-märchenhaften Geschichte aus der Zeit des Faschismus: Es erzählt vom Bahnwärter Nino Zarcuto und seiner Frau Minica. Sie wohnen in einem Häuschen an der Strecke zwischen Vigàta-Cannelle und Castellovitrano, auf der zwei Personenzüge fahren, zweimal am Tag. Viele Jahre lang, sodass sich die Mitfahrer gut kennen und der Lokführer an jedem Bahnhof schon weiß, wer kommt. Da hat es sich sogar eingebürgert, dass er wartet, wenn jemand zu spät kommt, und die Fahrgäste ihm sagen, wenn sie an einem Tag mal verhindert sind. Im März 1942 beginnt Nino seine Arbeit, die nicht sehr schwer ist. Schwerer ist ihr Schicksal: Denn lange können die beiden keine Kinder bekommen, bis eine Heilpraktikerin sie untersucht und Nino eine Salbe verschreibt, nach der Minica doch noch schwanger wird. Dann passieren viele Dinge gleichzeitig: Von Don Simone Tallarita bekommen Nino und sein Freund Totò, die gemeinsam im Dorf musizieren, den Auftrag, vor dem Haus von Giugiu Mirabello ein Ständchen zu singen: „Der Bock, der trägt zwei Hörner“. Und Don Simone schlägt man nichts ab. Dann kommen Soldaten und bauen Bunker entlang der Bahnlinie, was Ninos Brunnen hinter dem Haus zum Versiegen bringt, und nachts, wenn er nicht da ist, klopfen fremde Männer an die Haustür, sodass Minica Angst bekommt. Dann wird Mirabello umgebracht, Nino entdeckt einen Tunnel und eine Grotte im Brunnen und gewinnt eine Riesensumme im Lotto. Nino und Totò werden verhaftet, weil sie angeblich mit ihrer Musik den Faschismus verhöhnen, und im Nachbarhäuschen zieht ein neuer Bahnwärter ein, der Minica vergewaltigt und fast totschlägt. Die Ereignisse überschlagen sich in diesem sehr kurzen Roman, wobei die ersten Seiten Vorgeplänkel ist, das weder mit der Geschichte selbst etwas zu tun hat noch etwas zur Atmosphäre hinzufügt. Wie überhaupt wenig Atmosphäre in diesem Roman ist, und keine Zeit, keine Ruhe, weil der Leser ständig durch die krude Handlung gehetzt wird. Weiter geht’s damit, dass Nino den Nachbarn umbringt, dass er einen Amerikaner verstecken muss, und dass seine Frau ihren Verstand verliert und meint, sie sei ein Baum. Sie stellt sich in den Garten, gräbt sich halb ein, und Nino muss sie bewässern: „Früchte“ will sie tragen. Diese letzten 50 Seiten des schmalen Buchs könnten sehr anrührend sein, wenn sich Camilleri wenigstens hier auf die Charaktere konzentriert hätte, ihnen ein wenig Zeit zum Verwandeln, zum Staunen gelassen hätte. Denn Nino lässt sich auf die Verrücktheit seiner Frau ein, baut ihr einen Unterstand, damit sie nicht in Regen und Kälte stehen muss und sorgt für sie. Bis er nach einem Fliegerangriff ein verlassenes, vor Hunger schreiendes Neugeborenes findet und mitnimmt. Und da verwandelt sich Minica wieder in eine Frau und Mutter zurück.
Mythen und Märchen darf
man ruhig glauben. Wenn sie gut geschrieben sind. Camilleri scheint das nicht
mehr zu beherrschen: Es ist nichts Sinnliches an diesem Roman, keine Poesie,
keine Stimmung. Er ist fast eine reine Aufzählung von sich jagenden Handlungen,
hier eine Geschichte, dort eine Anekdote. Auch die Zustände unter dem
Faschismus, die Camilleri mal so fasslich beschreiben konnte, werden zur reinen
Staffage. Und die tiefe Liebe zwischen den beiden, die Minicas Verwandlungen zum
Baum und zurück zur Frau erst möglich machen, wird so unbeteiligt und platt
erzählt, dass man das Buch nach seinem abrupten Ende verärgert zuschlägt. Selbst
Camilleris Sprache spiegelt diese Oberflächlichkeit wieder, wenn man Sätze lesen
muss wie: „Die Toten betrugen zehn“. |
Andrea
Camilleri |
|
|
|
|||