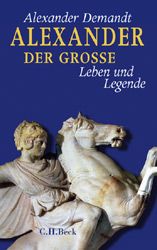|
|
Anzeige Versandkostenfrei bestellen! Versandkostenfrei bestellen!
Die menschliche Komödie als work in progress Ein großformatiger Broschurband in limitierter Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. |
||||
|
Home Termine Literatur Blutige Ernte Sachbuch Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Bilderbuch Comics Filme Preisrätsel Das Beste | |||||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Klassiker-Archiv Übersicht Shakespeare Heute, Shakespeare Stücke, Goethes Werther, Goethes Faust I, Eckermann, Schiller, Schopenhauer, Kant, von Knigge, Büchner, Marx, Nietzsche, Kafka, Schnitzler, Kraus, Mühsam, Simmel, Tucholsky, Samuel Beckett  Berserker und Verschwender Berserker und VerschwenderHonoré de Balzac Balzacs Vorrede zur Menschlichen Komödie Die Neuausgabe seiner »schönsten Romane und Erzählungen», über eine ungewöhnliche Erregung seines Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie von Johannes Willms. Leben und Werk Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten Romanfiguren. Hugo von Hofmannsthal über Balzac »... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit Shakespeare da war.» Anzeige  Edition
Glanz & Elend Edition
Glanz & ElendMartin Brandes Herr Wu lacht Chinesische Geschichten und der Unsinn des Reisens Leseprobe Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch »We've got all the right enemies.» |
Schon der Römer Arrian sah sich von seinen Zeitgenossen mit der Frage konfrontiert, was denn wohl eine weitere Alexanderbiografie noch rechtfertigen könnte. Das war immerhin fast ein halbes Jahrtausend nach dem frühen Tod des großen Makedonen in Babylon. Zum Glück ließ sich Arrian nicht von seinen Kritikern beirren, denn seine auf dem verloren gegangenen Bericht des Ptolemaios beruhende Lebensbeschreibung Alexanders ist heute – außer der kürzeren Darstellung Plutarchs - die einzige brauchbare Quelle über Leben und Feldzüge des antiken Universalherrschers, der die Grenzen der damaligen Welt neu absteckte. Auch sein jüngster Biograf, der Berliner Emeritus für Alte Geschichte, Alexander Demandt, wollte und konnte der Frage nach dem „cui bono“ nicht ausweichen. Ging es ihm doch in seiner Studie keineswegs nur darum, nach dem bewährten Schema der Althistoriker auf der Grundlage einer kritischen Diskussion der verfügbaren Quellen ein halbwegs plausibles Tatsachengerüst zu zimmern. Vielmehr befasst sich Demandt auch mit den weniger brauchbaren oder gar frei erfundenen Nachrichten über den titannenhaften Bezwinger Asiens, die gleichwohl im Laufe späterer Jahrhunderte ihre historische Rolle gespielt haben. Den Spuren des Alexanderromans folgend liefert er somit auch eine facettenreiche Geschichte von Alexanders langem Nachleben und den abenteuerlichen Umdeutungen, die der noch Homers Götterwelt verpflichtete Heide seit der Spätantike im Christentum erfahren hat. Dem europäischen Mittelalter galt der Makedone als idealer und gerechter Herrscher und selbst im islamischen Raum genoss er als Iskander allergrößte Bewunderung. Natürlich machten ihn orientalische Schriftsteller wie der Perser Nizami, der im 13. Jahrhundert lebte, ohne jeden anachronistischen Skrupel zu einem Moslem und noch auf der südostasiatischen Halbinsel Malakka führten sich die lokalen Herrscher voller Stolz auf Alexander zurück. So drang sein Name noch viel weiter nach Osten, als es die Füße seiner erschöpften Truppen je vermocht hätten. Dem ruhmsüchtigen Makedonen hätte es gefallen. Der ehrgeizige Welteroberer, der erst am nordindischen Hyphasis seinen spektakulären Siegeszug hatte abbrechen müssen, wurde rasch von den unterschiedlichsten Kulturen noch an den Rändern des gewaltigen eurasischen Raumes als Lichtgestalt vereinnahmt. Entdeckte doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts die preußische Turfan-Expedition sogar Fragente eines mongolischen Alexanderromans. Von Java bis nach Island spannte sich schließlich ein Kaleidoskop von Legenden und Fabeln um den großen Makedonen, in denen sich Chronologie und Geographie bunt vermischten. Demandt resümiert dazu knapp: Der Alexanderroman sei das vor Gutenberg am häufigsten übersetzte, am weitesten verbreitete, am meisten gelesene und bebilderte Buch der Weltliteratur. Der überlieferte literarische Stoff übertrifft das historische Material gleich um das Dreifache und erst die Entwicklung der Geschichtswissenschaft zu einer kritischen Disziplin mit exakten Methoden scheint auch der unermüdlichen Fabulierwut der Literaten und Künstler ein Ende bereitet zu haben. Selbst das, was von seinem Leben und Taten als gesichertes Faktum gilt, liest sich als schier übermenschliche Bilanz einer Ausnahmeerscheinung. Überrannte doch Alexander in den dreizehn Jahren seiner bewegten Herrschaft nicht nur das bis dahin größte Weltreich der Geschichte, er verdoppelte auch das völkerkundliche und geographische Wissen seiner Zeit und schuf nicht zuletzt durch eine offenbar kluge Politik des Ausgleichs zwischen Griechen und Asiaten einen einzigartigen eurasischen Kulturraum, für den der Historiker Gustav Droysen im 19. Jahrhundert den Begriff Hellenismus prägte. Gäbe es nicht zeitnahe Münzen und Inschriften des Makedonen, man wäre versucht, Alexander wie seine großen Vorbilder Herakles und Achill als bloße Legende abzutun. Über die Ursachen seiner beispiellosen militärischen Erfolge erfährt der Leser indes nur wenig. Griechen kämpften immerhin auf beiden Seiten und griechische Söldner bildeten sogar den Kern der der gegen Alexander aufgebotenen Perserheere. Demandts wiederholte Hinweise auf dessen persönliche Tapferkeit, seine Entschlussfreude und sein Glück helfen da nicht wirklich weiter. Ob die auch von ihm als bare Münze berichteten Zweikämpfe des Königs in den drei Hauptschlachten gegen die Perser wirklich so stattgefunden haben, muss bei Heeren von mehreren Zehntausend Mann auf beiden Seiten doch bezweifelt werden. Für antike Autoren war dies jedenfalls ein beliebter Topos, ebenso wie die rasche Formierung von Gassen in der Phalanx, wenn sichelbewehrte Streitwagen oder Elefanten anstürmten. Demandt referiert hier aber nur die notwendigsten Fakten und verharrt im Oberflächlichen. Die offenbar ausgeklügelte Logistik der makedonischen Militärmaschinerie bleibt fast völlig im Dunkeln. Immerhin erfährt der geduldige Leser, dass Alexander der erste Feldherr gewesen sei, der eine ganze Bibliothek mit ins Feld genommen hat. Napoleon tat es ihm später gleich, gelangte aber gleichwohl nur bis nach Ägypten. Indien blieb für ihn ein Traum und auch für Alexander war das Land zweitausend Jahre zuvor keine angenehme Erfahrung. Die mitgeführte Ilias und die Odyssee dürften ihm in dem gebirgigen und von reißenden Flüssen durchströmten Land nur wenig genützt haben. Fast fünf seiner 13 Regierungsjahre musste der Makedone in der ehemaligen persischen Provinz Baktrien verbringen, widerspenstige Bergstämme bekämpfen und zahllose Stützpunkte anlegen, ehe seine Soldaten am Hyphasis zu meutern begannen. Gleichwohl war Alexander der letzte europäische Feldherr, der sich am Hindukusch militärisch behaupten konnte – sieht man einmal von seinem Diadochen Antiochos III. ab, der vielleicht aber auch kein Europäer mehr war. Jedenfalls blieb dem Makedonenherrscher – anders als Briten und Russen und vielleicht auch der NATO - der schimpfliche Abzug aus Afghanistan erspart. Als Demonstration seiner Macht ließ Alexander eine gewaltige Flotte bauen und fuhr den Indus hinab zum Ozean, womit nebenbei der geographische Beweis erbracht war, dass dieser gewaltige Strom nicht mit dem Nil zusammenhing. Demandt referiert knapp die wichtigsten Etappen im Leben seines Protagonisten, vermeidet aber ausführliche Debatten und schließt viele Spekulationen, wie etwa die über Alexanders sexuelle Orientierung mit einem trotzigen „nihil interest“ ab. Viel lieber nutzt der Verfasser jede sich bietende Gelegenheit, in seine Darstellung ausführliche kulturgeschichtliche Exkurse über fast alle von Alexander berührten Orte einzuflechten. Ob Demandt dabei nicht allzu häufig übertreibt – immerhin nehmen seine Abschweifungen fast die Hälfte des Textes ein – ist sicherlich eine Geschmacksfrage, doch die daraus regelmäßig resultierende Unterbrechung des narrativen Strangs ist fraglos ein Kritikpunkt. Auch dürfte sich mancher Leser etwas mehr Distanz des Autors zu seinem „Helden“ gewünscht haben, dem er dessen Reue nach dem Totschlag von Kleitos im Vollrauch hoch anrechnet: Welcher andere Staatsmann habe je eine Verfehlung so unumwunden zugegeben? Doch warum ordnete er die brutale Ermordung Parmenions an, einem bewährten wenn auch nicht immer erfolgreichen General, der schon seinem Vater gedient hatte? Hätte nicht seine bloße Gefangennahme genügt? Zwar räumt Demandt Alexanders Ruhmsucht ein, macht ihn aber, der einst auszog, die Rache der Griechen an den Persern zu vollziehen, schließlich zum Protagonisten einer die gesamte zivilisierte Welt umspannenden Universalmonarchie, wie sie später unter Augustus weitgehend realisiert wurde. Ob dies aber tatsächlich das letzte Ziel des Eroberers gewesen war, muss angesichts seines frühen Todes im Jahre 323 v. Chr. reine Spekulation bleiben. Demandt ist jedenfalls zu widersprechen, wenn er im Anschluss an Arnold Toynbees kontrafaktische Geschichtsspekulation (der Eroberer starb demnach erst im Jahre 287 v. Chr.) in euphemistischen Tönen von der keineswegs „unsinnigen Idee“ eines Weltstaates spricht, deren Begründer sein kosmopolitischer Held vielleicht hätte sein können. Das Resultat wäre jedoch damals wie heute – im Zeitalter einer drohenden Globalisierung - ein Völkergefängnis ohne langen Bestand gewesen. Hier befindet sich Demandt, der selbst gerne kontrafaktische Betrachtungen in seine Darstellungen einflechtet, ganz eindeutig auf ideologischen Abwegen.
Gleichwohl ist sein Buch
über Alexander eine gelungene Mischung aus Biografie und kulturgeschichtlichem
Reiseführer. |
Alexander Demandt |
|||
|
|
|||||