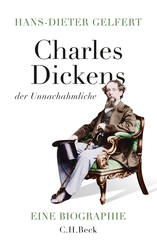|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher & Themen Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links |
Er hinterließ zehn Kinder, 14 voluminöse Romane, etliche Novellen und ein beachtliches Vermögen von 93.000 Pfund, das nach heutigen Maßstäben einem zweistelligen Millionenbetrag entspräche. Die Rede ist von dem viktorianischen Dichter Charles Dickens, der am 7. Februar 1812 in bescheidenen – aber durchaus nicht ärmlichen – Verhältnissen als Sohn eines britischen Marinezahlmeisters geboren wurde und im Laufe seines 58-jährigen Lebens zu dem wohl geschäftstüchtigsten Dichterfürsten Europas aufstieg. Der offenbar sein Leben lang psychisch an seiner frühen Verstoßung aus dem Kreis seiner Familie leidende Dickens - er hatte vorübergehend im zarten Alter von zwölf Jahren in einer mit Ratten verseuchten Londoner Firma am Ufer der Themse mit dem Bekleben von Schuhwichsflaschen das Familieneinkommen aufbessern müssen - war nach den Worten seines deutschen Biografen Hans-Dieter Gelfert ein Multitalent, der mit seiner ungewöhnlich reichen literarischen Produktion keineswegs ausgelastet zu sein schien. Mit vergleichbarem Erfolg betätigte er sich auch als Bühnenautor und Schauspieler, wobei er gelegentlich sogar Queen Victoria zu seinen Zuschauern rechnen konnte. In einem boomenden Markt für Bücher und Zeitschriften bediente Dickens mit seiner bildreichen Prosa bestens die Bedürfnisse eines moralisierenden Publikums viktorianischer Herrenmenschen, das sich im Einvernehmen mit Gottes Schöpfung fühlte und mit religiös inspiriertem Dünkel auf das wachsende Heer der Armen und „gefallenen Frauen“ fern der feinen Gesellschaft herabsah. Dickens brachte in seiner literarischen Produktion das Kunststück fertig, so Gelfert, der viktorianischen Gesellschaft ihre Mängel „um die Ohren zu hauen“ und sich gleichzeitig mit ihr vollständig zu identifizieren. Für den modernen Geschmack allerdings gehören Dickens Romane mit ihren unwahrscheinlichen Wendungen zu einer längst überholten romantischen Weltsicht. Darin ändert auch ihr sozialkritischer Einschlag nichts. Trotz ihrer Frontstellung gegenüber der beginnenden Industrialisierung wurden Dickens Romane und Novellen schon von manchem kritischen Zeitgenossen als sentimentaler Kitsch abgetan. Dickens selbst soll bei der Niederschrift seiner Weihnachtsnovelle „The Chimes“ emotional so stark engagiert gewesen sein, dass er nach deren Abschluss heftig weinen musste. Allein sein stets humorvoller und atmosphärisch dichter Stil bewahrte seinen Romanen ihren Rang in einer lesefreudigen Epoche, in der seine zunächst in Fortsetzung erscheinenden Geschichten geradezu verschlungen wurden. Was aber war außer seiner virtuosen Sprache so bemerkenswert an Dickens Ouevre? Der Berliner Emeritus für Anglistik glaubt in Dickens Werken durchgängig drei zentrale Motive identifizieren zu können, die der Dichter im Laufe seines Schaffens immer wieder nur neu kombiniert und damit zu einem eigentümlichen Kosmos verwoben hat. Dazu zählt das Gefängnis oder ein meist gefängnisartiges Gebäude – vielleicht eine psychologische Reminiszenz an seine erste Arbeitsstätte. Ebenso spielt das Wasser -wahlweise das der Themse oder einer stürmischen Nordseeküste - eine gewichtige Rolle als Ort des Gesinnungswandels und der Läuterung seiner Protagonisten. Daneben tauchen in seinen Romanen immer wieder Personen mit einer geheimen Herkunft auf, die sich erst im Verlauf des Plots vollständig klärt oder aber es beschäftigen mysteriöse Erbschaften die Phantasie des Lesers. Während mit diesem Motiv durchaus auch Lasten der Vergangenheit gemeint sein können, von denen sich Dickens Helden im Laufe der Plots allmählich befreien, unterstreicht das Motiv des Gefängnisses, oft auch variiert als düsteres und heruntergekommenes Landhaus, immer wieder deren völlige Isolation. Unschuldige Kinder, die meist als Gefangene hartherziger und bigotter Psychopathen ein erschreckendes Dasein fristen mussten, waren ein Motiv, das ein tränenseliges Publikum – das gleichwohl Kinderarbeit als soziale Realität akzeptiert hatte - immer wieder zu rühren vermochte. Die zum Schluss einsetzende Läuterung gerät dagegen ganz im Sinne der Standards einer viktorianischen Gesellschaft, in der weibliche Häuslichkeit und das wohl inszenierte Opfer ganz oben in der moralischen Werteskala standen. Ob sich allerdings, wie der Biograf glaubt, aus diesen verschlüsselten Subtexten von Gefangenschaft, Befreiung und Läuterung eine Modernität des populären Vielschreibers destillieren lässt, die aus Dickens sogar einen Vorläufer Kafkas macht, wäre noch die Frage. In den Synopsen von Dickens Werken, die Gelfert als Ergänzung jedem seiner streng chronologischen Kapitel anfügt, wirken Handlung und Charaktere seiner Protagonisten ohne das „literarische Fleisch“ eher holzschnittartig und für einen modernen Leser kaum noch attraktiv. Leidende Kindfrauen wie „Little Nellie“ spielten bei Dickens allerdings nicht nur literarisch eine Rolle, wie es die lange geheim gehaltene Liaison des Mittvierzigers mit der damals 18-jährigen Schauspielerin Ellen Ternann belegt. Dass sich der alternde Dickens etwa zu selben Zeit nach 20 Ehejahren von seiner Frau trennte und nach einem Streit sogar fluchtartig das gemeinsame Londoner Stadthaus verließ, hatte nach Gelferts Meinung vor allem damit zu tun, dass die mittlerweile matronenhaft wirkende Catherine Hogarth nach zehn Schwangerschaften und einem unselbständigen Leben an der Seite eines getriebenen und gefeierten Dichters sich zu deutlich von dem typisch viktorianischen Kindfrauenideal ihres Mannes entfernt hatte. Das mag zynisch erscheinen gemessen an Dickens eigenen moralischen Standards, der sich stets als Wohltäter mit einem sozialen Gewissen zu inszenieren verstand, aber nie auch nur einen kleinen Teil seines beträchtlichen Vermögens für Bedürftige aufgewendet hat. In dieser bigotten Gebrochenheit war Dickens ein schon beinahe archetypischer Vertreter der viktorianischen Ära.
Gelferts keineswegs
hagiographische Darstellung von Charles Dickens, dessen Romane hierzulande
bisher meist nur als populäre Schriften wahrgenommen wurden, füllt nicht nur
eine Lücke auf dem deutschen Markt. Für den Leser hat Gelferts recht knappe
Darstellung den Vorteil einer klaren Gliederung, in der jedem Lebensabschnitt
seines Protagonisten das jeweils wichtigste Werk zugeordnet und ausführlich
besprochen wird. Seine Studie lässt sich somit als Handbuch wie auch als
klassische Biografie nutzen. Wie bei allen Kompromissen müssen daher Abstriche
hingenommen werden. Die von guten Biographien gewohnte atmosphärisch dichte
Beschreibung von Dickens Leben erreicht Gelfert nur im ersten Teil seines
Buches. Zum Ende hin verflüchtigt sich der biografischen Charakter seiner
Schilderung, die –von ausführlichen Werkzusammenfassungen unterbrochen - nur
noch buchhalterisch die wichtigsten Eckdaten referiert, den Leser aber kaum noch
an den Text zu binden vermag. Hervorzuheben ist dagegen der reichhaltige Anhang
mit allen Biogrammen der Verwandten und wichtigsten Freunde Dickens sowie einer
ausführlichen Zeittafel, die in tabellarischer Form noch einmal Lebensdaten und
Werke des Dichters zusammenfasst.
|
|
|
|
|
|||