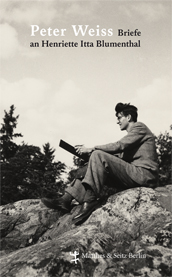|
Home Termine Autoren Literatur Blutige Ernte Quellen Politik Geschichte Philosophie Zeitkritik Sachbuch Bilderbuch Filme Töne Preisrätsel |
|||
| Glanz&Elend Literatur und Zeitkritik |
Anzeige  Glanz&Elend Glanz&ElendDie Zeitschrift kommt als großformatiger Broschurband in einer limitierten Auflage von 1.000 Exemplaren mit 176 Seiten, die es in sich haben. Ohne Versandkosten bestellen! |
||
|
Bücher-Charts l Verlage A-Z Medien- & Literatur l Museen im Internet Glanz & Elend empfiehlt: 50 Longseller mit Qualitätsgarantie Jazz aus der Tube u.a. Sounds Bücher, CDs, DVDs & Links Andere Seiten Quality Report Magazin für Produktkultur Elfriede Jelinek Elfriede Jelinek Joe Bauers Flaneursalon Gregor Keuschnig Begleitschreiben Armin Abmeiers Tolle Hefte Curt Linzers Zeitgenössische Malerei Goedart Palms Virtuelle Texbaustelle Reiner Stachs Franz Kafka counterpunch «We've got all the right enemies.« |
Peter
Weiss' Briefe an Henriette Itta Blumenthal Angela Abmeier und Hannes Bajohr legen mit diesem Band 21 bislang unveröffentlichte Briefe von Peter Weiss an Henriette Itta Blumenthal vor. Geschrieben zwischen April 1941 und Mai 1943, reflektiert Weiss darin seine Lebenskrise, die Auseinandersetzung mit den Eltern, den Tod der Schwester Margit, den Krieg und seine Suche nach einer glücklichen Liebe, die sich in zahlreichen Liebschaften erschöpft, bevor er im letzten Brief seine Bekanntschaft mit Helga Henschen anspricht. Doch auch die Ehe mit der schwedischen Künstlerin wird letztlich scheitern. Die Themen seiner autobiografisch angelegten Romane aber sind bereits in den Briefen an die 1904 als Henriette Rosenberg im heutigen Karviná (Fryštát/Tschechien) geborene Freundin zu finden. Früh verheiratet und rasch geschieden, emigrierte die Blumenthal im Oktober 1941 von Göteborg aus in die USA, wo sie sich zur Psychoanalytikerin ausbilden ließ. 1995 starb sie in New York. Weiss schreibt ihr aus dem etwa 50 Kilometer nordöstlich von Göteborg gelegenen Alingsås, wohin es die Familie in erster Linie aus wirtschaftlichen (nicht zuletzt aber wohl auch aus politischen) Gründen zog. Vor allem den tödlichen Unfall der jüngeren Schwester 1934 erlebt Weiss, wie er in »Abschied von den Eltern« (1961) schildert, als »Anfang von der Auflösung unserer Familie«. In »Fluchtpunkt« (1962) reflektiert er seine Familiengeschichte als gänzlich missglückten Versuch des Zusammenlebens, »in dem die Mitglieder einer Familie ein paar Jahrzehnte lang beieinander ausgeharrt hatten.« Der Ich-Erzähler fühlt sich als Versager, der in einem »Zustand der Umnachtung« dahinvegetiert. Gleich im ersten Brief an die Blumenthal ist dieses Bild präfiguriert, wenn Weiss gesteht, er führe einen »Kampf gegen große Dunkelheit« und im folgenden Brief ergänzend hinzufügt, die Bindung ans Elternhaus sei furchtbar. Er müsse seine Persönlichkeit finden und sei zugleich auf der Flucht, wobei ihn eine »furchtbare Scheu vor den Menschen«, insbesondere vor den Frauen begleite. Hinzu kämen Ängste, Schmerzen, Schüchternheit. Im dritten Brief vergleicht er sich mit Michael Kohlhaas, der um sein Recht kämpfen müsse. Wer weiß, wie unerbittlich Kohlhaas diesen Kampf geführt hat, ahnt, welch großes Chaos der Gefühle den jungen Künstler heimgesucht haben muss. Er will sich »beweisen — oder zugrunde gehen.« Doch habe er weiterhin, so gesteht er im vierten Brief, kein Vertrauen zu Menschen. »Ich spreche nur von mir«, »Ich fange ja erst an, Mensch zu werden« und bin »immer noch weltfremd« — Sätze, die Ausdruck dieses Vertrauensverlusts sind; eines Verlusts, dessen Ursachen er zeitlebens in seiner eigenen Kindheit suchen wird. Hierzu passt die Situation, die er in Brief 4 erzählt. Denn er habe sich, so schreibt er, »im Wald verlaufen« und sei von wilder Angst befallen worden. Nur mit Mühe und »voller Todesgrauen« habe er den Weg zurück gefunden. Dieser Wald war sein Leben. Sein »Missverhältnis zu den Eltern« sowie die »kalte Fremdheit« zwischen den Familienmitgliedern spielen ebenfalls im sechsten Brief eine entscheidende Rolle. Als Kind sei er, so Weiss schließlich im siebten Brief, »jahrelang fast völlig stumm« gewesen, habe »im Schlaf geschrien« und sei »immerwährend krank gewesen.« Nun brauche er einen Arzt, denn auch »Amerika kann mich … nicht heilen.« Das bezieht sich auf die immer wiederkehrende Überlegung, es der Blumenthal gleichzutun und Schweden, Europa hinter sich zu lassen. Stattdessen aber setzt er sich in ein Boot, treibt auf dem nahe gelegenen See herum und wünscht sich »nichts sehnlicher als einzuschlafen und nie mehr zu erwachen«, wie Brief 8 berichtet. Im folgenden Brief räumt er ein, er hielte andere Menschen um sich herum auch gar nicht aus, denn er mache, so Brief 10, »einen Verwandlungsprozess durch«, alles in ihm sei »in Bewegung«. Diese Unruhe deutet er in Brief 16 als »eine Neurose, von der ich mich befreien will durch die Analyse. Ich sehe nun einen wichtigen Bestandteil dieser Analyse gerade im Schriftlichen, denn gerade durch das Schreiben, denke ich alles noch einmal durch … Ich bin nun einmal eine Dichternatur«, die die Auflehnung und Empörung gegen die Mutter seit frühester Kindheit ebenso verarbeiten müsse wie die verlorene, abgewiesene Liebe: »Ich werde meine Mutter doch in einer anderen Frau suchen müssen, die mir zugleich Geliebte ist.« Seine unerfüllt gebliebenen Liebschaften in dieser Zeit mögen Ausdruck dieser Suche sein, doch erkennt er schließlich in Brief 19, die Trennung von der Familie müsse jetzt (!) stattfinden. Gelingen wird ihm diese Trennung nie, auch wenn er literarisch Abschied nehmen mag nach dem Tod der Eltern. Über den toten Vater schreibt er später gar als »Leichnam eines Mannes in der Fremde«, der nicht mehr erreichbar ist, dessen Schläge aber als »schreckhafte Umarmung« in Erinnerung bleiben und die Suche nach dem eigenen Leben neu befeuern, bis er zuletzt an seiner »Wunschbiografie«, der »Ästhetik des Widerstands« arbeitet.
Die Briefe an die
Blumenthal können indes als frühe Skizzen seiner autobiografischen Romane
gelesen werden, die zu einer Zeit entstanden, als Peter Weiss sich primär als
bildenden Künstler und noch nicht als Schriftsteller verstand. Es ist das
Verdienst der Brief-Edition, diesen Aspekt beleuchtet zu haben. Und man fragt
sich, warum diese aufschlussreichen Briefe erst jetzt erscheinen. |
Peter Weiss
|
|
|
|
|||