|
Bücher & Themen

Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Glanz & Elend
empfiehlt:
50 Longseller mit
Qualitätsgarantie
Jazz aus der Tube u.a. Sounds
Bücher, CDs, DVDs & Links
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.»

|
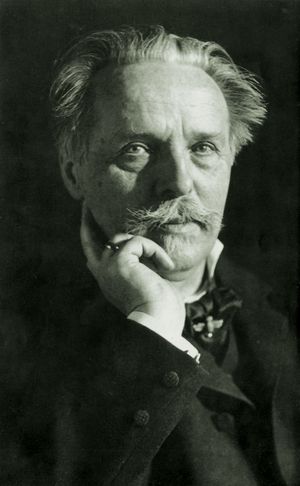 Karl
Mays Inferno Karl
Mays Inferno
Das denkwürdige Interview
von Egon Erwin Kisch mit Karl May am 9. Mai 1910, in der Villa
Shatterhand zu Radebeul bei Dresden.
Von Jürgen Seul
Der junge
Reporter Egon Erwin Kisch steht an diesem frühen Montagmorgen vor
einer Villa in der Kirchstraße 5. An der Vorderseite des noblen
Anwesens ranken Glyzinien empor, auf goldenen Lettern prangt der
Name des Hauses: »Villa Shatterhand«. Zwei kleine Messingschilder
befinden sich am Eingangstor; »May« besagt das eine, während das
andere fremden Besuch nur gegen vorausgegangener Vereinbarung
gestattet. Kisch ist
 angemeldet.
Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des
Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so
berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von
Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden
getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar
machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,
erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß
Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’« angemeldet.
Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des
Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so
berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von
Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden
getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar
machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,
erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß
Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«
Empfangssalon in der Villa Shatterhand
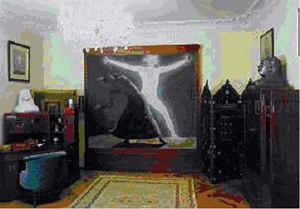 Kisch
erinnert
daran, daß sein Besuch inklusive Interview-wunsch angekündigt sind.
Er wird in den Salon geführt, der mit riesengroßen Zeichnungen des
Malers Sascha Schneider ausstaffiert ist. Bric-àbrac aus Wachsstein
und chinesisches Porzellan, indianische Holzskulpturen und Vitrinen
mit phönizische Steinstatuetten füllen den großen Raum. Die
Zimmerdecke schneidet ein geflochtener Wandschirm voll Koransprüche;
auf einer Etagere liegen ein rottönernes Kalumet, ein
Rosenölfläschchen sowie ein Kranz türkischer Gebetskugeln. Bunte
Exotik, wohin das Reporterauge blickt. Kisch
erinnert
daran, daß sein Besuch inklusive Interview-wunsch angekündigt sind.
Er wird in den Salon geführt, der mit riesengroßen Zeichnungen des
Malers Sascha Schneider ausstaffiert ist. Bric-àbrac aus Wachsstein
und chinesisches Porzellan, indianische Holzskulpturen und Vitrinen
mit phönizische Steinstatuetten füllen den großen Raum. Die
Zimmerdecke schneidet ein geflochtener Wandschirm voll Koransprüche;
auf einer Etagere liegen ein rottönernes Kalumet, ein
Rosenölfläschchen sowie ein Kranz türkischer Gebetskugeln. Bunte
Exotik, wohin das Reporterauge blickt.
Mays Bibliothek
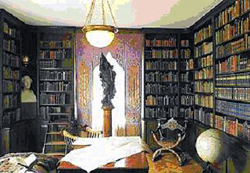 Kisch
wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie
Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen
ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen
Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen
einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und
Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung
seiner Arbeit widmen kann. Kisch
wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie
Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen
ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen
Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen
einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und
Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung
seiner Arbeit widmen kann.
Für diesen jungen Reporter von der angesehenen deutschsprachigen
Zeitung ‚Bohemia’ aus Prag nimmt sich der Meister an diesem Tag
selber Zeit. Karl May erscheint; ein nicht sehr großer 68-jähriger,
leicht untersetzter Herr mit silbergrauem schütteren Haar und grauem
gepflegtem Schnurrbart, soigniert gekleidet mit einem
grünschillernden Skarabäus in der Krawatte.
Mays Intimfeind,
Rudolf Lebius
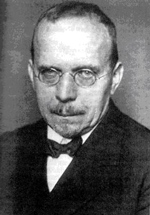 Das
Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen
erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der
Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910
überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der
Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen
»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung
verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die
Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp
sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –
»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der
berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als
ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler
bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine
kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte
Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,
eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in
Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat. Das
Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen
erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der
Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910
überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der
Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen
»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung
verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die
Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp
sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –
»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der
berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als
ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler
bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine
kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte
Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,
eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in
Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat.
Der junge Reporter will wissen, was es denn mit all diesen
Behauptungen des Rudolf Lebius auf sich hat.
»Ich bin vorbestraft«, bekennt Karl May. »Allerdings habe ich meine
Strafen schon vor fünfzig Jahren abgebüßt.«
Das stimmt zeitlich nicht ganz. Die letzte Straftat wegen
Amtsanmaßung verbüßte der Schriftsteller 1879. In der Öffentlichkeit
äußert er sich nie konkret zu seinen Taten. Er hat bereits Erfolg
versprechende Klagen gegen Lebius während der Verhandlung
zurückgezogen, als aus seinem Vorstrafenregister vorgelesen wurde.
Zu tief wurzelt seine Angst, daß alle Einzelheiten der Vergangenheit
ins Licht der Öffentlichkeit gezerrt werden. Und gerade Lebius zerrt
gewaltig, reist inkognito durchs Land, um frühere Zeitzeugen
auszuhorchen; auch Mays geschiedene erste Ehefrau gehört zu den
Informanten. Aus dem Sammelsurium von Gerüchten und Halbwahrheiten
braut Mays Intimfeind – gelegentlich unter falschem Namen –
regelmäßig ein Sensationssüppchen, von dem die Öffentlichkeit
gleichermaßen amüsiert und angewidert ihren Teil löffelt. Das Fatale
an Lebius’ Revolverjournalismus ist die Tatsache, daß auch ein Stück
Wahrheit hinter allen biografischen Verzerrungen und künstlichen
Aufgeregtheiten steckt.
Es sind
deutlich über 30 gerichtliche Verfahren, Anzeigen und Klagen, die
deswegen im Laufe der Jahre bei den verschiedenen Dresdner und
Berliner Justizinstanzen zwischen May und Lebius an und rechtshängig
werden. Ein Rattenschwanz von Prozessen, der auch zum Dauerthema in
der Presse gehört. Der Urteilsspruch vom 12. April ist der
vorläufige Höhepunkt.
»Der Prozeß in Charlottenburg«, erklärt May trotzig, »hat weder zu
einer Beweisführung noch zu irgendeiner Feststellung geführt. Ich
habe weder etwas eingestanden, noch sind Zeugen einvernommen worden,
noch hat man irgendwelche Dokumente vorgelegt. Trotzdem wird in
Hunderten von Blättern behauptet, ich hätte alles zugegeben, die
Zeugen hätten das alles bestätigt und die Dokumente hätten alles
erwiesen, was mir vorgeworfen worden ist. Das sind Lügen, die bei
der Verhandlung in zweiter Instanz ans Tageslicht kommen werden. Ich
fühle mich keineswegs als Besiegter, sondern bin vollständig davon
überzeugt, daß ich aus der ganzen Hetze als Sieger hervorgehen
werde.«
Er wird zwar mit dieser Einschätzung in juristischer Hinsicht recht
behalten, aber die Verfehlungen der jungen Jahre nie wirklich
überwinden können. Die Besonderheit bei Karl May liegt in der
Tragik, daß er als junger Mann im Grunde wegen jugendlicher
Unbedachtheit und Renommiersucht eine Leichtsinnstat beging, für die
er übermäßig hart bestraft wurde (6 Wochen Gefängnis für den
angeblichen Diebstahl einer Taschenuhr).
Der Versuch als Lehrer – der May ursprünglich war – arbeiten zu
können, war schon nach dieser ersten Bestrafung aufgrund eines
Berufsverbots zunichte gemacht worden. Eine ehrliche andere Arbeit
hat sich ihm vermutlich wegen der Vorstrafe zunächst nicht mehr
geboten. Aus Frustration über die berufliche und gesellschaftliche
Ausgrenzung war Karl May anschließend tatsächlich zum Hochstapler
und Dieb geworden. Auffällig war vor allem sein Auftreten in
verschiedenen hochstaplerischen Rollen als vermeintlicher Arzt, als
angeblicher Polizeileutnant und ähnlichen Rollen, in denen er Pelze
erschwindelte oder vermeintliches Falschgeld konfiszierte.
Gelegentlich wurden auch einfach nur einmal ein Pferd oder
Billardbälle gestohlen. Mehrfach wurde monatelang nach May
gefahndet.
In der Zeit zwischen 1862 und 1879 wurde Karl May vier Mal zu
Freiheitsstrafen verurteilt. Die ersten drei Male (1862, 1865 und
1870) wegen Diebstahls und mehrfachen Betruges, die er u. a. im
gefürchteten Zuchthaus Waldheim abgesessen hat. Aber das ist jetzt
lange her.
»Und darf man
wissen,« fragt Kisch weiter, »woher Lebius von Ihren Vorstrafen
weiß?«
Das hänge, so meint May, mit einem anderen mehrteiligen
Mammutprozess zusammen, den er seit 1902 mit der Witwe seines
früheren Verlegers Heinrich Gotthold Münchmeyer führe. Bei diesem
zusammenhängenden Komplex von Verfahren handelt es sich um eine
Auseinandersetzung wegen ausstehendem Honorar für fünf
Kolportageromane und einzelne Erzählungen, die May in den 80er
Jahren für den Verlag geschrieben hat. Über die vielen Jahre und
Instanzen hinweg kommt es immer wieder zum Aufmarsch ganzer
Zeugenkolonnen und zur Vorlage zahlreicher
Sachverständigengutachten, die sich allesamt mit Mays
Honorarforderungen beschäftigen müssen. Der Schriftsteller hat auch
seine mündlichen Abmachungen mit dem verstorbenen Verleger bereits
beeiden müssen. Dadurch gewann er 1907 vor dem Leipziger
Reichsgericht den ersten großen Prozeß.
Doch dieser Sieg hatte wiederum strafrechtliche Verdächtigungen
(Meineidsverdacht) seiner
Gegnerin ausgelöst und die Dresdner Staatsanwaltschaft in Bewegung
gesetzt. Unheilvoller Höhepunkt der Ermittlungen war am 9. November
1907 eine spektakuläre Hausdurchsuchung in der Villa Shatterhand
gewesen. Am Ende war alles wie das Hornberger Schießen ausgegangen:
die Justiz hatte nichts Belastendes gegen Karl May gefunden, doch
dessen Gemüts- und Nervenzustand ist seither arg ramponiert.
Noch immer läuft ein Vollstreckungsverfahren gegen die
Münchmeyer-Seite. Es wird erst nach Mays Tod zum Abschluß kommen und
der Witwe die Auszahlung von 60.000 Mark bescheren.
»Ich
beanspruche von Münchmeyer dreihunderttausend Mark für meinen Roman
‚Das Waldröschen’, die ich übrigens nicht für mich, sondern für eine
Witwen- und Waisenstiftung verwenden will,« berichtet der
Schriftsteller. »Der Verlag weigert sich, das Geld zu bezahlen, und
hat ein Interesse daran, meine Ehrenhaftigkeit in Zweifel zu setzen.
Und der Rechtsanwalt des Herrn Lebius ist gleichzeitig der
Rechtsanwalt des Münchmeyerschen Verlages.«
Letzteres trifft zwar nicht zu, aber tatsächlich lassen sich später
enge Verbindungen – auch der Austausch von Dokumenten – zwischen den
May-Gegnern nachweisen. Man hilft sich im unterschiedlich
motivierten juristischen Kleinkrieg gegen Old Shatterhand respektive
Karl May. Und nachweislich weiß man im Hause Münchmeyer schon seit
Jahrzehnten von Mays Vorstrafen. Doch Diskretion gehörte noch nie zu
den hervorstechendsten Charaktereigenschaften dieser
Verlegerfamilie.
Aber es sind nicht nur Rudolf Lebius und der Münchmeyer-Verlag, die
Karl Mays Lebensabend verdunkeln. In der Presse findet ein
regelrechtes Kesseltreiben gegen ihn statt.
Während man den Schriftsteller jahrzehntelang entweder ignorierte
oder lobte, hat sich seit der Jahrhundertwende vor allem die
bürgerliche Presse – an der Spitze die ‚Frankfurter Zeitung’ und die
‚Kölnische Volkszeitung’ – auf May eingeschossen. Vor allem Mays
Behauptung, daß seine Reiseerzählungen auf wahren Reiseerlebnissen
beruhen würden, wird heftig angegriffen. Diese Mischung aus PR-Gag
und Künstler-Tagtraum erhitzt die Journalistengemüter.
Auch gegenüber seinem Prager Interviewpartner verteidigt May seine
Vorgehensweise: »Ich sende meinen Kara Ben Nemsi, meinen Old
Shatterhand in fremde Länder, um zu zeigen, wie wir als Edelmenschen
dort zu handeln haben. Mir stünde es völlig frei, in der Heimat zu
bleiben, und wenn ich dann trotzdem behaupten würde, in der Fremde
das Erzählte miterlebt zu haben, so ist das keine Lüge. Denn die
Ereignisse spielen sich zu Hause ab, die Fremde ist Imagination. Hat
nicht auch Dante das ‚Inferno’, das ‚Purgatorio’ in Ich-Form
beschrieben, ohne dort gewesen zu sein?«
Benediktinerpater Ansgar Pöllmann
 Vor
allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet
Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor
allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater
Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner
vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.
Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf: Vor
allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet
Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor
allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater
Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner
vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.
Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf:
»Man hat auch gegen Sie den Vorwurf des Plagiats erhoben.«
»Ganz unbegründet«, wehrt sich May. »Was nennen Sie ein Plagiat?«
»Ich denke, daß man es als Plagiat bezeichnet, wenn ein Autor Idee
und Form eines nicht von ihm stammenden Werkes für sich verwendet
und als eigenes Geistesprodukt ausgibt.«
»Das ist nur mit Einschränkungen richtig,« erklärt der
Schriftsteller und erläutert die Rechtmäßigkeit literarischer
Wiederverwendungen von geistigem Gemeingut. Er verweist auch auf
Goethe, Shakespeare und Lessing, die Anleihen bei Kollegen genommen
hätten.
»Sogar die vier Evangelisten erzählen das gleiche, also müssen
wenigstens drei von ihnen Plagiatoren sein. Das Abschreiben würde
mir mehr Schwierigkeiten machen als das eigene Schaffen. Ich habe
Phantasie genug. Mehr als siebzig große Romane sind von mir verfasst.«
Noch an diesem
heutigen Interviewtag erscheint ein weiterer Angriff Pöllmanns, der
von May verklagt werden wird. Wenn auch diese Klage letztlich aus
formalen Gründen scheitert, wird der Schriftsteller als moralischer
Sieger aus dem Streit hervorgehen, kann er doch den frech gegen ihn
agierenden Benediktinerpater als Verbündeten des
Revolverjournalisten Rudolf Lebius demaskieren – durchaus eine
Peinlichkeit für die fromme Geistlichkeit. Alle anderen Prozesse mit
Pressevertretern – stets Beleidigungsklagen – gewinnt May oder er
vergleicht sich schiedlich friedlich. Der juristische Aufwand, den
er dafür aufbringt, die Kosten für Prozesse und Anwälte sind enorm.
Kisch wagt es auch, ein weiteres heikles Thema anzusprechen: »Darf
man, ohne indiskret zu sein, auch fragen, wie es sich mit Ihrer
ersten Frau verhält, die in dem (Charlottenburger) Prozess
wiederholt erwähnt wurde?«
Auch mit ihr hat es zahlreiche juristische Konflikte nach der
Scheidung 1902 gegeben. Der Schriftsteller verbat ihr gerichtlich
das Tragen des bisherigen Familiennamens May, es gibt
Beleidigungsklagen, aber vor allem juristische Verfahren wegen
Rentenzahlungen, die mal gewährt, mal wieder eingestellt werden.
Das Ehescheidungsverfahren hatte neben der Zerrüttung beider
Ehepartner vor allem auch die gemeinsame Freundin Klara Plöhn als
treibende Kraft offenbart, der später nicht zu Unrecht vorgeworfen
wurde, mit Hilfe spiritistischer Tricks und persönlicher Hinterlist
den insgesamt reibungslosen Trennungsablauf begünstigt zu haben.
Zwei Ehescheidungsbetrugsverfahren mußte May deswegen – allerdings
erfolgreich – überstehen, ehe die Trennung von seiner ersten Ehefrau
Emma Pollmer endgültig und in jeder Hinsicht zum Abschluss gebracht
war.
»Sie hat mir viel angetan«, meint May. »Dokumente, welche ich in
einem Prozesse brauchte, hat sie, während ich in Asien war,
verbrannt, weil sie in meinen Prozessgegner, den Verleger
Münchmeyer, verliebt war. Die Ehe wurde aus ihrem Verschulden vor
Gericht geschieden.«
Seit 1903 ist
Klara Plöhn die zweite Frau May und sitzt dem jungen Reporter jetzt
gegenüber. Bezogen auf ihre Vorgängerin hakt Kisch beim Hausherrn
nach: »Es hieß, daß Sie Ihre Frau nicht alimentieren?«
»Das ist erfunden«, protestiert May. »Meine Frau bekam, als sie von
mir wegzog, eine ganze Ausstattung, Möbel und eine Summe von
dreitausend Mark jährlich. Eines Tages schrieb mir der Schwager des
Lebius im Namen meiner geschiedenen Frau, daß sie auf den jährlichen
Zuschuss von dreitausend Mark verzichte. Kurze Zeit später gab sie
an, daß sie von dieser Verzichtleistung überhaupt nichts wisse.
Lebius hatte den Brief schreiben lassen, um sie für sich zu
gewinnen, damit sie bei Gericht gegen mich zeuge; er versprach ihr
hundert Mark monatlich, solange sie lebe, sie mußte bei seiner
Familie wohnen und erhielt im ganzen von ihm zweihundert Mark. Als
sie mich bat, ich möge sie wieder aufnehmen, drohte ihr Lebius, er
werde sie auf dreihundert Mark verklagen. Jetzt zahle ich meiner
Frau freiwillig zweitausendvierhundert Mark jährlich aus, trotzdem
sie sich mit Lebius gegen mich verbündet hat.«
Und damit schließt sich wieder der Kreis, der mit dem Prozessgegner
des Charlottenburger Verfahrens begonnen hat. Der Name Rudolf Lebius
schwebt in diesen Jahren als ständig aktives Feindbild über Karl
May.
Für Kisch endet damit das Interview. Er läßt sich noch die berühmten
Gewehre Silberbüchse, Henrystutzen und Bärentöter zeigen, die sich
Karl May von einem Dresdner Büchsenmacher als romangetreue
Nachbildungen hat anfertigen lassen. Anschließend geht es in den
großen Garten der Villa. Es regnet. Tropfen glitzern auf den
Blättern der zahlreichen Kirchbäume, den gepflegten Kieswegen und
den Bänken.
In seinem
Artikel, den Egon Erwin Kisch am 15. Mai veröffentlicht, wird über
Karl May abschließend zu lesen sein: »Eben schüttelt ihn ein
Hustenanfall, und trotzdem er, die Hilfe der Gattin unwirsch
abweisend, aufrecht ins Haus zurückgeht, ist nicht zu verkennen, daß
sein Lächeln vom hippokratischen Zug erbarmungslos durchstrichen
wird.«
Es ist eine
Vorahnung.
Zunächst wird
das Berufungsgericht zum Fall der Beleidigung als »geborener
Verbrecher« am 18. Dezember 1911 in Berlin-Moabit nicht nur das
erstinstanzliche Skandalurteil von Charlottenburg korrigieren und
Lebius zu 100 Mark Geldstrafe verurteilen, sondern May auch als
moralischen Sieger über seinen Intimfeind triumphieren lassen. Doch
nur vier Monate später, am 30. März 1912, stirbt der Schriftsteller
im Alter von 70 Jahren in seiner Villa Shatterhand an den Folgen
einer Lungenentzündung. Geblieben sind bis heute ein häufig
belächelter, aber beachtlicher Platz in der deutschen
Literaturgeschichte mit einer Weltauflage von ca. 200 Millionen
Bücher, eine Karl-May-Gesellschaft mit über 1800 Mitgliedern, eine
Karl-May-Stiftung und ein Karl-May-Verlag.
Anders als bei Lebius, Münchmeyer und Pöllmann – Namen, die im
Bewusstsein der Öffentlichkeit längst vergessen sind – ist auch Karl
Mays Interviewpartner Egon Erwin Kisch noch heute ein Begriff. Der
junge Journalist aus Prag gilt als Schöpfer der literarischen
Reportage mit exakten und tabulosen Milieuschilderungen,
unterhaltsam und informativ geschrieben. Bestseller sind bis heute
Bücher wie ‚Aus Prager Gassen und Nächten’, ‚Hetzjagd durch die
Zeit’ und ‚Der rasende Reporter’. Dieser Buchtitel gilt noch immer
als Synonym für die Person von Egon Erwin Kisch (1885-1948) selbst.
|
Fotografie von Erwin Raupp, 1907
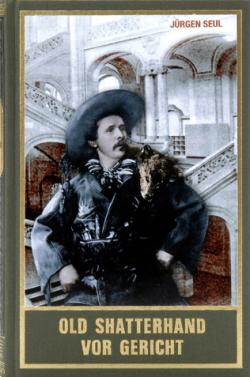 Jürgen
Seul Jürgen
Seul
Old Shatterhand vor Gericht
Die 100
Prozesse des Schriftstellers Karl May
Karl-May-Verlag
Ganzleinen, farbiges Deckelbild,Blindprägung, 624 Seiten
ISBN 978-3-7802-0186-7
€ 17,90
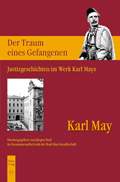 Jürgen
Seul Jürgen
Seul
Der Traum eines Gefangenen
Justizgeschichten im Werk Karl Mays
Hansa Verlag
Broschur,
272 Seiten
ISBN 978-3-920421-95-7
€ 14,95
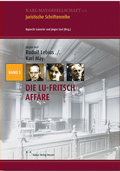 Jürgen
Seul Jürgen
Seul
Rudolf Lebius ./.
Karl May
Die Lu Fritsch-Affäre
Juristische
Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft / Band 3
Hansa Verlag
Broschur, 190 Seiten
ISBN
978-3-920421-98-8
€ 12,95
 Jürgen
Seul Jürgen
Seul
Karl May und Rudolf Lebius: Die Dresdner Prozesse
Juristische Schriftenreihe der Karl-May-Gesellschaft./ Band 4
Hansa Verlag
Broschur, 208 Seiten
ISBN
978-3-920421-91-9
€
18,00
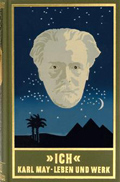 Karl
May Karl
May
»Ich«
Band 34, Karl Mays Leben und Werk
Karl-May-Verlag
Ganzleinen, farbiges Deckelbild,
576 Seiten + 32 s/w Bildseiten
ISBN 978-3-7802-0034-1
€ 17,90
 Gerhard
Klußmeier / Hainer Plaul Gerhard
Klußmeier / Hainer Plaul
Karl May und seine Zeit
Bilder,
Dokumente, Texte
Karl-May-Verlag
Ganzleinen, farbiges Deckelbild, 592 Seiten
Format: 22 x 30 cm
ISBN 978-3-7802-0181-2
€ 98,00 / sFr (UVP) 159,00
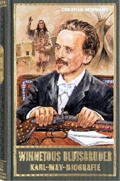 Christian
Heermann Christian
Heermann
Winnetous Blutsbruder
Karl-May-Biografie
Karl-May-Verlag
Ganzleinen, farbiges Deckelbild,
576 Seiten
ISBN 978-3-7802-0161-4
€ 17,90 / sFr (UVP) 31,50
|
 Glanz&Elend
Glanz&Elend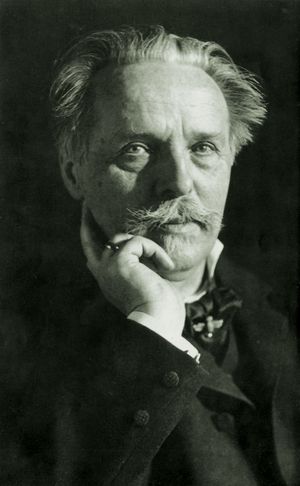
 angemeldet.
Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des
Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so
berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von
Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden
getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar
machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,
erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß
Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«
angemeldet.
Dennoch: »Als ich in die Villa Shatterhand, das Haus des
Weltreisenden, des Abenteurers von fünf Kontinenten eintrat,« so
berichtet der Reporter später, »fand ich mich in einem Wirbel von
Erregung. Dienstmädchen liefen hastig hin und her, Koffer wurden
getragen, niemand beachtete mich. Als ich mich schließlich bemerkbar
machte und fragte, ob ich den Herrn des Hauses sprechen könne,
erstarrte man vor Erstaunen: ‚Jetzt? Ja, wissen Sie denn nicht, daß
Herr Doktor May heute nach Dresden fährt?’«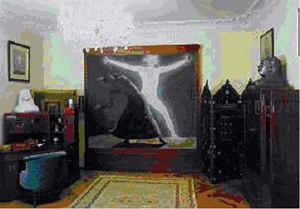
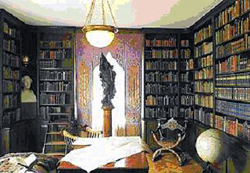 Kisch
wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie
Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen
ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen
Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen
einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und
Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung
seiner Arbeit widmen kann.
Kisch
wird von der Frau des Hauses begrüßt: Klara May fungiert ähnlich wie
Katja Mann als Sekretärin, Organisatorin und Vermittlerin zwischen
ihrem Schriftstellergatten und der Außenwelt. Sie führt einen
Großteil der Korrespondenzen, empfängt die Verehrer, zeigt ihnen
einige Reiseschätze des Hauses, erzählt von den weiteren Reise- und
Buchplänen ihres Mannes, damit sich dieser ohne allzu viel Störung
seiner Arbeit widmen kann.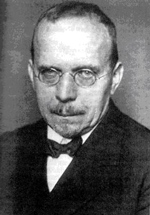 Das
Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen
erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der
Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910
überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der
Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen
»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung
verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die
Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp
sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –
»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der
berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als
ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler
bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine
kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte
Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,
eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in
Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat.
Das
Interviewthema ist sofort präsent: es geht um den Aufsehen
erregenden Charlottenburger Prozess Karl Mays, den der
Schriftsteller nur wenige Wochen vorher am 12. April 1910
überraschend verloren hat. Sein Prozessgegner, der
Sensationsjournalist Rudolf Lebius, hatte May in einem Brief einen
»geborenen Verbrecher« genannt und war deshalb wegen Beleidigung
verklagt worden. Die Bezeichnung stützt sich vor allem auf die
Vorstrafen des Schriftstellers. Lebius befindet sich seit knapp
sechs Jahren auf einem – wie er es in einem Flugblatt selber nennt –
»journalistischen Vernichtungsfeldzug« gegen den Schöpfer der
berühmten Winnetou-Romane, den er in seinen zahllosen Artikeln als
ehemaligen Räuberhauptmann, Gewalttäter, Dieb und Hochstapler
bezeichnet, der auch noch im Alter und als etablierter Autor seine
kriminellen Pfade nicht verlassen habe. Aus diesem Grunde halte
Lebius den Schriftsteller eben für einen »geborenen Verbrecher«,
eine Wertung, die das Königliche Amtsgericht in
Berlin-Charlottenburg als zulässig erachtet hat. Vor
allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet
Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor
allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater
Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner
vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.
Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf:
Vor
allem die katholische Geistlichkeit sieht das anders und betrachtet
Karl May inzwischen als einen Verderber der deutschen Jugend. Vor
allem der von Kloster Beuron aus operierende Benediktinerpater
Ansgar Pöllmann attackiert den Schriftsteller wegen seiner
vermeintlichen literarischen Verfehlungen mit ganzen Artikelserien.
Seinen Hauptvorwurf greift Kisch an diesem Morgen ebenfalls auf: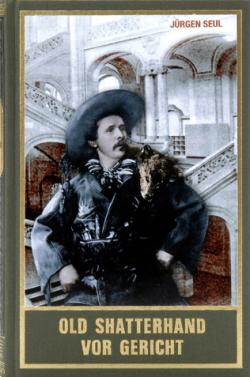 Jürgen
Seul
Jürgen
Seul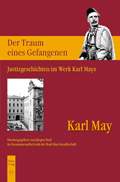 Jürgen
Seul
Jürgen
Seul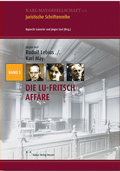 Jürgen
Seul
Jürgen
Seul Jürgen
Seul
Jürgen
Seul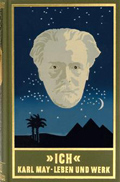 Karl
May
Karl
May Gerhard
Klußmeier / Hainer Plaul
Gerhard
Klußmeier / Hainer Plaul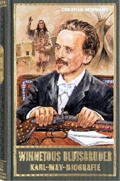 Christian
Heermann
Christian
Heermann