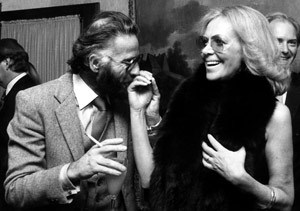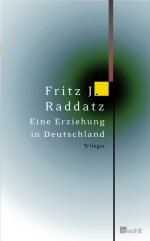|
Bücher & Themen
Jazz aus der Tube
Bücher, CDs, DVDs & Links
Schiffsmeldungen & Links
Bücher-Charts
l
Verlage A-Z
Medien- & Literatur
l
Museen im Internet
Weitere
Sachgebiete
Tonträger,
SF &
Fantasy,
Autoren
Verlage
Glanz & Elend empfiehlt:
20 Bücher mit Qualitätsgarantie
Klassiker-Archiv
Übersicht
Shakespeare Heute,
Shakespeare Stücke,
Goethes Werther,
Goethes Faust I,
Eckermann,
Schiller,
Schopenhauer,
Kant,
von Knigge,
Büchner,
Marx,
Nietzsche,
Kafka,
Schnitzler,
Kraus,
Mühsam,
Simmel,
Tucholsky,
Samuel Beckett
 Berserker und Verschwender Berserker und Verschwender
Honoré
de Balzac
Balzacs
Vorrede zur Menschlichen Komödie
Die
Neuausgabe seiner
»schönsten
Romane und Erzählungen«,
über eine ungewöhnliche Erregung seines
Verlegers Daniel Keel und die grandiose Balzac-Biographie
von Johannes Willms.
Leben und Werk
Essays und Zeugnisse mit einem Repertorium der wichtigsten
Romanfiguren.
Hugo von
Hofmannsthal über Balzac
»... die größte, substantiellste schöpferische Phantasie, die seit
Shakespeare da war.«
Andere
Seiten
Quality Report
Magazin für
Produktkultur
Elfriede Jelinek
Elfriede Jelinek
Joe Bauers
Flaneursalon
Gregor Keuschnig
Begleitschreiben
Armin Abmeiers
Tolle Hefte
Curt Linzers
Zeitgenössische Malerei
Goedart Palms
Virtuelle Texbaustelle
Reiner Stachs
Franz Kafka
counterpunch
»We've
got all the right enemies.«

|
 Der
Ungeliebte Der
Ungeliebte
Die Erinnerungen von Fritz J. Raddatz stiften lustvolle Unruhe im
sinnesfeindlichen deutschen Feuilleton
Als Lektor, Redakteur und Schriftsteller hat Fritz J. Raddatz den
deutschsprachigen Literaturbetrieb in den letzten 50 Jahren maßgeblich
mitgeprägt. Sein Qualitätsbegriff hat die Literaturlandschaft über Jahre entscheident
mitgestaltet,
ihr wichtige
Impulse gegeben, heftige Debatten ausgelöst und Maßstäbe gesetzt. Als im
Herbst 2003 seine Erinnerungen mit dem für
seine Verhältnisse überraschend biederen Titel »Unruhestifter« erschienen,
geriet das deutsche
Feuilleton in
helle Aufregung.
Die 478 Seiten stifteten
in der Tat Unruhe. Der alte Fritz hatte
ausgeteilt, und darf bis heute einsammeln, was
seine langjährigen Kritiker, Widersacher und Neider ihm schon immer stecken
wollten.
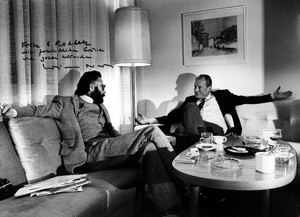 Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo
jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es
ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,
aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen
Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die
Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in
ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen
müssen. Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo
jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es
ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,
aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen
Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die
Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in
ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen
müssen.
Zu diesem Thema empfiehlt sich die Passage (S. 102 ff.), in
der Raddatz schildert, wie Rudolf Augstein 1975 (vermutlich aus Eifersucht, denn
er hatte vergebens versucht, Raddatz als Redakteur für den SPIEGEL zu gewinnen)
ausgerechnet Wolfgang Harich beauftragt hat, die Marx-Biographie von Raddatz zu
exekutieren.
Wer von den ambitionierten Karriereakrobaten kann sich heute vorstellen, was es
bedeutet haben muß, als Raddatz, damals gerademal knapp über zwanzig, von seinem Chef
bei »Volk und Welt«, Walter Czollek, Arthur Koestlers Roman
»Sonnenfinsternis« mit einem Zettel zurückerhielt, auf dem stand: »Dieses Buch
habe ich nie gelesen.«
 Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren
und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen
Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest
eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war
anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte
der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige
Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen
abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd
folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie
etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ... Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren
und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen
Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest
eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war
anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte
der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige
Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen
abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd
folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie
etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...
Ernüchternder noch ist ein Interview, daß der Aufbau-Verleger Bernd Lunkewitz
am 2. Mai 1998 der Berliner Zeitung gab. Unter dem Titel: »Ich wollte immer im
geistigen Brennpunkt der Nation sein«, schwadronierte Lunkewitz über seine
Motivation und sein Selbstverständnis als Verleger. Auf die Frage, ob er seine
Mitarbeiter am Unternehmen beteilige, antwortete Lunkewitz: »Nein, wir leben
doch im Kapitalismus. Um es mit Walter Benjamin zu sagen: "Es gibt kein
wahres Leben im falschen." Ich halte das für eine illusorische
Vorstellung: innerhalb des Kapitalismus antikapitalistische Produktionsfomen
einführen zu wollen. Das ist völlig sinnlos.«
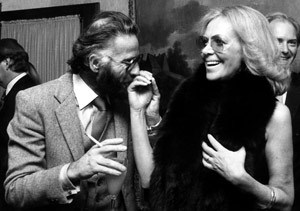 Ja, im Brennpunkt hat man sich
schnell die Zunge verbrannt, aber ob jetzt Benjamin oder Adorno, das spielt für
einen Lunkewitz keinen Janka. Kein SPIEGEL, keine ZEIT, keine FAZ hat sich über
diesen Gipfel der Borniertheit und Dummdreistigkeit, lustig gemacht, geschweige denn empört. Die
Anzeigen des Aufbau Verlages erschienen in allen Blättern. Ja, im Brennpunkt hat man sich
schnell die Zunge verbrannt, aber ob jetzt Benjamin oder Adorno, das spielt für
einen Lunkewitz keinen Janka. Kein SPIEGEL, keine ZEIT, keine FAZ hat sich über
diesen Gipfel der Borniertheit und Dummdreistigkeit, lustig gemacht, geschweige denn empört. Die
Anzeigen des Aufbau Verlages erschienen in allen Blättern.
Fritz
J. Raddatz indes mußte sich nie irgendwo einkaufen, man hat sich immer um ihn
gerissen. Er, der sich auch als einen Zerrissenen erlebte (man lese das Kapitel
über seine Zeit bei Volk und Welt bis zu seiner Rückübersiedelung in die
BRD), stand von frühen Jahren an, ob er wollte oder nicht, im geistigen
Mittelpunkt einer Nation, in der Sinnlichkeit und Intellekt bis heute nicht
zueinander gefunden haben. Für ihn war und ist das Ästhetische nie
Selbstzweck, sondern vor allem im Hinblick auf dessen politische Moral und
Wirkung in die Gesellschaft hinein relevant. So reflektieren seine
»Spiegelungen« die Beziehungen des Menschen und Arbeitstieres Raddatz zu
seinen Lebenspartnern und Brotherren. Sie zeichnen auch einen detailierten Lageplan der Verflechtungen
deutscher Intellektueller mit den Repräsentanten medialer und damit auch
politischer Macht, die geprägt sind von Neid, Verrat und Mißgunst.
Es
ist schlicht auf Mißgunst gegründete geistige Tieffliegerei, Raddatz Charakterschwäche und Eitelkeit
vorzuwerfen. Wer würde einem Aufsichtsratmitglied etwa den Ferrari oder seine
Sammlung von exquisiten Maßanzügen vorwerfen?
Den Denkenden statt dessen Denken zu
attackieren, hat nicht nur in Deutschland Tradition. Bei uns jedoch
scheint sich immer noch nicht herumgesprochen zu haben, wie man revoluzzt, und
dabei doch Lampen putzt.
Mit seinem »Unruhestifter« sprengt das Wolken trinkende Kuhauge Fritz J. Raddatz
wieder einmal den Rahmen dessen, was einem Literaturkritiker in
Deutschland, auch heute noch, an sinnlicher Textenergie erlaubt zu sein
scheint. Sein Buch hat etwas von Grimmelshausens 'Simplicissimus', wird aus unmittelbarem,
überreichem eigenem
Erleben gespeist, ist ein abenteuerliches, expressives kulturhistorisches
Mosaik der deutschen Nachkriegsgeschichte.
Das kann ihm keiner nachmachen, denn es gibt leider nur einen
Fritz
J. Raddatz, aber der hat in seinem linken kleinen Finger mehr Verve, Esprit und Savoir
Vivre als die ganze meckernde, vertrocknete Mischpoke der deutschsprachigen Literaturkritik
zusammen. Hoch und lang soll er leben. Herbert Debes
|
Fritz
J. Raddatz
Unruhestifter
Erinnerungen
Propyläen
478 S.
€25,00
ISBN 3-549-07198-1
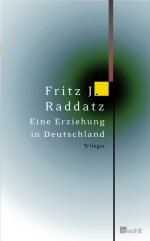 Fritz
J.
Raddatz Fritz
J.
Raddatz
Eine Erziehung in Deutschland
Trilogie
Rowohlt
Neuausgabe
496 S., HC
€ 24,90 /
Raddatz' dreibändiger Zyklus über sein literarisches Alter ego Bernd Walther,
gespannt von den dreißiger Jahren bis in die späten Fünfziger, von der
Nazi-Diktatur über die des Proletariats bis zur Flucht in den Kapitalismus, ist
das Dokument einer wirren Zeit, der Bericht vom Irrgang einer jungen Sehnsucht
nach Erfüllung, im Politischen so rücksichtslos wie schamlos im Privaten,
geschrieben nach dem Lebensmotiv "Sehnsucht ist stärker als die Angst". Der
Protagonist ein Held unserer Zeit, und um ihn herum ein Panorama der
Zeitgenossen, allesamt erfasst in der für Raddatz typischen Ästhetik der Blöße
und Entblößung. So erzählt Raddatz nicht nur ein ungewöhnliches Leben, sondern
macht die politischen und menschlichen Verkrümmungen der Nachkriegszeit
sichtbar.
Der Band enthält im einzelnen: Kuhauge (Rowohlt 1984); Der Wolkentrinker
(Rowohlt 1987); Die Abtreibung (Rowohlt 1991).
|
 Berserker und Verschwender
Berserker und Verschwender
 Der
Ungeliebte
Der
Ungeliebte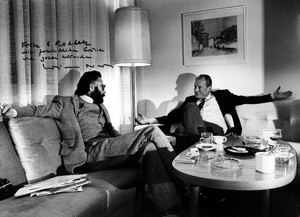 Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo
jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es
ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,
aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen
Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die
Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in
ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen
müssen.
Doch daß Raddatz die Monroe mit der Taylor verwechselt, und ob der Kenzaburo
jetzt Oe oder »Öe« heißt, (wir wissen, wer gemeint ist, und wozu gibt es
ein Lektorat?), diese Marginalien, teilweise mit peinlich piefigem Genuß,
aufzuzählen, ja selbst den alten Goethe nochmal auszugraben, nur weil der wegen
Raddatz mal um drei Jahre den Zug verpaßt hat, das belegt allenfalls die
Buchhaltermentalität und Gründlichkeit der Auftragsschreiber, die sich in
ihren Redaktionen profilieren, und, je nach Lagerzugehörigkeit, Flagge zeigen
müssen.  Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren
und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen
Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest
eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war
anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte
der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige
Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen
abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd
folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie
etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...
Wie sich die Zeiten geändert haben, und wessen Geistes Kinder heute als Lektoren
und Verleger Verantwortung für Bücher tragen, läßt sich an zwei kleinen
Beispielen illustrieren: Ende der 90iger Jahre traf ich in Berlin auf dem Fest
eines angesehenen Verlages einen Sachbuchlektor. Der promovierte Germanist war
anfang dreissig und sprach von einem interessanten Projekt über die Geschichte
der Sowjetunion, das er betreute. Ich hatte gerade die zweibändige
Autobiographie von Arthur Koestler gelesen und schwadronierte über dessen
abenteuerliches Leben. Als ich bemerkte, daß er meinen Ausführungen nur zögernd
folgte, fragte ich nach, und es stellte sich heraus, daß dieser Lektor noch nie
etwas von einem Autor namens Koestler gehört hatte ...