Das Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU dagegen war sehr wohl zu umgehen. Es gab dafür keinerlei externen Auslöser. Eine der wahrscheinlichsten Erklärungen für die große Anzahl unschlüssiger Wähler ist wohl Verwirrung: Sie wissen nicht, warum sie zur Wahl gebeten werden. Was genau hat sich in der EU verändert, um ein solches Referendum zu rechtfertigen? Nichts. Es basiert auf einem voreiligen Versprechen David Camerons, der einer Spaltung innerhalb seiner regierenden Conservative Party entgegenwirken wollte: Die lautesten Stimmen auf beiden Seiten der Debatte sind erwartungsgemäß die der Konservativen.
Obwohl die Briten sehr stolz sind auf ihre demokratische Tradition, sind Volksabstimmungen doch eine relativ neue Gepflogenheit: Das erste landesweite Referendum fand 1975 statt, um den Beitritt Großbritanniens zur EWG (wie sie damals hieß) zu ratifizieren. Genau wie damals bestehen all jene, die für den »Brexit« plädieren, darauf, dass Großbritannien, als Seemacht und Handelsnation, es in der Welt auch »im Alleingang« schaffen könne. In anderer Hinsicht hat sich dagegen alles verändert. Jeremy Corbyn und John McDonnell, die jetzigen Führer der Labour Party setzen sich diesmal dafür ein, dass Großbritannien in Europa verbleiben soll, weil die EU sich noch besser für die Rechte der Arbeiter einsetzt als die Brexit-Alternative.
Und hierin besteht einer der großen Unterschiede zu vor 40 Jahren: Es gibt seitens der Linken in Europa keine grundlegende Kritik am Status quo.
Dieses Fehlen einer radikalen Linken ist seit der Weltwirtschaftskrise von 2008 nicht mehr zu übersehen. Zum ersten Mal seit den Tagen vor der Revolution von 1848 erfährt Europa eine einschneidende Wirtschaftskrise, ohne dass diese eine allgemeine politische Kampfansage seitens der Linken ausgelöst hätte. Nicht einmal die Partei Syriza hat Griechenland aufgefordert, einen radikalen Bruch mit dem EU-Wirtschaftssystem herbeizuführen. Allerorten haben sich der Groll und die soziale Unzufriedenheit nach sechs mageren Jahren angehäuft und schleichend einer extremen Rechten Vorschub geleistet.
Diese Rolle wird durch die UK Independence Party von Nigel Farage bekleidet, der für einen klassischen Protektionismus plädiert. Der spricht wahrscheinlich am ehesten die verarmte Wählerschaft in den Städten von Medway in Kent und entlang der Ostküste an, die sich vor dem kontinuierlichen Zuzug von Arbeitern aus Polen, Rumänien und Bulgarien fürchtet. Doch die lautesten Stimmen des Brexit-Lagers innerhalb der Konservativen Partei, wie Michael Grove und John Redwood, haben einen ganz anderen Themenkatalog: Sie sind stramme Neoliberale, die das Vermächtnis Margaret Thatchers zu vollenden meinen, indem sie dem »freien Handel« alle Barrieren aus dem Weg räumen und sämtliche Subventionen und andere »marktfeindliche« Schutzvorschriften abschaffen.
Diese tiefe Spaltung innerhalb des Brexit-Lagers führt natürlich dazu, dass die zwei Flügel ungern thematisieren, was sie mit ihrer Souveränität anfangen würden, sobald sie sie bekämen.
Aber gleichzeitig träumen sie alle davon, dass Großbritannien automatisch seinen Status als Großmacht wieder einnähme, den es einst in der Welt innehatte.
Mit einer Sache haben die Brexit-Verfechter allerdings Recht. Bei diesem Referendum geht es eher um die nationale Souveränität als um die Wirtschaft. Doch in ihrer utopischen Nostalgie haben sie vergessen, wie sehr die Europäische Gemeinschaft dazu beigetragen hat, dass sich im westlichen Nachkriegseuropa die einzelnen Nationalstaaten stabilisieren konnten.
Und Großbritannien? Ist es wirklich so immun gegen dieses allgemeine Muster? Hier täten wir gut daran, uns an das schottische Referendum von 2014 zu erinnern. Es gab damals die düstere Befürchtung, dass eine Entscheidung der Schotten für die Unabhängigkeit womöglich den Austritt aus der EU nach sich ziehen würde: Dasselbe gilt nun auch umgekehrt. Wenn die Brexit-Befürworter sich durchsetzen, müssen sie mit einem zweiten schottischen Referendum rechnen, dass auch eine tiefe politische Krise in Nordirland auslösen wird. Wo wird ihr utopisches Streben nach ungeteilter Souveränität endgültig Erfolg finden? Vielleicht in einem kleinen Einheitsstaat – ja, in einem Königreich England.
(Übersetzt von Irmengard Gabler)
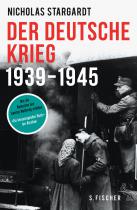
Das große Buch zum Zweiten Weltkrieg – einzigartig und fesselnd erzählt der renommierte Oxford-Historiker Nicholas Stargardt in ›Der Deutsche Krieg‹ aus der Sicht der Menschen, die den Krieg durchlebten
Sommer 1939, Mobilmachung im nationalsozialistischen Deutschland. Die Menschen ahnen nicht, dass ein brutaler, zerstörerischer Krieg folgen würde. Erstmals erzählt Nicholas Stargardt aus der Nahsicht, wie die Deutschen – Soldaten, Lehrer, Krankenschwestern, Nationalsozialisten, Christen und Juden – diese Zeit erlebten.
Gestützt auf zahllose Tagebücher und Briefe, unter anderem von Heinrich Böll und Victor Klemperer, Wilm Hosenfeld und Konrad Jarausch, fängt Stargardt die Atmosphäre jener Jahre ein und findet neue Antworten auf die Frage, wofür die Deutschen eigentlich diesen Krieg zu führen meinten: Sie glaubten, dass Deutschland sich gegen seine Feinde verteidigen musste, und sie glaubten an die nationale Sache, nahezu unabhängig von sozialer Stellung sowie religiöser oder politischer Überzeugung. Der Wunsch, ihr Land und ihre Familien zu retten, ließ sie selbst, als die Gewissheit wuchs, an einem Völkermord teilzuhaben, weiterkämpfen, mit ungebrochener Brutalität und wider alle Vernunft. Der Band enthält einen 16-seitigen Bildteil.
»Ein herausragendes Buch. Nicholas Stargardt bietet anschaulichere und nuanciertere Einsichten denn je in die Motive, die gewöhnliche Deutsche den grauenvollsten Krieg aller Zeiten führen ließen.« Ian Kershaw
»Hervorragend geschrieben und in seiner Argumentation überzeugend, ist dieses Buch ein Muss.« Saul Friedländer
»Ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung, das die ›Vogelperspektive‹ nahtlos mit einer Mikrogeschichte dieser verhängnisvollen Periode des 20. Jahrhunderts verbindet.« Jan T. Gross
»Erstmals wird die Chronologie der Stimmung, der Hoffnungen und Befürchtungen […] der deutschen Bevölkerung während des Krieges wirklich sichtbar. Eine eindrucksvolle, fesselnde Darstellung.« Mark Roseman






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /