Anonym will die Frau bleiben, die mir neulich schrieb, die Mitarbeiterin eines Jugendamts. Sie war ratlos. Ihrem Amt sind Fälle von Familien »mit Migrationshintergrund« bekannt, in welchen Gewalt zur »traditionellen Erziehung« gehört. Da haben kleine Mädchen und Jungen blaue Flecken, werden mit Drohungen eingeschüchtert und zum »Gehorsam« erzogen. Doch die Mitarbeiter im Jugendamt sollen »kultursensibel« mit Eltern und Kindern umgehen, und auch dann nicht unbedingt einschreiten, wo es rein rechtlich notwendig wäre. Ihr Brief sagte, zusammengefasst: »Das geht doch eigentlich nicht, oder?« Als würde sie von mir ein Okay für etwas wollen, was menschlich und gesetzlich glasklar ist: Einschreiten, selbstverständlich, egal woher jemand kommt.
Seit wann ist es »sensibel«, frage ich mich, Gewalt gegen Kinder oder Frauen zu akzeptieren? Und seit wann ist Gewalt »Kultur«? Was mir die Mitarbeiterin dieses Amtes geschrieben hat, ist nicht ungewöhnlich. Hunderte von solchen Briefen bekomme allein ich. Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter schildern, in welchem Dilemma sie sich befinden: Sollen sie Rücksicht nehmen auf Traditionen? Respekt vor autoritären Vätern haben? Die Ehre von Mädchen – und deren Familien – achten, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen sollen? Es sind einfühlsame Menschen, die da schreiben – und völlig hilflose.
Muslime und Menschen mit »Migrationshintergrund« genießen bei linken, progressiven Zeitgenossen in Deutschland besondere Sympathie und Solidarität. Man will damit Zeichen setzen gegen Rassismus und Vorurteile. Ich bin Araber, komme aus Israel, und lebe hier seit 2004. Viele nette Menschen sind mir in meinen ersten Jahren in Deutschland im linksliberalen Spektrum begegnet.
Seitdem ich mich kritisch über bestimmte Religionsinhalte äußere, mit denen ich groß geworden bin, sind sie nicht mehr so richtig nett. Es ist mit ihnen nicht so schlimm, wie mit den Gegnern aus den »eigenen Reihen«, von denen ich Hasspost erhalte. Aber so einen Araber wie mich mögen manche linken, grünen Leute im Allgemeinen nicht mehr. Ich entspreche nicht dem Klischee desjenigen, der sich als Opfer der Zustände ausschließlich über rassistische Vorurteile beklagt – auch wenn ich das durchaus tue – sondern ich begrüße die Demokratie, in der ich hier lebe, und ich kritisiere offen und deutlich die konfessionelle Enge der muslimischen Communities hier im Land. Ich kritisiere die muslimischen Dachverbände wie DITIB, oder den Zentralrat der Muslime, die behaupten, im Namen meiner Religion zu sprechen – und für alle Muslime Deutschlands, was statistisch schlicht nicht stimmt.
Ich setze mich für innerreligiöse und gesellschaftliche Reformen ein und spreche und schreibe öffentlich darüber, dass vieles schief läuft in den Familien, an den Schulen, in der Gesellschaft, im Umgang mit religiösem Fundamentalismus und islamischem Radikalismus. Ein Netzwerk von deutschen linksliberalen Personen, echten und selbsternannten, »beschützt« eine Mehrheit der Muslime in Deutschland vor der Minderheit ihrer muslimischen Kritiker.
»Was ist daran links, was progressiv?« frage ich mich. Und: »Seid Ihr noch bei Trost?«
Humanistische Aufklärung und Gesellschaftskritik haben gerade im deutschsprachigen Raum, eine große Tradition. Aufklärung hat immer – absolut immer – mit der Kritik an Herrschaft zu tun, und Herrschaft hat, wie das Wort sagt, fast immer mit Herren zu tun, also mit Männern, mit dem Patriarchat. Die großen, monotheistischen Weltreligionen haben es mit einem patriarchalen, strafenden Gott zu tun, einem der stärksten Machtfaktoren für ein hierarchisches, antidemokratisches Weltbild.
Karl Marx nannte Religion das »Opium fürs Volk«. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Immanuel Kant und Max Weber waren Religionskritiker. Sigmund Freud analysierte als Ursprung für die Erfindung eines strengen Gottvaters unter anderem ein Bedürfnis danach, Verantwortung an Autoritäten abzugeben, sich in kindliche Unmündigkeit zurück zu ziehen. Die Französische Revolution übte Kritik an Religion als Instrument von Herrschaft und Unterdrückung. Auch in der Studentenrevolte von 1968 ging es um die Kritik am Klerus, an der Stellung der Frau in der Kirche, an religiösen Denkverboten, an den Vorstellungen von Autorität oder an der grausamen Praxis in staatlichen wie kirchlichen Kinder- und Jugendheimen. In jüngerer Zeit empörten sich kritische Medien und Kinderschützer über den massenhaften Missbrauch von Kindern in katholischen Institutionen.
Kritik von Gläubigen wie Nichtgläubigen an Religion als Herrschaftsinstrument ist ein Klassiker der Linken. Diese Kritik gehört zu ihrem Fundament.
Umso verrückter erscheint es, wenn jetzt die muslimischen Kritiker ihrer eigenen Religion von Grünen und Linken und Sozialdemokraten mit Argwohn betrachtet werden. Warum ist unsere Kritik nicht ebenso berechtigt? Unter anderen Vorzeichen tut das Links-Grüne Lager dasselbe wie die Salafisten, Wahhabisten und übrigen islamischen Fundamentalisten, die wir kritisieren: Sie wollen kritische Muslime mundtot machen. Die einen entmündigen Muslime im Namen eines patriarchalischen Gottes, die anderen weil sie uns „schützen“ wollen, weil sie meinen, Kritik an unserer Religion sei zu kränkend für uns, wir Muslime seien nicht fähig, kritisch zu denken, Reformen umzusetzen, uns von verkrusteten Traditionen zu lösen. Aber warum soll das, was in anderen Religionen – dem Katholizismus, dem Protestantismus, dem Judentum – durch Kritik und Reform von innen und außen zu Teilen gelungen ist, nicht auch im Islam gelingen dürfen? Und warum erhalten wir nicht die wichtige Solidarität von den Progressiven im Land?
Frauen und Männer muslimisch geprägter Herkunft besitzen genausoviel Verstand und Urteilskraft wie alle anderen Erdenbürgerinnen und Erdenbürger. Wer das nicht glaubt, wer das nicht wissen will, der ist selber ein verkappter Rassist.
Den kritischen Muslimen wird die Debatte in Deutschland von zwei Seiten verweigert: Von den offiziellen muslimischen Verbänden und von den meisten linken, grünen Milieus. Das ist erstaunlich und sollte zu denken geben. In beiden Lagern weigert man sich, brennende Probleme der muslimischen Communities klar zu benennen und reformerisch, integrativ anzugehen. Diese Probleme sind unter anderem: Das Anwachsen eines gefährlichen Fundamentalismus, der immer mehr junge Leute in den Terrorstaat des IS lockt, das Ausgrenzen von Frauen als Menschen zweiten Ranges, die Erziehung von Kindern durch Angstpädagogik, eine Sexualfeindlichkeit, die zugleich hochgradig sexuell aufgeladen ist und tabuisiert, ein Buchstabenglaube, der den Koran nicht in seinem historischen und lokalen Kontext versteht, sondern von Allah diktierten Text begreift. Abertausende von Beispielen zeigen, wie unfrei und unglücklich das Kleben an diesen Vorstellungen macht.
Solange die muslimischen Verbände – ebenso wie die Parteien des linken Spektrums – leugnen, dass ein traditionell-patriarchalisches Verständnis des Islam den fundamentalistischen Muslimen in die Hände spielen, solange haben rechte Kräfte wie AfD und Pegida bei dem Thema das Sagen. Das Leugnen der Probleme in der Mitte der Gesellschaft ist direkt mitverantwortlich für die Erfolge der neuen Rechten am Rand der Gesellschaft. Sie nehmen das Benennen der Probleme pauschal für sich in Beschlag – und sie tun das hetzend und rassistisch, anstatt politisch aufklärend.
Kluge und präventive Politik muss in der Mitte der Gesellschaft eine Debatte wollen und anstoßen. Traditionelles Islamverständnis befördert sexuelle Tabus und sexuelle Gewalt. Es hat enormen Einfluss auf das Verhalten der Geschlechter zueinander. Was in der Kölner Silvesternacht passiert ist hat sein Vorbild auf dem Kairoer Tahrir-Platz und anderswo. Von der »religiösen Tradition« zur sexuellen Abstinenz gezwungene, junge Männer, greifen auf Frauen in der Öffentlichkeit zu. Das ist ein Faktum. Das festzustellen ist nicht rassistisch. Wir, die Muslime, haben das Problem – die kritischen unter uns benennen es und brauchen die Solidarität der Demokraten im Land. Von der AfD, von Pegida wollen wir sie nicht – denn sie ist keine.
Eine echte, offene, tabufreie Debatte wird zu Lösungen führen, zum Nachdenken und zu besserer Prävention. Diese Debatte wird die Rechtsradikalen und die Islamisten schwächen. Dazu muss allen in Deutschland klar werden, dass Muslime nicht für die »Opferrolle« gecastet werden, sondern als gleichberechtigte Bürger gleiche Rechte und Pflichten wahrnehmen wollen.
Allen voran fordern wir das, die kritischen Muslime. Wir sind viele. Mehr als Ihr denkt. Nicht allein die mutige Vorkämpferin Seyran Ates kann man hier nennen. Im April 2015 habe ich in Berlin das „Muslimische Forum Deutschland“ mitgegründet. Wir streiten für einen humanistischen Islam, für eine offene Debatte innerhalb der Community der Musliminnen und Muslime. Zum Forum gehören Leute wie Prof. Mouhanad Khorchide, der Leiter des Zentrums für Islamische Theologie der Uni Münster, Prof. Erdal Toprakyaran, der Direktor des Zentrums für Islamische Theologie der Uni Tübingen, Prof. Handan Aksünger an der Akademie der Weltreligionen der Uni Hamburg. Wir sind Journalisten wie Cigdem Toprak, Düzen Tekkal, Abdul-Ahmad Rashid und Güner Yasemin Balci, Islamwissenschaftler wie Aladdin Sarhan oder Marwan Abu-Taam, wir sind Soziologen, Psychologen, Studierende. Und wir alle sind Teil dieser Gesellschaft. Traut Euch, uns zuzuhören, mit uns zu diskutieren!
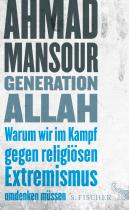
Warum zieht es Jugendliche in den Dschihad? Ist der Islam verantwortlich für den Terror? Und wie können wir uns dem religiösen Extremismus stellen? Bislang stehen Politik, Gesellschaft und besonders die Schulen diesen Fragen hilflos gegenüber. Kein Wunder, denn die Debatten werden falsch geführt, wie der renommierte Psychologe und Islamexperte Ahmad Mansour nachdrücklich zeigt.
Mansour beantwortet diese Fragen mit beeindruckender Klarheit und Reflexion. Denn keiner kennt wie er beide Seiten. Bevor er den mühsamen Ausstieg schaffte, war er selbst radikaler Islamist. Jetzt arbeitet Ahmad Mansour in Berlin als Psychologe und betreut Familien von radikalisierten Jugendlichen. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen und seiner konkreten Präventionsarbeit zeigt er beeindruckend, dass eine Deradikalisierung möglich ist und plädiert für eine Reform des praktizierten Islam.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /