Obgleich in einigen gesellschaftlichen Gruppen weiterhin irrige Vorurteile bestehen, ist der Umgang mit Frauen und ethnischen Minderheiten doch inzwischen so etabliert, dass wir uns kaum noch daran erinnern, wie stark voreingenommen man solchen Gruppen noch in der jüngeren Vergangenheit gegenüberstand. Unsere Liberalisierung zieht immer weitere Kreise. Homosexuelle werden heute wie nie zuvor in den inneren gesellschaftlichen Strukturen akzeptiert. Wer hätte sich vor fünfzig Jahren vorstellen können, dass Berlin einmal einen schwulen Bürgermeister haben würde? Oder dass die Tatsache, dass dieser Bürgermeister schwul ist, irgendwann aus den Schlagzeilen verschwinden und lediglich zu einer von Hunderten Fakten über seine Person werden würde?
Heute sind wir endlich in der Lage, Menschen mit vielerlei Einschränkungen zu akzeptieren; man sieht sie im Fernsehen, in der Politik, im Sport, als Schüler oder Lehrer im Klassenzimmer. Dieser Wandel in unserem Denken ist eine ebenso grundlegende Entwicklung wie die Moderne selbst. Er ist eine bewusste und energische Ablehnung der Vorstellung, dass es einen besten Weg gibt, dass das Streben nach einem einzigen Ideal zu einer besseren Welt führt. Kürzlich sprach ich mit einer Frau, die seit Generationen mit behinderten Kindern arbeitet, und sie schilderte mir, wie sie mit Lauren Potter, einer Schauspielerin mit Down-Syndrom aus der beliebten TV-Serie Glee, in Los Angeles zum Mittagessen ging. »Die Menschen kamen her und baten sie um ein Autogramm«, erzählte sie. »Sie war in erster Linie eine Prominente und erst dann ein Mensch mit einer Behinderung. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde.«
Dieser Wandel im gesellschaftlichen Empfinden verändert die Lebenserfahrung der Menschen auf drei Ebenen: erstens die Situation der Menschen, die direkt von erschwerenden Bedingungen oder einer Behinderung betroffen sind; zweitens deren Familien und drittens die Gesellschaft als solche. Indem wir uns der Andersartigkeit und der Vielfalt öffnen, erweitern wir unseren Horizont. Bevor ich mit den Recherchen zu ›Weit vom Stamm‹ begann, glaubte ich, dass Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme, bei denen Kinder mit Problemen oder Behinderungen in Klassen mit »normalen« Kindern zusammengebracht werden, für Behinderte eine gute Sache seien. Es gilt seit Langem als anerkannte Tatsache, dass getrennter Unterricht selten gleichwertiger Unterricht ist, also schienen Gleichstellungs- und Inklusionsprogramme Menschen mit organischen Benachteiligungen nicht nur einen Zugang zu besserer Bildung zu verschaffen, sondern auch den Kontakt mit jenen nicht behinderten Menschen zu fördern, mit denen sie als Erwachsene später zu tun hätten. Aber ich fand auch, dass all dies für die anderen Kinder eher negativ wäre, da sie durch die erforderlichen Maßnahmen solcher Programme in ihrer Entwicklung gebremst würden. Heute hoffe ich, dass meine eigenen Kinder an Gleichstellungs- und Inklusionsprogrammen teilnehmen können, weil ich glaube, dass die Lektionen in Menschlichkeit, die in solchen Kontexten vermittelt werden, den Vorteil, das Plusminusmalgeteilt zwei Wochen früher zu beherrschen, bei Weitem überwiegen.
Ich glaube daher, dass mich mein Buch radikalisiert hat. Seit es erschienen ist, befinde ich mich in ständigem Kontakt mit Menschen, die in die von mir beschriebenen Kategorien passen. In gewisser Weise wünsche ich, ich hätte die Lesereise unternehmen können, bevor ich das Buch schrieb, weil mich die Geschichten, auf die dich dabei gestoßen bin, sehr bewegt haben. Ich bekomme unglaublich viele Zuschriften und Anrufe, mindestens zehn am Tag, manchmal bis zu fünfzig an einem einzigen Vormittag, und ich tue mein Bestes, mit dieser Masse an Kommunikation fertig zu werden. Unter den Überraschungen war der Anruf von Peter Lanza, dem Vater von Adam Lanza, welcher im Winter 2012 das Newtown-Massaker an der Sandy Hook Elementary School anrichtete. Peter sagte, er sei von der Presse regelrecht gehetzt worden, jedoch bislang nicht bereit gewesen, seine Geschichte zu erzählen. Nun habe er sich endlich dazu entschlossen, über seine Erfahrungen zu sprechen, und wolle, dass ich sie zu Papier bringe. Über einen Zeitraum von drei Monaten trafen wir uns dann fast jedes Wochenende. Die Interviews, die dabei entstanden, bildeten die Grundlage eines Beitrages, den ich für den New Yorker schrieb.
Ich fand Peter äußerst sympathisch – ein Vater, der sein eigenes Kind von Anfang an seltsam gefunden und sich unter den gegebenen Umständen dennoch redlich bemüht hatte, für es da zu sein. Freilich lassen sich rückblickend Fehler erkennen, doch keiner davon wurzelte in einer bösen Absicht; vielmehr waren sie die Folge eines tiefen Unverständnisses. Dies deckte sich mit der These meines Buchs, nämlich dass uns unsere Kinder in vielerlei Hinsicht fremd bleiben – wir fühlen uns ihnen sehr nahe und begreifen doch grundlegende Tatsachen über sie nicht.
Peter sagte: »Ich gehe mit meinem Namen mittlerweile sehr zurückhaltend um. Ich sage ihn sogar ungern. Ich dachte daran, ihn zu ändern, fand aber, dass ich mich dadurch von dem Geschehenen distanziert hätte, und ich kann mich nicht distanzieren. Ich lasse nicht zu, dass mich das definiert. Den Namen zu ändern würde sich anfühlen, so zu tun, als ob das Ganze nicht passiert wäre – und das wäre nicht richtig.« Diese Sichtbarkeit hat Peter jedoch schwer mitgenommen. Alte Freunde haben ihm die Stange gehalten, doch sagte Peter, er glaube, dass er vielleicht nie wieder neue Freunde finden könne. »Das definiert, wer ich bin; ich kann es nicht ausstehen, aber man muss es akzeptieren.«
Als ich mich mit Peter das letzte Mal traf, hatte er ein Bild dabei, das ihn mit seinen beiden Söhnen am Strand zeigte. »Was mich an diesem Bild so aufwühlt, ist, dass man darauf ganz deutlich sieht, dass er geliebt wird«, sagte er. Seit den Ereignissen hatte Peter jede Nacht von Adam geträumt. Es seien weniger Angstträume als Träume von tiefer Traurigkeit gewesen. Er sagte mir, er habe darin keine Furcht vor seinem Schicksal als Adams Vater empfunden, auch nicht davor, von seinem Sohn ermordet zu werden. Kürzlich jedoch habe er den schlimmsten Alptraum seines Lebens gehabt: Er ging an einer Tür vorbei; eine Gestalt in der Tür begann, heftig an dieser zu rütteln. Peter spürte Hass und Zorn, »die schlimmstmögliche Bosheit«, und konnte erhobene Hände sehen. Er erkannte, dass es Adam war. »Was mich überraschte, war, dass ich eine scheiß Angst hatte«, erinnerte er sich. »Ich konnte nicht verstehen, was mit mir vorging. Doch dann begriff ich, dass ich es aus Sicht seiner Opfer erlebte.«
Ich fragte mich, was Peter empfinden würde, wenn er seinen Sohn wieder sehen könnte. »Ganz ehrlich, glaube ich nicht, dass ich den Menschen erkennen würde, den ich da sähe. Ich kann mir nur vorstellen, dass es da nichts gäbe, gar nichts. So als fragte man: ›Wer bist du, Fremder?‹« Peter erklärte, er wünschte, Adam wäre nie geboren worden, so dass man sich weder daran erinnern könnte, wer er gewesen, noch, wozu er geworden sei. »Dieser Gedanke kam nicht sofort. Das ist ja nicht natürlich, wenn man an sein Kind denkt. Aber, Gott, es steht außer Frage. Wenn man einmal an diesen Punkt kommt, lässt das Ganze nur einen Schluss zu. Das ist noch nicht lange her, aber es ist genau, wo ich jetzt stehe.« Peters Worte klingen, als lehnte er sein Kind ab, doch ich glaube nicht, dass dem so ist. Ich glaube, Peter liebt Adam, empfindet aber gleichzeitig eine ungeheure Entfremdung und Wut.
Mein Buch handelt von der Liebe – darüber, was unter Stress und Zwang mit der Liebe geschieht. Viele Familien, die ich während der Arbeit an meinem Buch kennenlernte, und viele weitere, zu denen ich seitdem Kontakt hatte, schilderten den schrittweisen Wandel, den sie durchlebten, weil ihre Kinder nicht ihren Erwartungen entsprachen: Anfangs stand die Empörung, gefolgt von Verwirrung, Akzeptanz und schließlich von Freude. Manchmal nahm ich ihnen den Teil mit der Freude nicht ganz ab, aber mit je mehr Menschen ich ins Gespräch kam, desto mehr begriff ich, dass diese Freude aufrichtig war. Die meisten Kinder haben irgendwelche Fehler, doch würden die meisten Eltern ihre Kinder nicht um alles in der Welt gegen andere Kinder eintauschen; eine seltsame Funktion der Biologie, aber auch das Resultat einer Beziehung, die sich nach und nach aufbaut. Jemand sagte einmal, dass wir uns nicht nur um unsere Kinder sorgen, weil wir sie lieben, sondern auch, dass wir sie lieben, weil wir uns um sie sorgen – dass Fürsorge eine Bindung bewirkt. Es sollte also nicht überraschen, dass die von mir interviewten Eltern, deren elterliche Sorge ihnen weit mehr abverlangte als den meisten anderen Eltern, ihre Kinder so liebten, wie sie es taten: manchmal tragisch, manchmal ambivalent, aber fast immer sehr, sehr innig.
Auf seiner beeindruckenden Website www.farfromthetree.com finden sich weitere Videos und Hintergründe zu den Protagonisten aus seinem Buch. Ein Besuch dort sei hiermit schwerstens empfohlen!
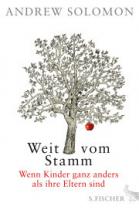
Wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre Familien? Und wie akzeptieren wir und unsere Gesellschaft außergewöhnliche Menschen?
Ein eindrucksvolles Buch über das Elternsein, über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht. Der Bestsellerautor Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder außergewöhnlich oder hochbegabt sind, die am Down-Syndrom oder an Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des Andersseins sind universell. Ihr Mut, ihre Lebensfreude und ihr Glück konfrontieren uns mit uns selbst und lassen niemanden unberührt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /