Im Fall von Gregor, einem jungen Geschäftsreisenden, der eine Nacht zuhause in der Wohnung seiner Familie in Prag verbringt und als ein seltsames, hybrides Mensch/Insekt-Wesen erwacht, ist es offensichtlich eine unerwartete Überraschung. Die Reaktion des Haushaltes – Mutter, Vater, Schwester, Dienstmädchen, Köchin – besteht darin, entsetzt zurückzuweichen, so wie man das auch erwarten würde. Kein einziges Mitglied der Familie fühlt sich verpflichtet, die Kreatur zu trösten, indem es beispielsweise darauf hinweist, dass ein Käfer auch ein lebendes Wesen ist. Die Verwandlung in einen könnte für eine mittelmäßige Existenz mit einem eintönigen Leben ja auch eine aufregende und erhebende Erfahrung sein, also wo ist das Problem? Dieser ausgedachte Trost könnte jedoch in keinem Fall in der Handlung vorkommen, denn Gregor kann zwar die menschliche Sprache verstehen, sich aber nicht verständlich machen wenn er versucht zu sprechen, und deshalb kommt seine Familie auch nie auf die Idee, sich ihm als ein Wesen mit menschlicher Intelligenz zu nähern. (Man muss allerdings feststellen, dass sie in ihrer bürgerlichen Banalität schon irgendwie akzeptieren, dass die Kreatur auf eine unaussprechliche Weise ihr Gregor ist. Sie machen sich beispielsweise nie Gedanken darüber, dass ein riesiger Käfer Gregor aufgefressen haben könnte; dafür haben sie nicht die Fantasie, und Gregor wird sehr schnell zu einem Problem im Haushalt, nicht mehr.) Seine Verwandlung schließt ihn in sich selbst ein, so sicher, als wäre er komplett gelähmt geworden. Die zwei Szenarien, meines und Gregors, sind scheinbar so verschieden, dass man sich fragen könnte, warum ich sie überhaupt für vergleichbar halte. Ich behaupte, dass die Quelle dieser Verwandlungen dieselbe ist: wir sind beide aufgewacht und waren gezwungen zu erkennen, was wir wirklich sind, und diese Erkenntnis ist tiefgreifend und unumkehrbar; in beiden Fällen erwies sich die Wahnvorstellung als die neue, zwangsläufige Realität, und das Leben ging nicht so weiter wie bisher.
Ist Gregors Verwandlung ein Todesurteil oder auf irgendeine Weise eine tödliche Diagnose? Warum überlebt der Käfer Gregor nicht? Ist es sein menschliches Gehirn – depressiv und traurig und melancholisch – das die Kraft des Insekts untergräbt? Ist es das Gehirn, das den Drang des Käfers zu überleben besiegt, sogar den Drang zu essen? Was stimmt mit diesem Käfer nicht? Käfer, die in der Ordnung der Insekten Coleoptera genannt werden, was »umhüllte Flügel« bedeutet (obwohl Gregor seine eigenen Flügel scheinbar nie entdeckt, die vermutlich unter den festen Flügeldecken versteckt sind), sind bemerkenswert zäh und können sich gut anpassen, wenn es ums Überleben geht; auf der Welt gibt es mehr Arten von Käfern als von irgendeiner anderen Spezies. Nun, wir erfahren, dass Gregor eine schwache Lunge hat, die nicht »ganz vertrauenswürdig« ist – und so hat der Käfer Gregor ebenfalls eine schwache Lunge, oder zumindest das, was dieser bei einem Insekt entspricht, und vielleicht ist das seine tödliche Diagnose. Vielleicht ist es auch seine zunehmende Unfähigkeit zu essen, die ihn umbringt, so wie es Kafka erging, der zum Schluss Blut spuckte und mit vierzig an Entkräftung, verursacht durch Lungentuberkulose, starb. Was ist mit mir? Ist mein siebzigster Geburtstag ein Todesurteil? Ja, natürlich ist er das, und auf eine gewisse Weise hat mich das in mich selbst eingeschlossen, so sicher als wäre ich komplett gelähmt geworden. Diese Erkenntnis ist die Funktion des Betts, und des Träumens im Bett: der Mörtel, in dem die Einzelheiten des alltäglichen Lebens zerbröselt, geschliffen und mit Erinnerungen und Wünschen und Ängsten vermischt werden. Gregor erwacht aus unruhigen Träumen, die von Kafka nie genau beschrieben werden. Hat Gregor geträumt, dass er ein Insekt sei und wachte dann auf um festzustellen, dass er tatsächlich eines ist? »›Was ist mit mir geschehen?,‹ dachte er.« »Es war kein Traum« schreibt Kafka bezogen auf Gregors neue körperliche Gestalt, aber es ist unklar, ob seine unruhigen Träume vorausschauende Insektenträume waren. In dem Film – basierend auf George Langelaans Kurzgeschichte ›Die Fliege‹ –, bei dem ich am Drehbuch mitgeschrieben und Regie geführt habe, sagt unser Held Seth Brundle, gespielt von Jeff Goldblum, während er sich schon tief in den Geburtswehen zur Verwandlung in ein abscheuliches Fliege/Mensch-Wesen befindet: »Ich bin ein Insekt, dass davon geträumt hat, das es einmal ein Mensch war, und es geliebt hat. Aber jetzt sind die Träume vorbei, und das Insekt ist wach.« Er warnt seine frühere Geliebte, dass er jetzt eine Gefahr für sie darstellt, dass er eine Kreatur ohne Mitleid und ohne Empathie ist. Er hat seine Menschlichkeit abgestreift wie eine Zikadenlarve ihre Hülle, und was zum Vorschein kam, ist nicht länger menschlich. Er deutet außerdem an, dass ein Mensch zu sein, ein Bewusstsein von sich selbst zu haben, ein Traum ist, der nicht anhält – eine Illusion. Auch Gregor hat Schwierigkeiten, an dem festzuhalten, was von seiner Menschlichkeit noch geblieben ist, und als seine Familie irgendwann das Gefühl hat, dass das Ding in Gregors Zimmer nicht mehr Gregor ist, empfindet Gregor das auch so. Doch anders als Brundles Fliegen-Ich ist Käfer Gregor für niemanden eine Gefahr außer für sich selbst, und er verhungert und siecht wie beiläufig dahin, während seine Familie die Freiheit von der beschämenden, peinlichen Bürde, die er geworden ist, feiert.
Als ›Die Fliege‹ 1986 in die Kinos kam, gab es viele Vermutungen, dass die Krankheit, die Brundle sich zugezogen hatte, eine Metapher für AIDS war. Ich verstand das – AIDS war in den Köpfen allgegenwärtig, als die enorme Verbreitung der Krankheit nach und nach enthüllt wurde. Aber für mich war Brundles Krankheit viel fundamentaler: er alterte auf künstlich beschleunigte Weise. Er besaß ein Bewusstsein, dass sich darüber im Klaren war, dass es sich in einem sterblichen Körper befand, und er ging mit geschärfter Aufmerksamkeit und Humor in die unvermeidliche Verwandlung, die uns allen bevorsteht, wenn wir nur lange genug leben. Im Gegensatz zu dem passiven und hilfsbereiten, aber unbekannten Gregor war Brundle ein strahlender Stern am Wissenschaftshimmel, und es war ein kühnes und waghalsiges Experiment, bei dem er Materie durch den Raum transportieren wollte (seine DNA vermischt sich dabei mit der einer umhersurrenden Fliege), dass ihn in seine missliche Lage brachte.
Langelaans Geschichte, die zuerst 1957 im »Playboy« veröffentlicht wurde, gehört klar zum Genre der Science Fiction: alle mechanischen Einzelheiten und Ideen seines wissenschaftlichen Helden sind sorgfältig, ja sogar fantasievoll konstruiert (zwei alte Telefonzellen inklusive). Kafkas Geschichte ist natürlich keine Science Fiction; sie löst keine Diskussion bezüglich Technologie oder der Hybris wissenschaftlicher Forschung oder der Nutzung einer solchen Forschung für militärische Zwecke aus. Da sie ohne solche Fallen der Science Fiction auskommt, zwingt uns ›Die Verwandlung‹, über sie als Analogie nachzudenken, als etwas zu Interpretierendes – obwohl es verräterisch ist, dass keine der Figuren in der Geschichte, auch Gregor nicht, in solchen Begriffen denkt. Es gibt kein Nachsinnen über ein Familiengeheimnis oder eine Sünde, die eine solch monströse Vergeltungsmaßnahme seitens Gott oder dem Schicksal ausgelöst haben könnte, keine Suche nach der Bedeutung, nicht einmal auf der grundsätzlichen existentiellen Ebene. Das bizarre Ereignis wird auf eine oberflächliche, triviale, materialistische Weise abgehandelt, und ruft die kleinste Auswahl an emotionalen Reaktionen hervor, die man sich denken kann. Beinahe sofort nimmt die Geschichte den Ton eines unglücklichen Vorfalls in der Familie an, mit dem man nun widerwillig fertigwerden muss.
Geschichten über eine magische Verwandlung waren schon immer ein Teil des menschlichen Erzählkanons. Sie drücken das universelle Gefühl der Empathie aus, das wir für alle Lebewesen empfinden; sie zeigen den Wunsch nach Transzendenz, den auch jede Religion besitzt; sie regen uns zu der Überlegung an, ob die Verwandlung in ein anderes Lebewesen ein Beweis für die Möglichkeit der Reinkarnation und eines wie auch immer gearteten Jenseits ist, und sind deshalb, egal wie abscheulich oder katastrophal die Erzählung verläuft, ein religiöser und hoffnungsvoller Entwurf. Mein Brundlefliege jedenfalls geht durch Momente von manischer Kraft und Macht, in denen er davon überzeugt ist, dass er die besten Teile von Mensch und Insekt in sich vereint und ein Überwesen ist. Er weigert sich, seine Entwicklung als etwas anderes als einen Sieg zu sehen, sogar als er anfängt, seine menschlichen Körperteile zu verlieren, die er sorgfältig in einem Medizinschrank aufbewahrt, den er das Brundle-Museum für Naturkunde nennt.
Nichts davon findet sich in ›Die Verwandlung‹. Der Samsakäfer ist sich kaum bewusst, dass er ein hybrides Wesen ist, obwohl er kleine hybride Vergnügen genießt, wenn er darauf stößt, egal ob er an der Decke hängt oder durch das Chaos und den Dreck in seinem Zimmer kriecht (Vergnügen des Käfers), oder der Musik lauscht, die seine Schwester auf der Violine spielt (Vergnügen des Menschen). Aber die Familie Samsa ist die Basis und der Käfig für den Samsakäfer, und er unterwirft sich den Bedürfnissen der Familie vor und nach der Verwandlung soweit, dass er letztendlich zu der Erkenntnis gelangt, dass es bequemer für sie wäre, wenn er einfach verschwände: es wäre ein Beweis seiner Liebe für sie, und so tut er genau das und stirbt leise. Das kurze Leben des Samsakäfers – obwohl es so fantastisch ist – wird ausschließlich auf der Ebene des absolut Profanen und Funktionalen durchgespielt, und löst bei keiner der Figuren in der Geschichte auch nur einen Hauch von Philosophie, Besinnung oder tiefgründigem Nachdenken aus. Wie ähnlich wäre die Geschichte gegenüber der Version, dass die Familie Samsa an jenem schicksalhaften Morgen im Zimmer ihres Sohnes nicht den jungen, dynamischen Handelsreisenden vorfindet, der sie durch seine selbstlose und unendliche Arbeit unterstützt, sondern einen schlurfenden, halbblinden, kaum gehfähigen achtzigjährigen Mann, der sich an insektenartigen Krücken fortbewegt; ein Mann, der unzusammenhängend vor sich hinmurmelt und seine Hosen beschmutzt hat und aus dem Schattenreich seiner Demenz heraus Wut ausstrahlt und Schuldgefühle hervorruft? Was, wenn Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte und sich dort in seinem Bett in einen dementen, invaliden, fordernden alten Mann verwandelt fände? Seine Familie wäre entsetzt, aber würde ihn irgendwie noch als ihren Gregor erkennen, wenn auch verändert. Doch schließlich, so wie in der Käfervariante der Geschichte, beschließen sie, dass er nicht länger ihr Gregor ist, und dass es ein Segen wäre, wenn er verschwände.
Als ich damals die Pressetour für ›Die Fliege‹ absolvierte, wurde ich oft gefragt, welches Insekt ich gerne wäre, wenn ich mich einer entomologischen Verwandlung unterziehen würde. Meine Antworten variierten je nach meiner Stimmung, doch ich hatte eine Schwäche für die Libelle, nicht nur wegen ihrer spektakulären Flugkünste, sondern auch wegen ihres grausamen Larvenstadiums mit der tödlichen, ausdehnbaren Fangmaske. Außerdem dachte ich, dass Paarung während des Fliegens Spaß machen würde. Wäre das dann Ihre Seele – die Libelle, die himmelwärts fliegt?, war eine der Reaktionen darauf. Ist das nicht das, wonach Sie wirklich suchen? Nein, eigentlich nicht, antwortete ich. Ich wäre einfach eine normale Libelle, und wenn ich es vermeiden könnte, von einem Vogel oder einem Frosch gefressen zu werden, würde ich mich paaren, und wenn der Sommer vorbei wäre, würde ich sterben.
Aus dem Englischen von Martina Wolff
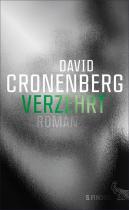
David Cronenberg entführt uns auf die verbotene Seite des Lebens – dorthin, wo man den anderen aus Liebe verschlingt.
Naomi ist Journalistin, Nathan Fotograf - immer unterwegs, ist das Paar meist getrennt, aber stets per Facebook verbunden. Sie sind die perfekten Globetrotter. Naomi recherchiert in Paris ein sonderbares Verbrechen. Nathan fotografiert in einer Budapester Spezialklinik eine riskante Operation. Das Abgründige zieht sie an, stürzt die beiden in eine leidenschaftliche Amour fou im freien Fall. Verstörend unheimlich scheint der Roman mehr von uns zu wissen, als wir selbst wahrhaben wollen.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /