Um das zu verstehen, muss man Sammler sein. Einer, der kein Sammler ist, sondern bloß die Kunst liebt, geht ins Museum und bewundert und staunt dort. Ein Sammler dagegen besitzt, was er liebt, und Sammlerliebe ist unersättlich. Doch ist Cornelius Gurlitt überhaupt ein Sammler, wie sein Vater Hildebrand zweifellos einer gewesen ist, der geraubte, enteignete Kunst günstig erwarb, zusammenraffte, versteckte?
Wir wissen noch lange nicht alles über den Fall. Eines scheint gewiss:
Cornelius Gurlitt sammelte nicht selbst, bediente sich der geerbten Sammlung nur zum Lebensunterhalt. Er ist noch nicht einmal ein richtiger Kunsthändler wie sein Vater. Cornelius Gurlitt hortete einen Schatz, dessen Preis er vermutlich so wenig kennt wie seinen Wert.
Für meinen demnächst erscheinenden Roman ›Susanna im Bade‹, dessen Held ein Kunstsammler ist, bin ich seit Jahren mit Sammlern unterwegs und versuche, ihre Motive zu erkunden. Auch mein Sammler – Hans Achberg – kann sich nicht trennen von seiner Kunst, obwohl ihm allmählich das Geld ausgeht. Zwar sind Arbeiten bekannter Künstler seit Jahrzehnten die rentierlichste Anlageform. Doch der wahre Sammler ist kein Investor, der Gewinne realisiert.
Nicht wenige Sammler sind Süchtige. Der große Hirnforscher Eric Kandel erklärt es so: Die Neuronen im Gehirn sprechen auf ein Liebesobjekt der Kunst ganz ähnlich an, wie die Neuronen eines Kokainabhängigen auf Kokain. So entwickelt auch ein süchtiger Sammler kriminelle Energien, zumindest mangelt es ihm an Unrechtsbewusstsein, zumal, wenn er Kunst ausstellt, verleiht, an Museen schenkt, also der Gesellschaft Gutes tut.
Sammelsucht ist zum Äußersten gesteigerte Leidenschaft. Sie zählt für den von ihr Befallenen weit mehr als das gerade gültige allgemeine Rechtsempfinden. Ganz selbstverständlich bringt mein Romanheld das Vermögen, das er der Kunst widmet, vor der Begehrlichkeit des Staates in Sicherheit.
Das Paradox besteht darin, dass der Sammler weniger materiell denkt als der Staat. Auch im Fall Gurlitt sah der Staat lange nur steuerliche Interessen. Deshalb verschleppte er skandalöser Weise die Veröffentlichung des Funds und dessen Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer.
Im Übrigen ist der Erwerb von Kunst eine halbwegs sichere (und gebräuchliche) Methode der Geldwäsche. Schmutziges Geld wird in einige Quadratmeter Abendland verwandelt. Nobler geht es nicht. Die Moral des Sammlers ist nicht die übliche Moral. Das ist das Skandalöse – auch meines Romans, der ja seiner Figur folgen muss und nicht den Maßstäben des Staatsanwalts.
Eine Sammlung ist mehr als die Summe ihrer Stücke. Eine Sammlung ist ein eigener Organismus. Sie ist das vom Sammler geschaffene Kunstwerk, das sich aus den Arbeiten seiner Künstler zusammensetzt. Ein Kunstwerk, von dem er hofft, dass es ihn überdauern wird. Die Vorstellung vom Sammler als Künstler – oder wenigstens in Nähe und auf Augenhöhe der Künstler – ist ein wesentliches Motiv vieler Sammler. Ein anderes: Der Sammler glaubt, mittels seiner Sammlung mehr über sich selbst zu erfahren. Ich bin, was ich sammle. Nicht selten ist Sammeln die Selbsterhöhung schwacher Persönlichkeiten. Kunst als Egostütze.
So ist die Sammlung der Schatten, den der Sammler wirft. Ein Schatten, der länger ist als der, den die Persönlichkeit des Sammelnden ohne seine Kunst werfen würde. Wer verkauft schon seinen Schatten? Ein Sammler paktiert zwar gelegentlich mit dem Teufel, so wie es der alte Gurlitt getan hat. Seinen Schatten aber gibt er nicht her.
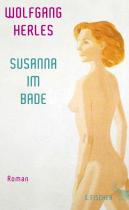
Hans Achberg ist süchtig nach Schönheit. Als Kunstsammler hat er sich auf Bilder spezialisiert, die schöne Frauen zeigen, und auch als Mann verehrt er bildschöne Frauen. Als er bei der Biennale in Venedig auf die Kunstagentin Susan Palmer trifft, ist es um ihn geschehen. Aber Achberg hat Probleme. Erstens zeigt sich das lebendige Kunstwerk Susan eher unzugänglich, zweitens behauptet eine Erpresserin, von Achbergs unversteuertem Geld in Liechtenstein zu wissen. Als zwei seiner Freunde, ebenfalls mit Kontakten zu Susan und Schwarzgeld in der Schweiz, zu Tode kommen, muss Achberg eine Entscheidung treffen: Richtet ihn die Kunst zugrunde oder hilft sie ihm zu leben?






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /