Wohin fuhr ich? Ach ja: nach Greifswald. Zur Tagung »Junge Literatur in Europa«, 10. bis 12. November 2016, Internationales Begegnungszentrum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Bahnhofstraße 2/3. Wie lange war ich nicht mehr in der Stadt gewesen? Drei oder vier Jahre, glaube ich. Mein Vater ist hier geboren worden und verbrachte einen kleinen Teil seiner Kindheit in der Steinbeckerstraße, eine Freundin, die mal meine Freundin war, studierte hier elf oder zwölf Semester lang Skandinavistik und Betriebswirtschaftslehre, und ein paar meiner Verwandten wohnen noch in der Nähe, allerdings in Stralsund. Außerdem, und das ist jetzt wirklich nicht unwesentlich, habe ich einen nie erschienenen Roman über diese merkwürdige Stadt geschrieben, ›Die Konföderation der Füchse‹: Darin zieht eine gewaltige Kriegsschiffsflotte unbekannten Ursprungs über die Ostsee und geht schließlich im Greifswalder Bodden vor Anker, woraufhin die Bundeswehr die wundervolle Innenstadt Greifswalds zum militärischen Sperrgebiet erklärt und der Kinderarzt Dr. Thomassus Timble sich zum autoritär regierenden Erlöser der eingeschlossenen Bevölkerung aufschwingt – ganz, ganz grob zusammengefasst. Diese kleine Vorrede nur, um zu ... ja, wozu eigentlich? Ich habe mir während der diesjährigen Tagung »Junge Literatur in Europa« viele Fragen gestellt, einige laut, andere nur im Stillen. Zwei davon waren direkt an mich selbst und meine mit mir anwesenden Kolleginnen und Kollegen gerichtet, Schriftsteller wie ich, und sie lauteten sinngemäß: Warum sind wir hier? Und: Wer sind wir eigentlich? Tja. Ich war vorher noch nie auf einer Tagung wie dieser gewesen, auf der Autorinnen und Autoren zusammenkommen, um sich und ihre literarischen Arbeiten anderen Autorinnen und Autoren und einer interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, am Hafen Fischbrötchen zu essen und am Abend gemeinsam durch die hanseatischen Brauhäuser zu ziehen. Möglicherweise bin ich mit einer Vorstellung zu diesem Ereignis gefahren, die ich mir bei einem Herrn namens Friedrich Mayer (ich würde gerne mehr Biographisches über ihn berichten, aber in meinen alten Notizen findet sich nichts) abgeschaut habe, der im Jahr 1833 über eine der ersten Tagungen der Reihe »Junge Literatur in Europa« folgendes zu berichten wusste:
»[E]s fehlte ihr keines jener Attribute eines regen, rührigen, scherzhafternsten Volkstreibens, die sich auf einem süddeutschen Jahrmarkt zeigen; eine Harfnerin verdrängte die andere, eine Mordgeschichte wurde nach der anderen abgeorgelt, und mein Lebtage habe ich noch nicht so viele rosige Gesichter [...] herumwandeln sehen, als hier, und während ich schreiben will, spielt unter meinem Fenster eine possierliche Affenkomödie …«
Vorstellung und Wirklichkeit – damit schlagen sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja unentwegt herum wie mit einer allgegenwärtigen, hoch ansteckenden, potentiell tödlich verlaufenden Krankheit, und ich hatte das Gefühl, dass es auch auf der Tagung »Junge Literatur in Europa« hauptsächlich oder am Rande oder irgendwie oder eben doch vorrangig darum ging. Was schön daran ist: Wirklich jeder hat ja so seine Vorstellungen von sich, von der Literatur, von der Liebe, von Europa, vom 19., 20. oder 21. Jahrhundert, von der Demokratie, von der Zukunft, vom Hass, von den Tieren des Waldes, vom guten Leben und von den Idioten, die einem im Nacken sitzen (Idioten des Alltags, Idioten der Politik, Idioten des militärisch-industriellen Unterhaltungskomplexes). Was nicht so schön daran ist: ein gewaltiges, niemals auflösbar erscheinendes Gefühl, dass diese Vorstellungen nicht in Einklang zu bringen sind mit der uns umgebenden Wirklichkeit. Ein solches Gefühl überwältigte mich auch in Greifswald (es überwältigt mich aber auch in Leipzig, in Frankfurt an der Oder, selbst in Lörrach, wo ich noch nie war, oder auf einem Campingplatz im Harz, doch in Greifswald wilderte es besonders rabiat und unkoordiniert in meinem zarten Inneren herum). Was also tun? Unter der Dusche im Hotel Adler, südlich des Greifswalder Heimattierparks gelegen, wandte mein in den vorherigen Tagen gehörig durch die Mangel gedrehter Verstand einen satanischen Trick an, um einen Umgang mit dem großen Dilemma zu entwickeln, das die Auseinandersetzungen im Internationalen Begegnungszentrum in der Bahnhofstraße aufgedeckt hatten: Ich stellte mir allen Ernstes die Frage, ob ich mir die gesamte Tagung »Junge Literatur in Europa« nicht einfach bloß ausgedacht hatte, also auch die anwesenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die anwesenden Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, die anwesenden Studierenden der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, die Veranstalter von der Hans-Werner-Richter-Stiftung, die Hans-Werner-Richter-Stiftung, das Internationale Begegnungszentrum in der Bahnhofstraße, die Bahnhofstraße, die Fischbrötchenverkäuferin am Hafen und die Landschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitsamt der gottverlassenen Autobahn, den leeren Feldern und der stillen Ostsee, nämlich damals schon, als ich meinen irrlichternden Roman über Greifswald zu schreiben begonnen hatte – so groß und unbearbeitet erschien mir jenes Problem, bei dem es darum ging, das eigene Schreiben, die sogenannte Vorstellung, mit den schillernden Exzessen der Gegenwart, der sogenannten Wirklichkeit, zu verrechnen. Das war ziemlich schrecklich, weil ich dabei ja auch eine Heidenangst bekam (während das aus der Brause prasselnde Wasser seine Temperatur fröhlich von heiß zu kalt zu heiß zu kalt wechselte), und das war gleichzeitig ziemlich toll, weil mir plötzlich allerlei Möglichkeiten in Aussicht gestellt wurden, die mir zuvor noch gar nicht in den Sinn gekommen waren. Nur zwei von vielen lauteten: Das Gespräch ist immer möglich. Und: Es gibt immer eine Alternative. Die Wirklichkeit ist niemals so stabil, als dass sie nicht verändert werden oder, protestantischer gedacht, hinterfragbar erscheinen könnte. Wer schreibt, kommuniziert ausschließlich (am Ende vielleicht nur mit sich selbst, aber immerhin), und wer ein Gespräch beginnt, nimmt augenblicklich Einfluss auf sein Gegenüber (während dieser Einfluss gleichermaßen auf sie oder ihn ausgeübt wird). Das, dachte ich mir später beim Wurst-Käse-Frühstück, ist es doch, was so leicht zu begreifen ist: Kunst fügt der bestehenden Wirklichkeit immer eine gänzlich neue Wirklichkeit hinzu und gestaltet sie somit komplett um. Damit einher geht so eine immense Verantwortung, dass man am liebsten den Schwanz (oder meinetwegen auch eines seiner Öhrchen) einziehen möchte, aber wer hat gesagt, dass man zum Schreiben keinen Mut braucht? Schriftstellerinnen und Schriftsteller irren sich ständig, und jeder kann ihnen mit heller Freude beim Scheitern zusehen, denn unsere Texte sollen ja auch nichts anderes sein als geöffnete Herzen (huch!), die munter, furchtlos und in großer Ernsthaftigkeit innerste Gedanken ausplaudern, die so noch niemand vorher gedacht hat. Wer jetzt von Europa schreibt, der schreibt von einem Europa, das es so noch nie gegeben hat, das es heute nicht gibt und das es möglicherweise in der Zukunft nicht geben wird – darin allein liegt die Chance der Literatur. Wer Ohren hat zu sehen und Augen hat zu hören, wer überfordert wird, wem etwas zugetraut wird und wer nicht allein gelassen wird mit seinen Problemen, der bekommt was mit:
»kenne die Alternativen,
um den Feind zu besiegen
kenne die Alternativen«
Wurde auf der Tagung darüber gesprochen? Ja, aber auf jeden Fall nicht genug. Es wird weiter darüber zu sprechen sein, immer wieder, immer neu, immer anders. Und es wird weiter darüber zu schreiben sein, immer wieder, immer neu, immer anders, anders, anders, verdammt noch mal. Authentizität ist keine Lösung. Die Wiederholung des ewig Gleichen ist keine Lösung. Die mexikanische Mauer ist keine Lösung. Duchamps bescheuertes Urinal ist keine Lösung (auch wenn es im ersten Moment so erscheinen mag). Alexander Gauland ist keine Lösung. Die einfache Lösung ist auf gar keinen Fall eine Lösung.
Auf seinem Nachhauseweg von der im Jahr 1894 stattgefundenen Tagung »Junge Literatur in Europa« notierte der französische Geistliche und Begründer der Phonetik Jean-Pierre Rousselot in sein Smartphone:
»In kleinen Nachbargärten spielen die pommerschen Kinder mit blauen Augen und fast farblosen Haaren, auf eine etwas langsame, unzugängliche Art.«
Addendum:
Schenksche Apotheke
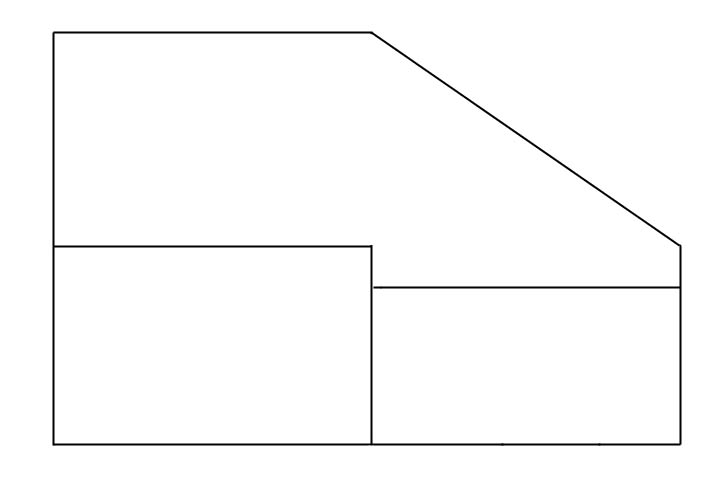 1845.
1845.
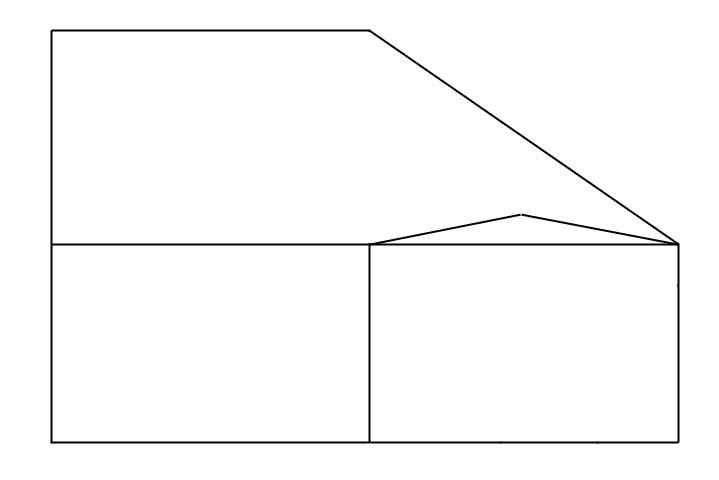 1851.
1851.
Mit Materialien aus:
Hannes Becker: ›Zentrale Anweisung vor dem Verlassen der Städte‹. In: Anke Bastrop; Wolfram Lotz; Johanna Maxl (Hg.): ›Tippgemeinschaft 2009. Jahresanthologie der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig‹. Leipzig 2009, S. 40–43.
Alfried Krause; Martin Richter: ›Dokumente erzählen vom Werden Mecklenburg-Vorpommerns‹. Schwerin 1993.
Wolfram Lotz: ›Notizbuch‹ (unveröffentlicht, o. O.).
Sascha Macht: ›Greypffswald / Zeichen‹ (unveröffentlicht, o. O.).
Ruth Schmekel: ›Nun ging ich Greifswald zu. Das Bild einer Stadt in fünf Jahrhunderten‹. Hamburg 2001.
»[E]s fehlte ihr keines jener Attribute eines regen, rührigen, scherzhafternsten Volkstreibens, die sich auf einem süddeutschen Jahrmarkt zeigen; eine Harfnerin verdrängte die andere, eine Mordgeschichte wurde nach der anderen abgeorgelt, und mein Lebtage habe ich noch nicht so viele rosige Gesichter [...] herumwandeln sehen, als hier, und während ich schreiben will, spielt unter meinem Fenster eine possierliche Affenkomödie …«
Vorstellung und Wirklichkeit – damit schlagen sich die Schriftstellerinnen und Schriftsteller ja unentwegt herum wie mit einer allgegenwärtigen, hoch ansteckenden, potentiell tödlich verlaufenden Krankheit, und ich hatte das Gefühl, dass es auch auf der Tagung »Junge Literatur in Europa« hauptsächlich oder am Rande oder irgendwie oder eben doch vorrangig darum ging. Was schön daran ist: Wirklich jeder hat ja so seine Vorstellungen von sich, von der Literatur, von der Liebe, von Europa, vom 19., 20. oder 21. Jahrhundert, von der Demokratie, von der Zukunft, vom Hass, von den Tieren des Waldes, vom guten Leben und von den Idioten, die einem im Nacken sitzen (Idioten des Alltags, Idioten der Politik, Idioten des militärisch-industriellen Unterhaltungskomplexes). Was nicht so schön daran ist: ein gewaltiges, niemals auflösbar erscheinendes Gefühl, dass diese Vorstellungen nicht in Einklang zu bringen sind mit der uns umgebenden Wirklichkeit. Ein solches Gefühl überwältigte mich auch in Greifswald (es überwältigt mich aber auch in Leipzig, in Frankfurt an der Oder, selbst in Lörrach, wo ich noch nie war, oder auf einem Campingplatz im Harz, doch in Greifswald wilderte es besonders rabiat und unkoordiniert in meinem zarten Inneren herum). Was also tun? Unter der Dusche im Hotel Adler, südlich des Greifswalder Heimattierparks gelegen, wandte mein in den vorherigen Tagen gehörig durch die Mangel gedrehter Verstand einen satanischen Trick an, um einen Umgang mit dem großen Dilemma zu entwickeln, das die Auseinandersetzungen im Internationalen Begegnungszentrum in der Bahnhofstraße aufgedeckt hatten: Ich stellte mir allen Ernstes die Frage, ob ich mir die gesamte Tagung »Junge Literatur in Europa« nicht einfach bloß ausgedacht hatte, also auch die anwesenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die anwesenden Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, die anwesenden Studierenden der Ernst-Moritz-Arndt-Universität, die Veranstalter von der Hans-Werner-Richter-Stiftung, die Hans-Werner-Richter-Stiftung, das Internationale Begegnungszentrum in der Bahnhofstraße, die Bahnhofstraße, die Fischbrötchenverkäuferin am Hafen und die Landschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mitsamt der gottverlassenen Autobahn, den leeren Feldern und der stillen Ostsee, nämlich damals schon, als ich meinen irrlichternden Roman über Greifswald zu schreiben begonnen hatte – so groß und unbearbeitet erschien mir jenes Problem, bei dem es darum ging, das eigene Schreiben, die sogenannte Vorstellung, mit den schillernden Exzessen der Gegenwart, der sogenannten Wirklichkeit, zu verrechnen. Das war ziemlich schrecklich, weil ich dabei ja auch eine Heidenangst bekam (während das aus der Brause prasselnde Wasser seine Temperatur fröhlich von heiß zu kalt zu heiß zu kalt wechselte), und das war gleichzeitig ziemlich toll, weil mir plötzlich allerlei Möglichkeiten in Aussicht gestellt wurden, die mir zuvor noch gar nicht in den Sinn gekommen waren. Nur zwei von vielen lauteten: Das Gespräch ist immer möglich. Und: Es gibt immer eine Alternative. Die Wirklichkeit ist niemals so stabil, als dass sie nicht verändert werden oder, protestantischer gedacht, hinterfragbar erscheinen könnte. Wer schreibt, kommuniziert ausschließlich (am Ende vielleicht nur mit sich selbst, aber immerhin), und wer ein Gespräch beginnt, nimmt augenblicklich Einfluss auf sein Gegenüber (während dieser Einfluss gleichermaßen auf sie oder ihn ausgeübt wird). Das, dachte ich mir später beim Wurst-Käse-Frühstück, ist es doch, was so leicht zu begreifen ist: Kunst fügt der bestehenden Wirklichkeit immer eine gänzlich neue Wirklichkeit hinzu und gestaltet sie somit komplett um. Damit einher geht so eine immense Verantwortung, dass man am liebsten den Schwanz (oder meinetwegen auch eines seiner Öhrchen) einziehen möchte, aber wer hat gesagt, dass man zum Schreiben keinen Mut braucht? Schriftstellerinnen und Schriftsteller irren sich ständig, und jeder kann ihnen mit heller Freude beim Scheitern zusehen, denn unsere Texte sollen ja auch nichts anderes sein als geöffnete Herzen (huch!), die munter, furchtlos und in großer Ernsthaftigkeit innerste Gedanken ausplaudern, die so noch niemand vorher gedacht hat. Wer jetzt von Europa schreibt, der schreibt von einem Europa, das es so noch nie gegeben hat, das es heute nicht gibt und das es möglicherweise in der Zukunft nicht geben wird – darin allein liegt die Chance der Literatur. Wer Ohren hat zu sehen und Augen hat zu hören, wer überfordert wird, wem etwas zugetraut wird und wer nicht allein gelassen wird mit seinen Problemen, der bekommt was mit:
»kenne die Alternativen,
um den Feind zu besiegen
kenne die Alternativen«
Wurde auf der Tagung darüber gesprochen? Ja, aber auf jeden Fall nicht genug. Es wird weiter darüber zu sprechen sein, immer wieder, immer neu, immer anders. Und es wird weiter darüber zu schreiben sein, immer wieder, immer neu, immer anders, anders, anders, verdammt noch mal. Authentizität ist keine Lösung. Die Wiederholung des ewig Gleichen ist keine Lösung. Die mexikanische Mauer ist keine Lösung. Duchamps bescheuertes Urinal ist keine Lösung (auch wenn es im ersten Moment so erscheinen mag). Alexander Gauland ist keine Lösung. Die einfache Lösung ist auf gar keinen Fall eine Lösung.
Auf seinem Nachhauseweg von der im Jahr 1894 stattgefundenen Tagung »Junge Literatur in Europa« notierte der französische Geistliche und Begründer der Phonetik Jean-Pierre Rousselot in sein Smartphone:
»In kleinen Nachbargärten spielen die pommerschen Kinder mit blauen Augen und fast farblosen Haaren, auf eine etwas langsame, unzugängliche Art.«
Addendum:
Schenksche Apotheke
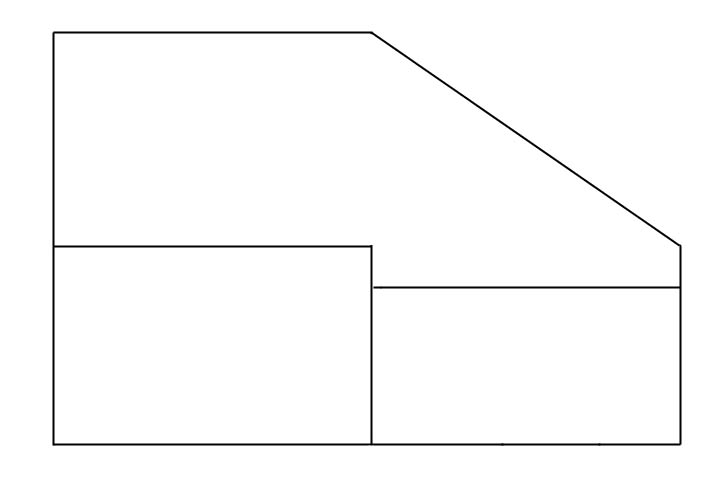 1845.
1845.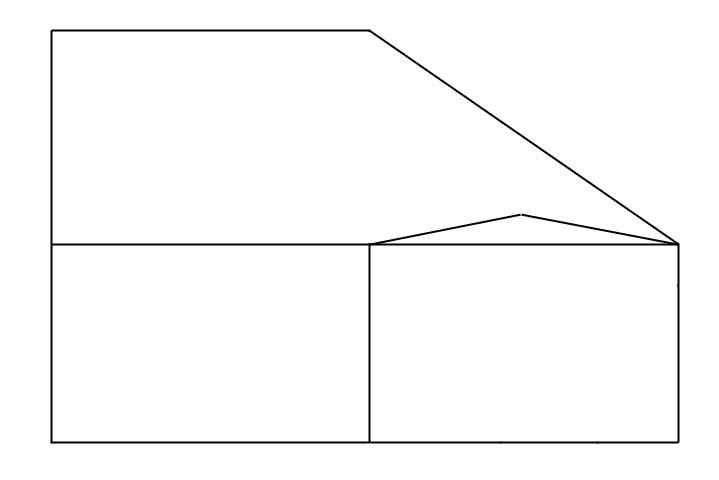 1851.
1851.Mit Materialien aus:
Hannes Becker: ›Zentrale Anweisung vor dem Verlassen der Städte‹. In: Anke Bastrop; Wolfram Lotz; Johanna Maxl (Hg.): ›Tippgemeinschaft 2009. Jahresanthologie der Studierenden des Deutschen Literaturinstituts Leipzig‹. Leipzig 2009, S. 40–43.
Alfried Krause; Martin Richter: ›Dokumente erzählen vom Werden Mecklenburg-Vorpommerns‹. Schwerin 1993.
Wolfram Lotz: ›Notizbuch‹ (unveröffentlicht, o. O.).
Sascha Macht: ›Greypffswald / Zeichen‹ (unveröffentlicht, o. O.).
Ruth Schmekel: ›Nun ging ich Greifswald zu. Das Bild einer Stadt in fünf Jahrhunderten‹. Hamburg 2001.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /