Von Martin Walser
Das darf, das muss vielleicht sogar dem Leser der Arnold-Stadler-Bücher auffallen, dass es immer wieder Sätze gibt, die immer wieder auftauchen. Sogar der Titel des Romans aus dem Jahr 2007 Komm, gehen wir, kommt schon auf Seite 68 wieder vor. Roland, Rosemarie am Strand auf Capri, es kommt der Amerikaner Jim und sagt nach einem längeren Gespräch zu den zweien: »Komm, gehen wir!« Und gleich auf Seite 75 heißt es von Jims Vater, »dass ihm keine mehr mit ihren Augen sagte: Komm, gehen wir!« Da ist aus dem Satz eindeutig ein erotisches Signal geworden. Und bei der Beschreibung eines Caravaggio-Bildes ist es Jesus persönlich, der mit dem Finger auf den heiligen Matthias zeigt und sagt: »Komm, gehen wir.« Dass Jim den Allerweltssatz gebrauchte und damit den »Schatz« abgelöst hatte durch »Baby« – was dazu führt, dass Rosemarie den Namen Jim so aussprach, als habe sie Baby gesagt – das lässt den Autor bemerken, dass »›Komm, gehen wir‹ zu sagen, eigentlich nur einmal möglich« sei. Aber dieser Autor hält sich nicht an Regeln, und seien es selbst gemachte. Ganz spät wird der Allerwelts- oder Standardsatz sogar zur Kapitel-Überschrift: »Der Tod war schon zu einem Bruder geworden, der ›Komm, gehen wir‹ sagte an Allerseelen.« Dazu darf man wissen, dass Roland an Allerseelen Geburtstag hat. Aber Jim eben auch. Und dann, einige Bücher danach, in New York machen wir das nächste Mal heißt es mittendrin: »Der Gedanke an den Tod war schon fast zu einem Bruder geworden, der ›Komm, gehen wir‹ sagte.« Und auch hier wieder an Allerseelen.
Es gibt eine ganze Reihe solcher Allerwelts- oder Standardsätze. Zum Beispiel: Wenn Jim mit einer Frau verschwunden ist und davon zurückkommt und Roland fragt, was er gemacht habe, dann antwortet Jim regelmäßig: »Ich habe gelebt.« Und beim letzten Mal, als Jim bei Hermine war – und Hermine ist der Inbegriff weiblicher Geschlechtsmächtigkeit, sie weiß schon Ende 1944 was Pettycoat heißt –, da sagt er, wenn er von ihr kommt: »Wir haben gelebt.«
Weitere Standardsätze: »Tragisch ist, wenn es nicht anders geht.« Und zwar sowohl in Hollywood wie in den innigsten Stadler-Orten Lebensweiler und Himmelreich. Der vielleicht am häufigsten nötige Satz ist: »Vielleicht war es doch leichter, einen Liebesroman zu schreiben, als zu leben.« In seinem fortgeschrittensten Zustand wird auch dieser Satz zur Kapitel-Überschrift: »Wahrscheinlich war es sogar leichter, einen Liebesroman zu schreiben, als die Liebe zu leben.«
Roland ist von Capri an Schriftsteller. Und mehr als einmal erfahren wir, wie das Buch, das er schreibt, heißt: Ungewaschene Erinnerung an die Liebe. Es soll eine »Art Poesiealbum für Erwachsene« werden, »geschult in der Sehnsucht nach der Zukunft, die hinter ihnen lag«. Das ist überhaupt seine Erzählart. Es gibt immer, in jeder Begebenheit, diese Sehnsucht nach der Zukunft und gleichzeitig das Heimweh nach der Vergangenheit, die doch nur die Sehnsucht nach der Zukunft war. »Es war ja eine große Gleichzeitigkeit auf der Welt«, heißt es einmal, als wolle Arnold Stadler selber sagen, was ihm als Autor andauernd passiert. Und für einen Erzähler kann es keine riskantere Bestimmtheit geben als die: Anstatt einmal mehr dem total eingeführten Nacheinander zu dienen, die Kündigung der traditionell raunenden Beschwörung des Imperfekts und dafür die Eröffnung der Einmaligkeit des Immerwährenden. Ade Plot, ade Story! In der Story passiert etwas. Bei Arnold Stadler geschieht etwas, nämlich das, was immer geschieht. Und trotzdem ist, was er geschehen lässt, einmalig. Aber eben immer einmalig. Einmalig im Unaufhörlichen. Das ist der Zauber. Das ist Poesie. Das ist Existenz. Und das heißt: statt einer Story, Geschichte. Geschichte als das, was aus immerwährenden Einmaligkeiten entsteht. Und wie macht er das?
Am Anfang, am Strand von Capri, als der Amerikaner Jim zu Roland und Rosemarie kommt und um einen Schluck Wasser bittet, da folgt gleich: »Und sie erzählten sich ihr Leben.« Und Roland hatte bald »ein Unbehagen beim Zuhören bekommen, wie Rosemarie alles viel zu knapp und technisch, storyartig, erzählte, als wäre die Liebe ein Plot«. Arnold Stadler erzählt immer alles auf einmal und eben nicht storymäßig. Die Geschichte mit Marlene zum Beispiel. Marlene war nun blond, heißt es und Roland war jetzt grau, und sie hat ihr jüngstes Enkelkind dabei. Früher hieß sie Marieluischen. Und: »Sie war es, die sich hinlegte. Er war es, den er nun sagen hörte: ›Können wir uns jetzt bitte etwas freimachen?‹« Gehört, als er mit seiner Mutter beim Frauenarzt war. Und bilanziert gleich: »Das war die Sehnsucht des Etwas zum Nichts.« Dann heißt es: »Nein. Das war die Vertreibung aus dem Paradies.« Aber Arnold Stadler gemäß ist es, dass Anfang und Ende sich ineinander verschlingen. Arnold Stadler erzählt nie etwas nur einmal. Roland bringt Jim nach Kloten, dass der zurückfliege nach Amerika. Natürlich am Allerseelen-Morgen, seinem und Jims Geburtstag, und durchtönt von Echos, zum Beispiel vom Verdacht, im Suff gezeugt worden zu sein, also »ein Linkshänder im Kopf« zu sein usw. Drei Kapitel braucht der Autor, bis er diesen Abschied eingebettet hat in alle seine Geschichten, bis er sagen kann, »die Sehnsucht würde von nun an mit dem Heimweh verschmelzen … und Jim war nun endgültig unterwegs Richtung Amerika.«
Irgendwann wird von einem Professor berichtet, der jahraus jahrein lehrt, Kunst sei etwas erst, wenn es unvergesslich sei. Arnold Stadler ermäßigt diese edle Lüge; was unvergesslich sei, sei Liebe. Aber selbst das schreibt und schraubt er radikal herunter. Er feiert das rücksichtslos Gewöhnliche. »Roland jedenfalls war auf alle Fälle schon wieder einmal im zweiten Semester und schaute auf die Uhr. Er war noch dreiundzwanzig Jahre alt.« Bzw.: »Tragisch ist, wenn es nicht anders geht.«
Roland war es gelungen, Jim in sein zu Lebensweiler gehörendes Himmelreich zu lotsen, dann sind sie aber nachts in zwei Zimmern, und Roland hat weder die Kraft noch den Mut, hinüberzukommen zu Jim, und drunten läuft im Fernsehen der Blaue Bock, der Goldene Schuss oder Einer wird gewinnen, und Roland hört durch die Wand durch, dass Jim eine alte Nummer des Osservatore Romano liest, er hört, wie Jims Papier beim Blättern mit der Federbettdecke in Berührung kommt. Und drunten singt »die geliebte Anneliese Rothenberger zusammen mit Nikolai Gedda Tausend kleine Englein singen: Habt euch lieb – eine himmlische Musik …« Roland versetzt sie »mehrere Stiche wie ein Orgasmus«. Dazu gehört, dass auch dieser Samstagabend im Himmelreich unter der Überschrift steht, es sei »vielleicht leichter, einen Liebesroman zu schreiben, als zu lieben oder zu leben«. Drunten die Eltern mit der erlebten historischen Zeitfülle und mit den elterlichen Gefühlshoffnungen, den Sohn droben im Bett betreffend, drunten das epochale Fernsehen mit der Czardasfürstin, droben Roland, »saß derweil … aufrecht im Bett und lebte vor sich hin«. Diese Szenen erschüttern durch ihre Richtigkeit. Manch edles Buch kommt mir dagegen aufs feinste verlogen vor. Die Größe der Gewöhnlichkeit. Arnold Stadlers Figuren sind alles andere als außerordentlich. Der Autor meidet die Steigerung ins Ungewöhnliche. »Come, let´s go!«, hat Jim am Strand auf Capri gesagt.
Aber dass das klar ist: Seine Gewöhnlichkeiten sind das Gegenteil von Banalität. Sein Dorf heißt Lebensweiler. Seine Liegenschaft Himmelreich. Sein Arzt Dr. Mors. Und Jim ist in Amerika mit der Tochter des Leibarztes von Al Capone zusammen. Jims Mutter lebt in Florida mit dem Bruder von Ernest Hemingway und der wird sich wie der Bruder mit einem Gewehr erschießen. Das gleißt und glänzt aus allen Fugen. Und dass der Autor Rolands Einsamkeit und seine Aussichtslosigkeit, den geliebten Jim nebenan zu erreichen einem 100 Mal ablaufenden Fernseh-Samstagabend auszusetzen wagt, und diesen Blauen Bock und Goldenen Schuss kein bisschen als gewöhnlich abwertet, das produziert ein Pathos, das ergreifender nicht sein könnte. Für ihn ist es keine Rettung ins Kritische! Tragisch ist überall, wenn es nicht anders geht. In Hollywood und in Lebensweiler. Und dieser Roland, der auch noch erschöpft war »von einem Leben, das er doch gar nicht geführt hat«, der endet in einer »Hymne auf das Ja«. Ein Jubel ohnegleichen gelingt ihm. Roland lebt da » mit der ganzen Welt im Konkubinat und hatte mit ihr einen entsprechenden Orgasmus«. Ach, Arnold, entringt es sich da dem Leser, danke, danke für diesen existenziellen Salto mortale. So genau buchstabierst du uns und alles, dass du das Unerwartbarste geschafft hast: die Ja-Hymne! Nach den Strapazen des Daseins das Ja als reine Leistung.
Jetzt muss ich doch noch gestehen, dass ich, um Arnold Stadler sozusagen lebensfrisch zu seinem Sechzigsten gratulieren zu können, noch einmal gelesen habe, was ich schon gelesen hatte, und wieder dieses Erlebnis meiner Hilflosigkeit gegenüber seiner heftigen Gefühlsgenauigkeit. Und dabei auch noch die Stimmung: Niemand kommt für diese Bücher als Leser so in Betracht wie du. Nicht wegen irgendeiner lokalen Nähe, sondern weil ich glaubte, ich sei dafür da, diese Kunst zu rühmen, die im Einmaligen immer das Immerwährende feiert. Nie das eine oder das andere. Und die Einbildung, das bilde sich jeder Arnold Stadler- Leser ein, dass er der Arnold Stadler-Leser schlechthin sei, das sei eine typisch Stadlerʼsche Nähe-Leistung. Ach, Gott, und was Größe angeht, können seine Möggingerinnen mit den auf Einzigartigkeit dressierten Heroinen der Weltliteratur bequem konkurrieren: Sie sind »in ihr Unglück hineingewachsen wie andere in einen Schuh.«
Beweisen ist nicht mein Fach. Aber bezeugen. Ich möchte noch einen Hauch meiner Begeisterungen spüren lassen. Geglücktes Schreiben, das habe ich durch ihn erlebt. Noch und noch. Seine Wiederholungen sind Aktivierungen. Jedes Mal, wenn sie gebraucht werden, sind sie da, dann handeln sie. Natürlich erlebt der Leser sie auch als Echos und als Steigerung. Mich haben sie viel mehr bewegt als die Leitmotiv-Dressur bei Thomas Mann, (dem Arnold Stadler mehr als einmal wunderbar glückende Gedenkminuten widmet). Auf Seite 295 sagt Arnold Stadler: »Onkel Otto, der so große Hände hatte, vielleicht vom Arbeiten, dass ein Suppenlöffel in seiner Hand wie ein Teelöffel aussah …« Das meine ich mit geglücktem Schreiben. Ich kann ihm ja nicht mit einer Liebeserklärung kommen, aber eine Bewunderungserklärung darf es schon sein.
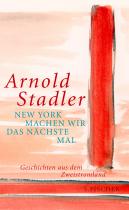
»Kaum hat der Mensch seinen Schreibtisch aufgeräumt, so glaubt er schon, es sei Ordnung möglich«, sagt Arnold Stadler, aber »Ordnung ist wohl nur eine Charakterfrage und beweist gar nichts.« Das Unaufgeräumte ist das Ordnungsprinzip von Stadlers Literatur. In ›New York machen wir das nächste Mal‹ erzählt er traurige und verträumte Geschichten: Es gibt ein unverhofftes Wiedersehen mit den alten Bekannten aus Stadlers großen Romanen, den schmerzhaft Verliebten und mit großer Geste Schüchternen. Es sind die, die ankommen und trotzdem nicht bleiben, die abreisen, um zu leben, die Ordnungs- und Glückssucher, die sich in diesen Denkbildern und Episoden wiedertreffen und so einen Empfang bereiten für ein weiteres Kapitel des einen, großen Werkes, an dem Arnold Stadler unermüdlich schreibt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /