1988 – es waren bereits mehr als 100 Bände erschienen – erhielt die Schwarze Reihe schließlich ihren offiziellen Namen: »Die Zeit des Nationalsozialismus«. Walter Pehle wurde ihr Herausgeber. Kurz darauf erschien eines der wichtigsten Werke nicht nur dieser Reihe, sondern der Holocaust-Forschung überhaupt: »Die Vernichtung der europäischen Juden« von Raul Hilberg, und zwar in einer dreibändigen, aktualisierten Ausgabe. Darin rekonstruiert der US-amerikanische Politikwissenschaftler, der 1939 als 13-Jähriger selbst mit seinen Eltern von Wien in die USA geflüchtet war, die In-Werk-Setzung des Völkermords. Für sein monumentales Buch, ursprünglich seine Dissertation, hatte der Autor unzählige Quellen ausgewertet – und erst sechs Jahre nach der Fertigstellung einen Verlag gefunden, der es 1961 in den USA herausgebrachte. Es dauerte weitere zwanzig Jahre, bis ein deutscher Verlag den Mut fand, es zu übersetzen: der kleine Berliner Verlag Olle & Wolter. Und noch einmal zehn Jahre vergingen, bis es Walter Pehle schließlich gelang, die drei Bände in die Schwarze Reihe aufzunehmen. Erst dann setzte die breite Rezeption von Hilbergs Studie ein. Eine Initialzündung – für die Reihe wie für die deutsche Holocaust-Forschung insgesamt. Das mag seltsam klingen, denn es gab natürlich bereits zahlreiche Bücher zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust. Auch hatte es schon viele Debatten über wichtige Fragen zu diesem Thema gegeben. Doch der Historikerstreit des Jahres 1986 wurde breiter als andere Debatten unter Historikern in den Feuilletons ausgetragen und kommentiert und somit auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen als frühere Auseinandersetzungen.
Im Jahr 1990 folgte die so genannte Goldhagen-Debatte, die an den Kern dessen ging, was immer unterschwellig mitschwang: Wie viel Schuld hatten »ganz normale« Menschen auf sich geladen? Was hatten die Deutschen wann über den Genozid an den Juden gewusst? Man muss Goldhagen nicht zustimmen, aber er hatte doch einen Nerv getroffen. Ähnliche Fragen prägen auch das Werk eines weiteren Autors der Schwarzen Reihe: Götz Aly. Zusammen mit Susanne Heim veröffentlichte er 1991 den Band »Vordenker der Vernichtung«. Darin decken die beiden Autoren auf, welche zentrale Rolle all die Schreibtischtäter gespielt hatten, die mit ideologischen Konzepten und strategischen Planungen den Vernichtungskrieg im Osten mit vorbereitet und initiiert hatten. Aly und Heim stellten das rationale Moment des Vernichtungskrieges heraus, womit sie an die Forschungen von Raul Hilberg anschlossen, und wieder entzündete sich eine große Debatte unter den Historikern: Lässt sich der Holocaust allein mit materiellen Motiven erklären? Viele widersprachen dieser These – doch dass finanzielle Interessen eine wichtige Rolle spielten, ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Materielle Aspekte stellte Götz Aly auch in seinem Buch »Endlösung« aus dem Jahr 1995 in den Vordergrund. Er sprach damit die Rolle all derer an, die keine Waffen trugen, die nicht in einem Konzentrationslager Häftlinge quälten und ermordeten, die nicht an den Schaltstellen der Macht saßen wie ein Himmler oder ein Heydrich. Die Motivation der Deutschen zur Beteiligung am Nationalsozialismus mit all seinen Verbrechen und die Frage nach den Vielen, die profitierten, ist ein Thema, das er seither immer wieder aufgegriffen hat.
Zu diesen seit Ende der 1980er Jahre verstärkt diskutierten und erforschten zentralen Fragen kam ein weltpolitisches Ereignis hinzu, das abermals die Forschungen der Historiker intensivieren sollte: Der Fall des »Eisernen Vorhangs« brachte eine Öffnung der Archive in vielen osteuropäischen Ländern mit sich. Die meisten Menschen waren im Zweiten Weltkrieg in den besetzten Ländern Osteuropas ermordet worden, und zwar nicht in Vernichtungslagern, sondern in Dörfern und Städten, wo offen Jagd auf sie gemacht wurde und sie ihre eigenen Gräber schaufeln und sich an deren Rändern aufstellen mussten, sodass sie von Gewehrsalven niedergemäht direkt in die Gruben fielen.
Eine Geschichte unvorstellbarer Gewalt, unglaublicher Gräuel, und doch muss sie erzählt und gehört werden. Die Bücher, die davon berichten, ob sie nun im Fischer Verlag oder anderswo erschienen sind, tragen dazu bei, dass die Wahrheit des Holocaust auch in späteren Generationen und nach dem Tod jener, die noch von ihrem eigenen Erleben berichten können, immer wieder neu anerkannt wird – anerkannt werden muss – auch wenn die Abwehr oft stark ist. Der Wunsch zu vergessen ist groß, das zeigt die jüngste Umfrage der Bertelsmann-Stiftung, laut der 81 Prozent der Deutschen einen »Schlussstrich« für angemessen halten. Ein seltsames Wort in diesem Zusammenhang, der »Schlussstrich« – ein distanziert-bürokratisches Bild für den Umgang mit dem Schlimmsten, das Menschen begegnen kann, Tod und Gewalt, der sie hilflos ausgeliefert sind.
Es kann in der Geschichte keinen Schlussstrich geben, und genau aus diesem Grund hat auch die Schwarze Reihe eine Zukunft. Als ich vor zwei Jahren in die großen Fußstapfen trat, die Walter Pehle hinterlassen hatte, war die Frage, wie es mit der Schwarzen Reihe weitergehen wird, natürlich zentral. Seitdem wurde mir bei meinen Begegnungen mit Historikerinnen und Historikern häufig diese Frage gestellt: Wird es die Schwarze Reihe weiter geben?
Selbstverständlich! Sie ist eine Institution. Die Generation von Historikerinnen und Historikern, die heute an den Universitäten lehrt und forscht, hat während ihrer Ausbildung viele dieser Bücher gelesen und sich an den darin formulierten Thesen und Ideen gerieben, entlanggearbeitet und oft selbst zu ihrer Erweiterung beigetragen. Diese enorm wichtige Tradition des Verlags soll fortbestehen. Doch wie genau wird dieses Weitermachen aussehen?
Seit ihren Anfängen vor nun bald vierzig Jahren hatte es sich bei der Schwarzen Reihe um eine reine Taschenbuchreihe gehandelt; darunter auch immer wieder Übernahmen von Hardcover-Publikationen anderer Verlage. Künftig werden viele Bände der Schwarzen Reihe als Hardcover-Bände erscheinen. Nicht mehr so oft in schwarzem Gewand, sondern als eigenständige Monographien mit einem Aussehen, das ihnen den Platz und die Aufmerksamkeit in den Buchhandlungen und Bibliotheken einräumt, der ihnen gebührt.
Viele große Fragen wurden inzwischen beantwortet. Neue, die Sicht auf den Nationalsozialismus und den Holocaust umstürzende Forschungsergebnisse wird es aller Voraussicht nach immer seltener geben. Doch oft sind es die Details, die es uns erlauben, einzelne Aspekte des Ganzen neu zu bewerten, neu zu verstehen. Es lohnt sich, sich auf diese Details einzulassen. An Studien mit lokalem Bezug etwa lässt sich die unvorstellbare Dynamik der Gewalt in einer Weise nachvollziehen, die einem beim Lesen mitunter den Atem stocken lässt.
Es ist notwendig, sich dieser Dynamik zu stellen, sie zu (er-)kennen. Ein Buch wie »Nachbarn« des polnisch-stämmigen Harvard-Historikers Jan Gross etwa, in dem das Massaker von Jedwabne – bei dem über 300 Juden von einem Mob aus polnischen Bürgern und deutschen Soldaten grausam niedergemetzelt wurden – genau erforscht und beschrieben wird, zeigt diese Dynamik und reicht mit seiner Erklärungskraft bis in die Gegenwart. Gleiches gilt für »1941«, ein Buch des kroatischen Publizisten Slavko Goldstein, das bislang noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, auf Englisch aber bereits erschienen ist. Goldstein beschreibt darin die Gewalttaten der faschistisch-nationalsozialistischen Ustascha-Miliz in Kroatien und macht gleichzeitig die brutale Gewalt zwischen Serben und Kroaten nachvollziehbar, welche die westlichen Länder Europas im Jahr 1992 so überraschte und erschütterte.
Gerade im Osten Europas, wo willkürliche Grenzziehungen zu immer neuen Konstellationen führten, schwelen nach wie vor zahlreiche Konflikte, die auf die Zeit des Zweiten Weltkrieges und danach zurückgehen. Es geht also nicht nur darum, aus akribischem Forscherinteresse noch ein Detail ans Licht zu zerren und noch eines, sondern darum, die Welt, in der wir heute leben, mit anderen Augen zu sehen. Zu diesem und anderen Themenkomplexen erscheinen also weiterhin Bücher in der Schwarzen Reihe, die neues Licht auf alte Fragen werfen.
Ich wünsche mir, dass unsere Autorinnen und Autoren damit immer wieder Zeichen setzen und Diskussionen anregen – provokante Thesen sind explizit erwünscht. Wir brauchen die Diskussion um den Nationalsozialismus und den Völkermord immer wieder aufs Neue, wir müssen darüber forschen, schreiben und auch streiten, um das Wissen und das Erinnern stetig wiederherzustellen, denn wie bereits gesagt:
Jede Generation muss sich neu mit diesem Thema auseinandersetzen.
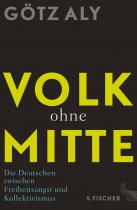
Der Mangel an Selbstbewusstsein und gemeinsamen Werten, die Suche nach dem eigenen Vorteil und ein starker Aufstiegswille führten dazu, dass die Deutschen dem nationalen Sozialismus in Massen folgten. In glänzend geschriebenen Essays eröffnet Götz Aly überraschende Einsichten in die geschichtlichen Konstellationen, welche die ungeheuerlich destruktive Energieentladung der zwölf kurzen Hitler-Jahre möglich machten. Er schildert individuelle Bereicherungen, zeigt, wie die Staatskasse und damit alle Deutschen von dem beispiellosen Raubzug in Europa profitierten, und belegt den Hang der Deutschen, nach dem Krieg Schuld und Verantwortung zu verlagern. Er zeigt, wie sehr nach 1945 der Korpsgeist und Karrierismus selbst in der Max-Planck-Gesellschaft und an historischen Instituten die Erforschung dieser Vergangenheit noch lange behinderten. Ein unbequemes Buch, das zum Weiterdenken anregt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /