In Wirklichkeit sind gutes Essen, Wein, ein Fluss zwischen Berghängen und die Erschlossenheit dieser Landschaftsform durch Treppen vermutlich ein ganz altes Seelenaggregat. Genauer gesagt, ein 7000 Jahre altes. Der australische Kunstphilosoph Denis Dutton schildert in seinem Buch ›The Art Instinct: Beauty, Pleasure, and Human Evolution‹ ein Experiment, bei dem Menschen aus den verschiedensten Kulturen, vom Polarkreis bis zu den Tropen, aufgefordert wurden, eine Landschaft zu zeichnen oder zu beschreiben, die ein besonderes Wohlgefühl in ihnen auslöst. Unabhängig davon, woher die Versuchspersonen stammten, glich ihre Sehnsuchtslandschaft weltweit der afrikanischen Landschaft zwischen Wald und Steppe, von der die planetarische Wanderung des homo erectus vor zwei Millionen Jahren ihren Ausgang nahm. Da gibt es unabsehbares Grasland, Blumen, vereinzelte Bäume, lichte und überschaubare Wälder, Hügel, weite Perspektiven, Jagdtiere wie Hirsche oder Pferde, und ein Gewässer ist in der Nähe. Das ist die altsteinzeitliche Sehnsuchtslandschaft, die wir alle irgendwo in uns tragen (bei mir taucht sie in Träumen immer wieder auf).
Landschaftsformen und Stadtlandschaften bringen historische Erinnerungen und Phantasmen herauf, die unser gegenwärtiges Seelenleben mit unvordenklichen Zeiten verbinden. »Die Alpenseen«, schreibt Ernst Jünger, »auch die nördlichen mit ihren Inseln wie der Reichenau und der Mainau, rufen ein Heimweh nach lang verflossenen Zeiten und ihrer Gesellschaft hervor. Sie hat wohl immer nur platonisch existiert. (…) Ich denke dabei (…) an eine friedliche Landschaft in vorkarolingischer Zeit. Für das tägliche Brot sorgten die Bauern, Winzer, Fischer und Jäger sowohl an den Ufern wie in den Tälern bis zur Schneegrenze. Der Boden ist fruchtbar; für das Handwerk bleibt besonders im Winter auf den Höfen genügend Zeit. Veredelung der Früchte und des Weines zählt zu den Obliegenheiten kleiner Klöster, ebenso die Heilkunst und alles, was mit der Schrift und dem Lesen zusammenhängt. Damit wird der einfache Mann nicht geplagt. Eine Harmonie, die selten erreicht wird – das lässt sich ausführen. Es ist in Romanen und Utopien geschehen. Verehrung durch Kultus und Kunst.«
 Mein eigener Roman über die ursprünglichen Bewohner der Hügel des Bodenseeufers, des Neckarstrands, der Donauabhänge und der Berge über dem georgischen Mtkwari entfaltet sich in den Phantasmen, wie sie den einsamen Spaziergänger heimsuchen. Diese Träumereien führen ihn in seine Kindheit zurück und weit über sie hinaus in die Vergangenheit. Zum ersten Mal habe ich die bergige Stadtlandschaft von Tiflis als drei- oder vierjähriges Kind gesehen, auf dem Stuttgarter Killesberg, an der Hand meiner Mutter, wenn sie mit mir zur Haltestelle am Platz vor der Bundesgartenschau ging. In einer gelben Straßenbahn fuhren wir auf den gewundenen Straßen in die Stadt im Tal. Ein halbes Jahrhundert später konnte ich in Bratislava von meinem Schreib- und Lesesessel aus die von Villen dicht bestandenen Hügel der gutbürgerlichen Preßburger Wohnviertel der zwanziger und dreißiger Jahre im Wechsel der Wetterlagen, Tages- und Jahreszeiten betrachten. Sie zogen sich von der Burg am Donauhochufer, den Rand einer halbrunden Talsenke bildend, als Höhenzug dahin und verloren sich außerhalb meines Blickfelds in den Buchen- und Eichenwäldern der Karpaten.
Mein eigener Roman über die ursprünglichen Bewohner der Hügel des Bodenseeufers, des Neckarstrands, der Donauabhänge und der Berge über dem georgischen Mtkwari entfaltet sich in den Phantasmen, wie sie den einsamen Spaziergänger heimsuchen. Diese Träumereien führen ihn in seine Kindheit zurück und weit über sie hinaus in die Vergangenheit. Zum ersten Mal habe ich die bergige Stadtlandschaft von Tiflis als drei- oder vierjähriges Kind gesehen, auf dem Stuttgarter Killesberg, an der Hand meiner Mutter, wenn sie mit mir zur Haltestelle am Platz vor der Bundesgartenschau ging. In einer gelben Straßenbahn fuhren wir auf den gewundenen Straßen in die Stadt im Tal. Ein halbes Jahrhundert später konnte ich in Bratislava von meinem Schreib- und Lesesessel aus die von Villen dicht bestandenen Hügel der gutbürgerlichen Preßburger Wohnviertel der zwanziger und dreißiger Jahre im Wechsel der Wetterlagen, Tages- und Jahreszeiten betrachten. Sie zogen sich von der Burg am Donauhochufer, den Rand einer halbrunden Talsenke bildend, als Höhenzug dahin und verloren sich außerhalb meines Blickfelds in den Buchen- und Eichenwäldern der Karpaten.Inzwischen lebe ich in Tiflis. Es ist Samstagmorgen. Dort drüben auf den Hügeln, die ich aus meinem Fenster sehe, werde ich heute Nachmittag wieder spazierengehen. Ich werde Villen, Baracken, Straßen, Treppen, Kirchen und Gärten sehen, von denen sich Ausblicke in das weite, sommerlich löwengelbe Tal eröffnen, auf die Hügel im Mittelgrund und auf die Fünftausender in der Entfernung. Überraschende Perspektivwechsel ergeben sich nach dem Aufstieg über lange Treppen zwischen weinlaubüberwachsenen Mauern und silbergrau verwitterten Holzzäunen. Eine Biegung in der gepflasterten kleinen Straße, hinter der jeden Moment (glaubt man in der träumerischen Geistesverfassung, die einsames Steigen und Gehen hervorbringt) der pazifische Ozean auftauchen muss, man scheint schon die Nebelhörner zu hören. Aber dann ist doch nur wieder eine neue Höhe erreicht, und eine Weile geht es, am Rand eines steileren Abhangs, ebenerdig weiter. Manchmal gerät man in einen Wald. Dann wieder steht man am Rand eines Felsabbruchs. Und überall begleiten dich in enzyklopädischer Formenvielfalt die Spontanarchitekturen, die hier auf jedem denkbaren Hanggrundstück gebaut worden sind, von Hütten aus Sperrholz und Wellblech bis zu historistischen Traumschlössern, wilden Jugendstilphantasmagorien und sachlichen Bauhauskuben.
Mir ist beim Spazierengehen auf den Höhen über Tiflis seither oft zumute, als hätte jemand den Stuttgarter Killesberg, die Karlshöhe, die Weinsteige und die Birkenwaldstraße durch einen Mixer gedreht und hier, am Abhang des Kaukasus, wo man weit in die gewaltige Landschaft hinaussieht, wieder ausgegossen. Und während ich dort im Licht warmer Septembersamstagnachmittage umherging – und später im Novembernebel, im ersten Schnee und an einem kalten Wintermorgen, der einen trotzdem schon den Frühling ahnen ließ –, habe ich wie unter einem Zwang versucht, mir die dramatische Biegung einzelner Straßen einzuprägen. Die Art, wie die Zweige eines Apfelbaums über die Stützmauer eines Gartens hinausragten. Wie die Staffeln dort aus manchen Blickwinkeln direkt in den Himmel hineinzuführen scheinen. Ich habe versucht, mir all jene Straßen und Gärten für immer klarzumachen, als würde, wenn ich das alles nur einmal innerlich ganz festhalten könnte, ich wieder jung und alles in meinem Leben wieder gut. Und dann bin ich hungrig geworden und über die Treppen von Tiflis wieder hinuntergestiegen ins Tal, wo eine der georgischen Kneipen auf mich gewartet hat und ein Essen, das ganz anders auch in der Jungsteinzeit nicht gewesen sein kann und in dem ich die Jahrtausende zu schmecken glaube im Brot, im Käse, im Gemüse, im gegrillten Fleisch. Und in einem oder zwei Gläsern des Weins, der zu dieser Landschaft gehört, zu dessen Bewirtschaftung die Treppen erfunden worden sind und in dem heute noch so etwas wie der Geist der Jungsteinzeit lebendig ist.
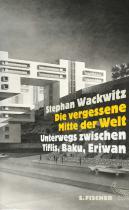
Georgien und seine Nachbarländer Armenien und Aserbaidschan liegen am äußersten östlichen Rand Europas. Es sind uralte Kulturländer und zugleich höchst lebendige Staaten, die sich zwanzig Jahre nach ihrer Loslösung von der Sowjetunion auf einem kurvenreichen Weg in die Moderne befinden. Stephan Wackwitz, Leiter des Goethe-Instituts in Tiflis, erlebte in Georgien den Machtwechsel 2012 und beobachtet den alltäglichen Kampf um Demokratie und Menschenrechte. Er beschreibt, wie ein immenser Bauboom das Gesicht der Städte für immer verändert. Vor allem aber spürt er den besonderen Atmosphären im Herzen des eurasischen Kontinents nach, wo sich nicht nur Westen, Osten und Süden, sondern auch alle Zeiten magisch zu mischen scheinen.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /