In dem vollbesetzten, von Flüstern erfüllten Saal brachte uns eine mürrische Platzanweiserin in die erste Reihe, was meiner großen Schwester gar nicht gefiel. »Von hier aus können wir den Schauspielern ja direkt in die Nasenlöcher schauen! Wir bekommen ihre ganze Spucke ab!«, maulte sie und drückte sich an die Rückenlehne. Noch bevor sich der Vorhang hob, war ich fasziniert.
Wovon? Von eben diesem Vorhang. Es handelte sich um ein Ölgemälde, das wie voluminöser, durch viele Falten aufgebauschter Samt wirkte, mit vergoldeten Stickereien am Rand und mit Raffhaltern, von Perlen besetzt. Diese Mogelei fand ich armselig und prachtvoll zugleich – armselig, da ich genau sah, dass der gemalte Stoff zweidimensional war und nur prunkvoll wirkte, weil er einen üppigen Faltenwurf vortäuschte. Dadurch, dass ich die Augen zusammenkniff und das Bild durch die halb geschlossenen Lider betrachtete, meinen Blick mal unscharf, mal präziser fokusierte, versuchte ich, auf den Trompe l'oeil-Effekt hereinzufallen. Vergebens! Die einzige Möglichkeit, mich selbst hinters Licht zu führen, ergab sich nicht durch Sehen, sondern rührte vom Kopf her: man musste sich auf die Täuschung einlassen. Noch ehe das Stück angefangen hatte, ahnte ich, dass jedes Vergnügen, das ich haben würde, ebenso stark von mir selbst abhing wie von dem, was sich auf der Bühne abspielte.
Der Vorhang schwang sich zum Schnürboden empor, wo ich die Kulissen in Form von bemalten Leinwänden entdeckte. Wieder saugte sich meine Aufmerksamkeit an den Details fest: Auch wenn ich glauben konnte, dass es Perspektiven gab, Tiefen, so würden sich, wenn jemand eine Tür zuschlug, die Bühnenbilder leicht bewegen und somit verraten, dass sie flach waren. Der Gipfel wurde im zweiten Akt erreicht, der in einem Laden spielt: Dort hingen an alten Holzbalken Schinken aus Pappe, die mich restlos faszinierten! Innerhalb einer einzigen Sekunde schwankten diese Schinken zwischen echt und falsch; mal hielt ich sie aufgrund ihrer Formen und ihrer Farben für echt, mal aufgrund ihrer hohlen Leichtigkeit für unecht; doch sobald ich sie für unecht hielt, erschienen sie mir plötzlich echt. Kurz und gut, ich erlag dem Reiz des Bühnenzaubers, diesem ständigen Hin und Her zwischen wahr und falsch. Diese Schinken aus Pappe waren es, die mir den Zugang zum Theater erschlossen – diesem Ort, an dem die Realität die Hilfe der Einbildungskraft braucht, um existieren zu können. Ja, während ich das Theater nicht brauchte, brauchte das Theater mich, denn auf diese trügerische Welt fällt nur herein, wer sich täuschen lassen will. Ich freute mich unbändig, dass mir eine Rolle zufiel.
Und das Stück selbst? Nun, wie die Bühnenwirksamkeit brauchte es zwei Akte, um mich in seinen Bann zu ziehen – und Cyrano de Bergerac hat zum Glück fünf Akte! Die Tatsache, dass die Personen auf der Bühne in Versen sprachen, überraschte mich keineswegs: im Gegenteil. Ihre künstliche Sprache passte in meinen Augen bestens zu dieser Welt der Illusionen. Warum hätten sie wie jedermann sprechen sollen, diese bunt gemischten Männer und Frauen, die sich ohnehin nicht in einem normalen Universum bewegten? Ihre Sprache – präzise, ausgefallen, poetisch –, ihre Brillanz, die virtuose Schlagfertigkeit gehörten mit zum Schauspiel. Jede sprachliche Banalität hätte die Kontinuität der Verzauberung gebrochen.
Als Nächstes fesselte mich die Handlung. Der großartige Cyrano, der glaubt, dass er nicht in der Lage ist, eine Frau zu verzaubern, überraschte mich: Als er begreift, dass die vornehme Roxane seinen Rivalen Christian bevorzugt, verbirgt er seine Enttäuschung und unterstützt Christian, der ebenso gutaussehend wie dumm ist. Anstelle des dümmlichen Schönlings ersinnt er des Nachts Sätze der Liebe und bringt am Rande des Schlachtfelds feinsinnige Briefe an das geliebte Wesen zu Papier. In atemloser Spannung verfolgte ich mit, wie Christian bei der Belagerung von Arras stirbt und Cyrano überlebt. Zwanzig Jahre später gesteht ihm Roxane, sich kaum noch an Christians hübsche Züge zu erinnern, dass sich aber jedes einzelne Wort, das er ihr jemals schrieb, ins Herz eingebrannt habe. Der bereits mit dem Tode ringende Cyrano erkennt, dass er sehr wohl hätte geliebt werden können, und vor allem, dass Roxane in Wahrheit ihn liebte. Doch es ist bereits zu spät; er stirbt.
Hatte ich anfangs noch über Cyranos Possen gelacht, so kämpfte ich bald schon gegen meine Ergriffenheit an, je mehr sich das Geschehen verdüsterte. Irgendwann konnte ich mich dann nicht länger beherrschen und begann zu schluchzen; und zu meiner Beschämung brach ich sogar in Tränen aus.
Welch sonderbare Tränen ... so schmerzlich und so angenehm zugleich ... Zum ersten Mal in meinem Leben weinte ich nicht um mich, sondern um einen Anderen. Ich, ein Kind, das sich ohne Zweifel geliebt fühlte, war plötzlich voller Empathie, gab meine bisherige Sichtweise auf, ließ meinen Egoismus hinter mir, fühlte mit einer fremden Person mit; ich verspürte das Leid und das Mitgefühl, von dem Aristoteles spricht, oder vielmehr den Kummer des Mitgefühls. Meine Tränen hatten einen Namen; es waren altruistische Tränen, philanthropische Tränen. Ein bislang unbekanntes Gefühl der Brüderlichkeit mit einer Person aus einem früheren Jahrhundert, mit der ich absolut nichts gemeinsam hatte, erweiterte mein Bewusstseinsfeld der Anteilnahme.
Als im Saal die Lichter angingen, dachte ich, die anderen Zuschauer – allen voran meine Schwester – würden sich über mein verheultes Gesicht lustig machen. Doch als ich es dann wagte, mich umzublicken, sah ich nur gesenkte Blicke, verquollene Augen und gerötete Nasen.
Diese Entdeckung versetzte mich in einen euphorischen Zustand. Meine Tränen hatten mich nicht nur gewandelt, ich teilte sie auch mit achthundert Erwachsenen. Während ich von der Menschenmenge zum Ausgang geschoben wurde, gelobte ich mir, so bald wie möglich an diesen magischen Ort zurückzukehren.
Eric-Emmanuel Schmitt
Übersetzt von Anne Braun
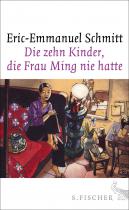
Der Erzähler dieser phantastischen Geschichte ist ein Handelsvertreter für Spielwaren, der regelmäßig nach China reist und immer im selben Hotel absteigt. Hier herrscht im Souterrain Frau Ming wie eine Königin über ihr kleines Reich. Er plaudert mit ihr, um sein Kantonesisch zu üben. Als sie ihm eröffnet, zehn Kinder zu haben, hält er sie für eine ausgemachte Lügnerin. Und doch hört er ihren Geschichten zu: über die unerschrockenen Zwillinge Kun und Kong, die beim Nationalzirkus Artisten werden, oder die verrückte Da-Xia, die als Kind von der Idee beherrscht war, Madame Mao zu töten. Am Ende kennt er die Lebensgeschichten aller inzwischen erwachsenen Kinder und weiß auch nicht mehr, was Phantasie, was wirklich ist, so sehr hat Frau Ming ihn mit ihren Geschichten betört. Doch dann erleidet Frau Ming einen Unfall und kommt ins Krankenhaus. Und sie hat nur einen Wunsch, ihre zehn Kinder zu sehen …






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /