Wer wissen möchte, was ein naturwissenschaftlich gepimpter Luhmann-Cylon aus der Fernsehserie »Battlestar Galactica« oder ein Luhmann-Host aus »Westworld« zur Literatur sagen würde, muss den Literaten Lem lesen, der der Science-Fiction-Autor Lem auch war.
Stanislaw Lem erspart dem Leser den Luhmann-Loop, am Anfang jeden Buches die Bestandteile und Eigenschaften eines Systems nach Luhmann aufzuführen (ein System ist ein autonomer Bereich, kein System ist unabhängig von seiner Umwelt, das Komplexitätsgefälle zwischen Umwelt und System zwingt das System zu ständigen Selektionen etc.) Lem vermeidet die konstrukturistischen Rahmenüberlegungen Luhmanns, die de facto ontologische Festlegungen sind. Lems Systembegriff ist strategisch unspezifisch: Alles, was Gegenstand der Evolution ist und was homöostatische Eigenschaften aufweist, ist ein System. Die Evolution wird dabei hierarchisch aufgefasst: Alle Stufen der biologischen Evolution sollen in Analogie zum darwinistischen Modell funktionieren, das als Prozess von zufälliger Mutation des Genotyps, Entstehung eines Variantenpools und Selektion auf der Ebene des Phänotyps charakterisiert wird. Auf der Ebene der Gesellschaft soll die jeweilige Sprache das Analogon zum Genotyp bilden, die Kultur, darunter die Literatur, das Analogon zum Phänotyp. Lems Abhandlung über die Literatur aus dem Jahr 1968 trägt den Titel »Philosophie des Zufalls«, weil evolutionäre Variation und Selektion niemals deterministisch sind.
Lem ist ein äußerst vorsichtiger Formulierer seiner Thesen. Die evolutionären Aspekte der Kultur werden nicht überstrapaziert, die Verbreitung effekthascherischen Unsinns wie des »Selfish gene« von Richard Dawkins liegt in weiter zeitlicher und geistiger Ferne. Lem hält ausdrücklich fest, dass die klassische Kybernetik als Theorie der Steuerung und Regelung für endliche Automaten entwickelt wurde. Fertige literarische Werke sind jedoch keine endlichen Automaten. Homöostase bedeutet – kybernetisch – eine eigene Strategie des Systems, bei Störung durch die Umwelt ein Gleichgewicht zu erreichen und es zu bewahren. Dagegen ist das vollendete literarische Werk zunächst gegen seine Rezipienten völlig passiv.
»Ein entstehendes Werk darf man dagegen als Homöostaten betrachten.« Natürlich drückt sich Lem so aus, wie die Kybernetiker seiner Zeit. Der Luhmann-Cylon oder der Luhmann-Host würden vorsichtiger davon sprechen, den Gedanken der Homöostase auf das in der Entstehung begriffene Werk anzuwenden. So oder so: Die Vergangenheit des Werks, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt geschriebenen Abschnitte, beeinflusst seine Gegenwart, das, was der Autor jetzt schreibt. Aufgrund von Erfahrungen mit späteren Teilen nimmt der Autor auch Veränderungen an früheren Teilen vor. Ein angefangenes Werk ist daher ein Ausgangspunkt für eine Vielzahl von möglichen Entwicklungsbahnen, die ihrerseits jeweils das Ergebnis eines Ensembles von möglichen homöostatische Reaktionen sind. In dem Ausmaß, in dem das Werk wächst, schrumpft die Menge der möglichen homöostatischen Reaktionen und schmilzt auf ein charakteristisches aktuelles Ensemble zusammen.
Wenn Luhmann Gesellschaften, soziale Systeme, und Individuen, psychische Systeme, jeweils als Systeme von Kommunikationen definiert, dann bleiben Menschen und Gehirnprozesse völlig außer Betracht. Bei Lem gibt es keine solche Luhmann-Lücke. Lem betont, dass sich die homöostatischen Prozesse der Entstehung eines literarischen Werks nicht unmittelbar im Medium Sprache abspielen, wie Luhmann denken würde, sondern im Kopf. Die Verbindung von zwei sprachlichen Artefakten wird immer durch einen personalen Autor hergestellt und später durch den Leser nachvollzogen oder nicht nachvollzogen.
Das ergibt mit Lem eine Ästhetik literarischer Produktion: Ein in der Entstehung begriffenes erzählerisches Werk kann als eine Menge von verbundenen Parametern und Variablen aufgefasst werden, für die bestimmte constraints gelten, die zum Beispiel Personen durchgehend vor dem Hintergrund eines bestimmten Milieus abbilden. Im Vergleich zu technischen oder biologischen Systemen ist das System literarisches Werk in der Anfangsphase höchst unbestimmt: Die Transformationsmatrix – wie geht ein Zustand des Systems in den nächsten über – kann nicht einmal rudimentär angegeben werden. Die inhaltlichen Möglichkeiten des Systems sind nicht abgegrenzt: In vielen Fällen weiß der Autor zu Beginn nicht, wie »es« im Text ausgehen wird. Selbst wenn der Autor eine genaue Vorstellung hat, wie die Geschichte endet, überblickt er nicht alle möglichen Pfade, die zu dem vorgesehenen Ende führen. Die formalen Möglichkeiten des Systems sind nicht genau abgegrenzt: Auch Autoren, die einen kontinuierlichen Stil pflegen, erlauben sich Variationen, die sie nicht vorher festlegen. Weder die Eigenparameter – wie ist das System in sich aufgebaut? – noch die Kontrollvariablen – welche Ziele verfolgt das System? – sind vorher festgelegt. Trotzdem ist der Roman, die Erzählung ein sich auf sich selbst einstellendes System, das dafür sorgt, dass die Parameter und Variablen innerhalb bestimmter Streubereiche bleiben.
Wie sieht es etwas konkreter mit diesen Streubereichen aus? Für die gesellschaftsbedingten Kontrollvariablen gibt Lem nur ein Macho-Beispiel: Die ideale Geliebte des bürgerlichen Romans dürfe keine X-Beine haben … Natürlich sind die naturwissenschaftlichen Parameter bei dem Science-Fiction-Autor Lem ein eigenes Kapitel.
Die übergeordneten Eigenparameter und Kontrollvariablen des literarischen Werks werden von Lem gefasst als die »ständige ›Problematik‹ des Schriftstellers« und das » ›konkrete Thema‹ des Werkes«. Die ständige Problematik, das sind die »Obsessionen« des Schriftstellers sowie »generelle Auffassungen«, Letztere können als konstante oder oszillierende Haltungen auftreten. Lem spricht von »ständig aktivierten Gradienten« und von » ›Polen‹ im semantischen Raum«, die das Entstehen des Werks bestimmen und ihm »eine ›latente‹ Geschlossenheit verleihen«.
Die Literatin interessiert natürlich: Was sind Obsessionen eines Schreibenden, kybernetisch gesehen? Gemäß Lem sind die Obsessionen des Schriftstellers weder ein philosophisches System noch eine Weltanschauung, sie sind auch keine kohärente Zusammenstellung von Regeln, vielmehr bilden sie eine Art dauerhafter Strukturierung im » ›Raum der Bedeutungen‹ «. In dieser Strukturierung steckt eine Vielzahl von Generierungsmöglichkeiten für Systeme, die literarische Werke bilden. Die Einengung der Generierungsmöglichkeiten hängt dann teilweise bis zu in hohem Maße vom Zufall ab. Unerwarteterweise setzt sich Lem intensiv mit Thomas Mann auseinander. Gleichermaßen überrascht, dass Lem ein Rilke- Aficionado war. Thomas Manns Obsessionen, sein »oberstes Prinzip« sind die antagonistischen Begriffspaare Normalität = Gesundheit und Genie = Krankheit, das Ethische = das Gute und das Ästhetische = das Böse sowie Bürger vs. Künstler. Hans Castorp war normal und hat über gar nichts nachgedacht, die Krankheit lässt ihn überhaupt erst mit dem Denken beginnen. Adrian Leverkühns Genialität ist ohne seine Krankheit nicht vorstellbar, sein Biograph Serenus Zeitblohm ist normal, gesund und untalentiert etc. Etc. Der im Umgang mit Axiomensystemen geschulte Lem stellt fest: »Die Themenbreite eines Autors steht in keinem Verhältnis zur eventuellen ›Enge‹ jenes obersten Prinzips, was man wiederum bei Mann sehen kann.« Den »Zivilisationsliteraten« Heinrich Mann gibt es außerhalb des deutschen Sprachraums nicht.
Kann man sich einer Beschreibung der Transformationsmatrix zumindest nähern? Lem setzt Hoffnungen in die Spieltheorie. Der Autor erprobt im Geiste oder auf dem Papier – so hieß das früher – mögliche Spielzüge, also mögliche Transformationen des Ausgangszustandes des Systems literarisches Werk in einen Folgezustand. Dabei muss er sowohl die Mikrostruktur, die einzelnen Abschnitte, Beschreibungen, Dialoge, als auch die Makrostruktur des Werks im Auge behalten, die mit der Wertentwicklung verbundene »Absicht«, die im Wesentlichen eine Kombination der Obsessionen und der generellen Auffassungen des Autors ist. Lem beobachtet und interpretiert treffend: Wenn ein Schriftsteller sagt, dass ein Werk ab einem bestimmten Punkt »zu leben« beginnt, dann bedeutet dies nichts anderes, als dass die Makroziele ohne weiteres Dazutun die Mikroziele bestimmen, dass die entsprechenden Kontrollvariablen gewissermaßen automatisch eingestellt werden.
Das entstehende Werk als Homöostat ist die eine Anwendung der Kybernetik. Das literarische Werk als Steuerungsprogramm in der Kommunikationssituation Autor-Leser ist eine andere. Denn niemand, der einen Text liest oder hört, bleibt völlig passiv. Es ist nicht möglich, gegen einen Text keine Taktik anzuwenden (was nicht heißt, dass das bewusst geschehen muss). Egal was und wie der Leser oder Hörer versteht – er führt als Reaktion auf den Text geistige Operationen durch. Lem denkt hier als Spieltheoretiker: Das literarische Werk ist ein Zug im taktischen oder strategischen Sinn der Spieltheorie, Spieler sind der Autor und seine potentiellen und aktuellen Leser.
Lem schickt seinen Betrachtungen voraus, es sei in keiner Weise angebracht, ein literarisches Werk als reine Informationsübertragung zu analysieren. Claude Shannon, der Erfinder der einschlägigen informationstheoretischen Begrifflichkeit, war Fernmeldeingenieur. Ihm ging es um Übertragungskanäle, deren Kapazitäten und Störempfindlichkeit und um Codes. Dennoch (und Lems Bedenken zum Trotz) kann man aus Shannons Überlegungen etwas für das Thema der literarischen Rezeption abzweigen: Der Hardware-Ingenieur und der IT-Techniker streben danach, die maximale Kapazität des Sendekanals herzustellen und auszunutzen sowie das Rauschen zu minimieren. Praktisch immer wird dabei Redundanz reduziert. Natürliche Sprachen sind grundsätzlich redundant. Die Reduktion von Redundanz ist auch ein literarisches Stilmittel. Das man nicht beim mündlichen Vortragen anwenden sollte … Der Verzicht etwa auf Satzzeichen in literarischen, eine andersartige Orthographie, das Nicht-zu-Ende-Schreiben von Sätzen können sowohl die Abänderung des üblichen Denkablaufs als auch dessen Mimesis zum Ziel haben. James Joyce lässt etwa in Mollys Monolog Sätze unvollendet und verwendet Ellipsen. In »Finnegan’s Wake« korrumpiert er Wörter und Satzbau, um möglichst nahe an eine ungesteuerte Version des Gedankenflusses heranzukommen.
Der Autor »codiert« – selbstredend, auf eine viel komplexere Weise als der Ingenieur oder der IT-Techniker. Gemäß Luhmann ist ein Code eine Regel, die jeweils eine Einheit im externen Bereich des Systems mit einer internen Einheit korreliert. Ein Code beschreibt, wie ein System seine Umwelt beobachtet. Wenn der Autor erreichen möchte, dass bestimmte Adjektive einen besonders starken Eindruck beim Leser machen, dann wird er vor und nach eindrücklichen Adjektiven weniger eindrückliche verwenden, und er wird nicht zu viele adjektivische Bestimmungen walten lassen, weil er weiß, dass diese sich in der Vielzahl insgesamt aufheben. Codes sind einfach oder zusammengesetzt, und sie überschneiden sich. Nichts außer dem Leser, der ja nicht in jedem Fall weiterlesen muss, verhindert beliebig komplizierte Codes. Natürlich setzt die Verlagskalkulation dem Einfallsreichtum des Autors eine Obergrenze. Zum Wesen des literarischen Werks gehört, dass es immer Elemente enthält, die eine gegenüber einer vergleichbaren nichtliterarischen Kommunikation überschießende »Signalisierungsfunktion« haben. Lem vermeidet übrigens sehr weitgehend das Wort Bedeutung.
Die Einordnungen, die der Leser trifft, und die Hypothesen, die er über seine Lektüre aufstellt, stellen seine Züge in dem Spiel zwischen Autor und Leser dar. In der Regel ergeben unterschiedliche Rezeptionstaktiken und -strategien zwar keine identischen Ergebnisse, aber die Lesarten sind nicht völlig unterschiedlich und lassen sich zu Klassen zusammenfassen, deren Mitglieder gemeinsame Charakteristiken aufweisen.
In der Science-Fiction stehen mittlerweile Fernsehserien gleichberechtigt neben Literatur und Film. Die Anziehungskraft der Serien ist nicht Folge einer herausragenden Originalität, überwiegend werden die Plots dem riesigen Korpus von vorliegenden Romanen und Erzählungen entnommen. Die intellektuelle Qualität der Fernsehserien besteht vor allem in ihrer Gründlichkeit: Motive und Handlungslinien, die in der Literatur oft nur angerissen sind, werden in den Serien erschöpfend durchdekliniert. Auf diese Weise rücken Folgen von Annahmen in den Vordergrund, die in der Literatur nicht beachtet oder sogar gezielt negiert werden.
Spricht man den Lem-Luhmann-Cylon und den Lem-Luhmann-Host auf die vielbestaunten Aufsätze »Heinrich von Ofterdingen« als Nachrichtenfluss und »Signal-Rausch-Abstand« von Friedrich Kittler an, antworten sie höflich, dass sie die Arbeiten als etwas ziellos empfinden. Kittlers enormes Verdienst besteht darin, die Aufmerksamkeit der Geisteswissenschaftler auf die Kommunikationswerkzeuge zu richten, die sie zur Mitteilung des Geistes benutzen. Die Medien und die technischen Hilfsmittel weisen Eigengesetzlichkeiten auf, welche die Kommunikation beeinflussen und formen. Zwar betont Kittler, dass die Shannon’sche Informationstheorie davon absieht, dass Nachrichten Sinn haben. Doch dann rückt er die poetische Tätigkeit und auch die Literatur im Allgemeinen in die Nähe eines Verfahrens der Gewinnung von Nachrichten durch die Selektion und die Filterung von Rauschen. Poesie entsteht aus anderer Poesie, aus Wissen und aus Empfindungen. Aber nicht aus Rauschen.
Wenn es um das Schicksal des einzelnen literarischen Werks geht, werden der Lem-Luhmann-Cylon und der Lem-Luhmann-Host zu Luhmaniacs: Es zählt nur das System als Ganzes, und wie es als Ganzes funktioniert. Wir halten heute die Dramen Shakespeares für eindeutig besser als die Marlowes. Sind sie das wirklich? Die Karriere oder die Nicht-Karriere eines literarischen Werks ist keineswegs die notwendige Folge bestimmter immanenter Eigenschaften des Werks, sondern hängt zu einem großen Teil von der sozialen Umwelt ab. Wer hier an Bourdieu denkt, muss sofort zurückrudern. Es geht nicht um die Responsivität von Lesern, sondern um die Wahrscheinlichkeit von Erfolgsbedingungen, auf die die Qualität des Werkes keinen Einfluss hat. Lem spricht explizit vom »stochastischen Schicksal des Werkes«: Für jede Zeit gibt es innerhalb der Gesamtmenge aller Werke eine Untermenge, deren Mitglieder Kandidaten für die Einschätzung als Meisterwerk sind. Die Auswahl innerhalb dieser Menge geschieht durch Mechanismen, die nur als Zufallsphänomene zu modellieren sind.
Die im Fall des Falles gegebene Souveränität eines literarischen Werkes ist keine immanente Eigenschaft, sie ist ein Ergebnis der Beziehungen, die zwischen dem Text und seiner gesellschaftlichen Umwelt bestehen. Ein neues literarisches Werk ist ein vielfach unterdeterminiertes System. Das Werk, so wie es später dasteht, wird durch – Lem formuliert: massenhafte – gesellschaftliche Vorgänge erzeugt. Die Analyse Lems könnte nicht soziologischer sein. Als Beispiel führt er die »Buddenbrooks« an. Das Buch war nach Ansicht des Verlages und der Buchhändler zu dick und verkaufte sich zunächst schlecht. Nur ein einziger bekannter Kritiker äußerte sich positiv. (In Lübeck wurde der Roman übrigens mit einem Zettel verkauft, der für die Figuren des Romans deren reale Vorbilder benannte.) Erst später erschienen immer mehr wohlwollende Rezensionen, die Zahl der Auflagen und der Übersetzungen stieg lawinenartig an. Interessant hier die Strategie Lems, der nicht versucht, den schlussendlich gigantischen Erfolg des Romans »Buddenbrooks« zu erklären. Lem springt vielmehr sofort auf die Metaebene: Je homogener das kulturelle Milieu der Rezipienten ist und je eindeutiger die Regeln der Einordnung für die Werke in das gegebene Bezugssystem sind, desto schwieriger wird es, den konventionellen Charakter des Bezugssystems und seiner Regeln überhaupt wahrzunehmen. Aus dieser Situation heraus erklärt sich auch die verbreitete Idee, das Werk »wirke«, sei ein Meisterwerk aus dem Werk immanenten Gründen.
Auch in der Frage nach der Bewertung oder Bedeutung eines Werkes wählt Lem die evolutionäre Betrachtungsweise: Nichtkonventionelle Werke sind gewissermaßen Mutanten literarischer Gattungen, sie müssen sich an die gesellschaftliche Umwelt anpassen. Der Unterschied zur Biologie: Biologische Organismen passen sich in ihren gegetischen Eigenschaften an eine über größere Zeiträume invariante Umwelt an. In der Literatur muss sich das Werk an neue Interpretationen anpassen, die auf es angewendet werden. Dabei gibt es eine Parallele zur Biologie, die Lem aber nicht nennt: Biologische Organismen können ihre Umwelt beeinflussen. Literarische Werke sind prinzipiell ebenfalls in der Lage, ihre gesellschaftliche Umwelt zu beeinflussen und zu verändern. Lem erwähnt die Möglichkeit, dass ein Schriftsteller Ausdrucksformen ›vorwegnimmt‹, welche die Zukunft nicht verstehe, weil die Strömung der Kultur sich ein anderes Flussbett gewählt habe. Lem besteht auf der entscheidenden Rolle des Zufalls: »Die Bekanntheit eines Werkes hängt nun davon ab, ob die Rezeption eben abnimmt oder vielmehr lawinenartig zunimmt, und bei gewissen Werken, die gerade an die kritische Grenze kommen, ist es der reine Zufall, der über ihr Weiterleben oder ihren Untergang entscheidet.« Um in den »Wartesaal der Literatur« zu gelangen, muss ein Werk gewisse Minimalkriterien der Organisiertheit und der Informationskapazität erfüllen. Alles andere entsteht bei den Rezipienten. Anerkannte Meisterwerke werden zu eternen Produktionsstätten immer neuer Wahrheiten und Offenbarungen. Zugleich bleibt Nicht-Meisterwerken eine auch nur halbwegs adäquate Interpretation versagt. Wenn sie nicht überhaupt nur als Rauschen wahrgenommen werden.
Diese Überlegungen dürfen auf keinen Fall in die Nähe der im deutschen Sprachraum prominenten sogenannten Rezeptionsästhetiken von Wolfgang Iser und Hans Robert Jauß gerückt werden. Der professionelle Leser Isers ist immer ein Individuum, Jauß’ auf Gadamers hermeneutischem Zirkel basierendes Leseverhalten ist ein individuelles, kein kollektives.
Die Feststellungen Lems sind dagegen immer funktional auf die Gesellschaft bezogen. Eine wirklich fruchtbare – ja, empirische Anwendung kybernetischer Begrifflichkeit ist Lems Analyse des Nouveau Roman –, von dem er gar nichts hält. Allerdings beschränkt sich seine Analyse auf Alain Robbe-Grillet, er erwähnt Beckett, jedoch hat er Claude Simon nicht gelesen. Der Nouveau Roman ist nicht, wie von einzelnen seiner Protagonisten behauptet, ein Pendant zum Relativismus der modernen Physik. Hier walten grässliche Missverständnisse, denn die Relativitätstheorie und die Quantenmechanik stellen schließlich nicht die Physik in Frage. Vielversprechender ist die gesuchte Nähe zur Mathematik, auch wenn Lem die Mathematik nicht wirklich gern in die Nähe von Literatur gerückt sehen will. Den Mathematiker interessiert nicht, ob seine Kreationen etwas abbilden, ob sie Modelle von etwas sind. Er geht von bestimmten Prämissen aus und führt bestimmte mathematische Operationen durch. Er kennt die zulässigen Transformationen seines Materials, die Relationen zu etwas wie der ›äußeren Welt‹ spielen per definitionem keine Rolle. Die von Robbe-Grillet erzählten Geschichten, sofern man sie herauspräparieren kann, sind banal, man kann Lem nicht widersprechen. Es geht bei Robbe-Grillet nicht um das Erzählte, sondern um die Erzählmethode. Die Information des Romans ist seine Erzählweise. Die Welt des Romans spielt eine Nebenrolle. Die Welt außerhalb des Romans bleibt völlig außer Betracht. Die Autoren des Nouveau Roman sehen den Roman in der Krise, gewissermaßen von seiner eigenen Unmöglichkeit befallen. Hier wird Lem ironischpsychoanalytisch: Eigentlich sollten Romanschriftsteller nach dieser Feststellung verstummen. Stattdessen praktizierten die Anhänger des Nouveau Roman Übertragung, wie sie die Psychoanalyse beschreibt: Die Unmöglichkeit des Romans wird auf die Welt, die Sprache und auf beides zusammen projiziert. Die Sprache selbst und die Existenz der Welt werden in Frage gestellt.
Der Nouveau Roman – in der Version Robbe-Grillets – ist eine romangewordene Methodologie des Romanschreibens. Die einschlägige Methode ist nach Lem die bewusste Erzeugung von Desorientierung. Der traditionelle Roman gibt dem Leser Orientierung in der beschriebenen möglichen Welt. Dies geschieht in einer Vielzahl von Weisen, direkt oder indirekt, auch durch Auslassung, aber dann durch präzise Auslassung. Der Nouveau Roman Robbe-Grillets spielt mit den inhaltlichen und formalen Methoden, mit denen die Fragen Wer? Was? Wann? Wie? Warum? Und Wozu? üblicherweise beantwortet werden, und zwar so, dass sie nicht mehr eindeutig zu beantworten sind. Die grundsätzliche Unterbestimmtheit des im Roman Beschriebenen wird potenziert und hypostasiert. Lem bemerkt nicht unzutreffend, die Rezeption solcher Texte vermittle ein Gefühl ständiger Unbefriedigung.
Der berühmteste Loop der Literaturgeschichte ist zweifellos der Tod des Capitaine de Reixach in »La Route des Flandres«, dem überragenden Meisterwerk Claude Simons. Nicht nur dort wird die Szene wieder und wieder durchgespielt, wie de Reixach zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in einen Hinterhalt gerät, den er hätte erkennen müssen, und von einem deutschen Fallschirmjäger erschossen wird. Auch in anderen Romanen wird geschildert, wie sich de Reixach exponiert. Wollte er sterben? Weil ihn seine sehr junge, sehr eigenwillige Frau Corinne mit seinem Jockey Iglésia betrogen hat? Bei Simon haben diese und die anderen Wiederholungen nicht die Funktion, Orientierungslosigkeit zu erzeugen. Simons Romane beschäftigen sich nicht mit sich selbst. Sie bilden Denkprozesse ab: der Romanfiguren, aber auch der allwissenden Erzähler. Der allwissende Erzähler ist nicht mehr gänzlich allwissend, sondern auf derselben Ebene angesiedelt wie die Romanfiguren. Es gibt nicht mehr die eine Empirie der möglichen Welt des Romans, die der allwissende Erzähler verwaltet oder hergestellt hat. Der Leser soll sich ein Bild der Romanwelt machen. Er soll entscheiden, ob de Reixach den Tod gesucht hat.
Wie könnte ein Fazit für die Literaturtheorie Lems aussehen? Die verschiedenen Varianten des traditionellen Literaturverständnisses verstehen das literarische Werk als immanente Einheit und porträtieren den Autor gern als Gott vergleichbaren Schöpfer. Paradigmatisch sind hier George Steiners »Real Presences« und »Grammars of Creation«. Das gilt auch für den zur Zeit Lems modischen Strukturalismus und erst recht für die Verfasser des Nouveau Roman. Die kybernetische Betrachtungsweise ermöglicht eine substantielle Neujustierung des Verhältnisses Autor – Text – Leser: Die Einheit des Textes, so man von einer solchen sprechen kann, ist nicht mehr das alleinige Verdienst des Autors, sie ist auch das Ergebnis einer Selbstorganisation des Textes. Luhmann spricht davon, dass sich Kunstwerke selbst programmieren. Die positive, negative oder indifferente Rezeption des Textes ist nicht eine unausweichliche Folge der immanenten Qualität des Textes, sondern das Resultat bestimmter gesellschaftlicher Umstände und Prozesse.
Dabei ist Lem ehrlich bis zur Selbstannihilation. Immer wieder weist er auf wichtige Grenzen seiner eigenen Vorgehensweise hin. Mit Ehrlichkeit gründet man keine Schule – es ist deshalb auch nicht überraschend, dass seine theoretischen Ideen nicht in dem Ausmaß rezipiert wurden, das sie verdienen. Lem stellt ausdrücklich fest, er habe keine Theorie für die Literatur als ästhetisches Phänomen. Er räumt ein, dass sich Verstehen und Gefallen nicht völlig voneinander trennen lassen. Die kybernetische Sichtweise beansprucht, einen Beitrag für das Verstehen des Verstehens zu liefern. Doch Lem sieht keinen Ansatzpunkt, das ästhetische Gefallen als solches kybernetisch oder in irgendeiner Form evolutionär zu erklären. Er verdammt den Begriff der »ästhetischen Information«, vor allem die Formel von Abraham Moles, nach der die ästhetische Information das Verhältnis der »subjektiven Redundanz« zur »statistischen Information« darstellt. Die subjektiv auftretende Verringerung der in Kunstwerken enthaltenen statistischen Information soll ein Maß für deren ästhetische Ordnung sein. Lem stellt richtig: Die Formel beschreibt vielmehr eine typische Eigenschaft jeder Wahrnehmung, die immer so gesteuert ist, dass die wahrgenommenen Elemente in einen Prozess des Bescheidwissens oder des Wiedererkennens integriert werden. Die »subjektive Redundanz« verringert die »statistische Information«, ohne dass das etwas mit Ästhetik zu tun haben muss.
Wenn der Kybernetiker eine ästhetische Theorie haben will, muss er sich also woanders bedienen. Dabei mangelt es nicht an Auswahl. Der Theoretiker Lem denkt nicht daran, anderen Leuten Vorschriften zu machen. (Über den Schriftsteller Lem schreibt der Theoretiker allerdings: »Der Künstler versucht, mit den spezifischen Mitteln seiner Talente anderen Menschen – auch anderen Künstlern – seine Art, die Welt zu erleben, aufzuzwingen.«) Den Theoretiker würde nur eine Metaästhetik interessieren. Die Philosophie bietet viele Ästhetiken und Metaästhetiken an. Während die Philosophen die Ebenen gewöhnlich sauber auseinanderhalten, nehmen es die bildenden Künstler und die Literaten nicht so genau, häufig vermischen sie die Ebenen absichtsvoll – aus ästhetischen Gründen. Damit kann sich Lem niemals anfreunden. Er ist durch und durch Empiriker. Der Witz an der Empirie ist, dass es nur eine Empirie gibt. Die entscheidet. Es muss eine Entscheidung geben.
Lem hat auch keine Theorie für Gefühle. Von Gefühlen hält er entschieden Abstand: Die Kybernetik befasst sich damit, wie Information gesendet und empfangen wird, aber nicht damit, wie sie empfunden wird. Seltsamerweise vollzieht Lem hier nicht den Hüpfer auf die Metaebene. Man kann die Funktion von Gefühlen auf allen Ebenen der Literatur untersuchen, ohne dass man vorläufig oder endgültig klärt, wie das genau vor sich geht, was man mit Empfinden bezeichnet. Ich verweise auf meinen Essay »Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument«, der es gerade auch unternimmt, die Funktion von Gefühlen für den Roman zu beleuchten. Prosa und Lyrik stellen nicht nur Gefühle dar, Romane, Erzählungen und Gedichte verwenden Gefühle als Organisationsprinzipien. Das ist der große Unterschied zu den Wissenschaften.
Der zentrale Einwand gegen Überlegungen wie die vorstehenden ist immer derjenige, sie seien zu wenig konstruktiv. Lem bietet keine kausale Theorie der Entstehung von literarischen Werken und keine kausale Theorie der Wirkung von Werken an. Warum es für Letztere gar keine kausale Theorie geben kann, begründet er, wie geschildert, mit der Analogie zur biologischen Evolution und dem dabei endemischen Zufall. Für die Beckett-Prosa fand sich erst im 34. Anlauf ein Verlag, und die Kritiken waren nicht so, dass es mit der Beckett-Prosa unbedingt weitergehen musste. Die Zahl hymnisch rezensierter Werke von mittlerweile gänzlich vergessenen Autoren hingegen ist Legion. Nicht zu vergessen: Die Klassiker der Antike und des Mittelalters sind auch ohne Experten im heutigen Sinne über uns gekommen. Man sollte vor dem Problem der »Genera tionsfilter« und der Frage nach der Rolle der Literaturexperten nicht einfach die Waffen strecken. Wann und auf welche Weise werden individuelle Urteile zu kollektiven Urteilen? Gibt es überhaupt kollektive Urteile?
Lem beschreibt umrisshaft, wie seine Romane und Erzählungen entstehen. In seinem Bewusstsein tauchen unbebilderte Einfälle auf, die jedoch keine vorzeigbare sprachliche Form besitzen. Er spricht von einem »Bedeutungsnebel«, der allerdings in eine bestimmte semantische Richtung zieht. Und dass er, Lem, dabei Erregung empfindet. Erst in der Folge aktualisieren sich sprachlich einigermaßen wohlgeformte Sätze. Die ursprünglichen Einfälle sind gewissermaßen Motive, Themen, die dann Sätze generieren und organisieren. Diese Art der Beschreibung steht ziemlich zusammenhanglos neben dem funktionalen Kybernetikgebäude. Ich als Leser würde mir wünschen, dass diese Überlegungen Einlass in das bestehende Kybernetikgebäude fänden. Oder dass das Gebäude erweitert werde, um diese Überlegungen zu beherbergen.
Anzumerken ist noch, dass mittlerweile die Zeit über Gleichgewichtsmodelle außerhalb der Technik und der Biologie hinweggegangen ist. Gleichgewichte sind Referenzpunkte, aber nicht mehr, wie früher, unbedingt wünschbare Zustände von Systemen. In der Thermodynamik etwa werden vor allem die Übergangsprozesse, die Zustände zwischen den Gleichgewichten untersucht, in der empirischen Makroökonomie haben die Modelle kaum mehr Berührungspunkte zu Gleichgewichtszuständen. Bereits Luhmann interessierte sich nicht mehr für Gleichgewichtszustände, sondern für die Prozesse der (Selbst-)Stabilisierung. Sein soziologischer Funktionalismus gilt der nicht bewerteten Fortexistenz der Gesellschaft: Etwas perpetuiert oder destruiert die Gesellschaft. Wie die Gesellschaft unter einem ethischen Gesichtspunkt aussieht, ist egal. Lems Konzentration auf das Homöostatische ist démodé. Aber seine Betrachtungen lassen sich ohne Schwierigkeiten funktional in einem Luhmann’schen Sinn verallgemeinern, ohne an Aussagekraft zu verlieren. Eine Theorie der Unmöglichkeit der Theorie des literarischen Werkes ist nicht unmöglich.
Vortrag, gehalten am 3. 3. 17 auf der Konferenz
Kosmos Lem in Darmstadt
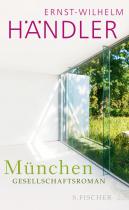
Thaddea, Anfang 30, sehr wohlhabend, hat ihr Leben unter Kontrolle. Sie besitzt zwei spektakuläre Häuser in Grünwald und Schwabing und setzt ihre ersten Schritte in ein Leben als freie Therapeutin. Doch als ihre beste Freundin Kata sie mit ihrem Freund Ben-Luca betrügt, stürzt sie in ein Gefühlschaos. Sie beschließt, sich von beiden zu trennen, und nähert sich stattdessen Pimpi an, Ben-Lucas bestem Freund. Sie besucht Empfänge und Events der Münchner Society: die Party eines Fernsehproduzenten, eine Ausstellungseröffnung auf Schloss Herrenchiemsee. Der Schmerz bleibt. Hochsensibel beginnt sie zu erkunden, wo das eigene Ich die Welt berührt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /