»Siri«, versuche ich es, »erzähle mir die Geschichte der Produktion des Spielfilms ›Chimes at Midnight‹ von 1965, Regie: Orson Welles.«
Siri sagt, sie könne mich nicht verstehen. Ich wiederhole meine Frage. Ohne zu zögern, erklärt Siri, eigentlich habe Welles, 1915-1985, für den Produzenten Emiliano Piedra, 1931-1991, ›Die Schatzinsel‹ verfilmen sollen. Welles aber hatte einen anderen Plan. An einem Piratenfilm war er nie interessiert gewesen; stattdessen konzentrierte er sich in Spanien, finanziert vom nichtsahnenden Piedra, von Anfang an voll und ganz auf seinen Falstaff-Film. Seinen Geldgeber ließ er im Glauben, er spiele wie ausgemacht den einbeinigen Long John Silver. In Welles’ Auftrag drehte ein anderer Regisseur Landschaften aus Stevensons Roman, die Wüste, das Meer, und schickte die Aufnahmen zur Beruhigung an Piedra. Die technischen Mängel des fertigen Falstaff-Films wurden bei seiner Uraufführung heftig kritisiert, ja belächelt, ebenso wie Welles selbst. Er sei der erste Falstaff, der »zu dick« für die Rolle sei, und habe bei der Nachvertonung unverzeihlich geschlampt, hieß es im TIME-Magazine. Tatsächlich waren nicht nur Teile der Tonspur asynchron; Welles, dem bald das Geld ausgegangen war, hatte in der Postproduktion kurzerhand einige Figuren des Films selbst eingesprochen: den Earl of Worcester ebenso wie ein Dutzend namenlose Boten bis hin zum Ächzen und Stöhnen der Soldaten, nicht zu vergessen der Pferde in der Schlacht von Shrewsbury.
»Verwandte Themen: Orson Welles’ Hörspiele«, beendet Siri ihren Bericht.
»Hm«, sage ich, »›Der Krieg der Welten‹ … klar. Aber was noch?« Für einen Moment habe ich vergessen, dass Siri kein Mensch ist.
»Orson Welles wirkte in über fünfzig Hörspielen mit, primär in den 1930er Jahren«, antwortet sie sofort. Mit ihrer hellen Frauenstimme, die sowohl einer altklugen Sechzehnjährigen als auch einer junggebliebenen Sechzigjährigen gehören könnte, erklärt sie, dass die Radiokarriere des jungen Orson Welles‘ in der Sendung »The March of Time« begann, eine Art akustische »Wochenschau«, mit der Besonderheit, dass die aktuellen Geschehnisse im Studio nachgestellt wurden. So war Welles, der geniale Stimmenimitator, mit gerade mal zwanzig Jahren Spencer Tracy, sprach Sigmund Freud, sprach den Schauspieler Paul Muni und einmal sogar, als 1936 über seine eigene ›Macbeth‹-Aufführung berichtet wurde, sich selbst.
»Wie …?«, frage ich Siri, »wie: sich selbst?«
»Orson Welles sprach Orson Welles«, sagt Siri.
Nationale Berühmtheit erlangte er kurz darauf als ›The Shadow‹ in der gleichnamigen Hörspielreihe. Darin jagt ein reicher Privatmann mit der geheimnisvollen Gabe, seinen Körper zum Verschwinden zu bringen, auf eigene Faust Verbrecher. In den folgenden zweiundzwanzig Hörspielen der Reihe ›The Mercury Theater on the Air‹, Siri spult blitzschnell Titel herunter, ›Dracula‹, ›Sherlock Holmes‹, ›In 80 Tagen um die Welt‹, tritt Welles stets als allwissender Erzähler auf. Als Radio-Berühmtheit ist er dann auch im Trailer zu seinem ersten Kinofilm, ›Citizen Kane‹, zwar zu hören, aber nicht zu sehen, obwohl er die titelgebende Hauptrolle spielt. Automatisch startet auf dem Tablet ein Schwarzweißfilm. Lediglich ein Mikrofon füllt den Bildschirm aus, dazu ertönt Welles sanfte Stimme.
Während ich mich noch frage, ob Siri beleidigt sein könnte, wenn ich, anstatt mit ihr zu sprechen, mich für das Internet entscheide, und ich mir gleichzeitig sage, dass es langsam wirklich an der Zeit ist, ins Bett zu gehen, tippe ich ›The Magnificent Ambersons‹ ein, jener Film, der heute nur mehr in einer vom Studio verstümmelten Fassung existiert und die Hollywood-Karriere Welles’ ruinierte. Und was für ein seltsamer Zufall, denke ich mir, als ich die endlosen Einträge und Mutmaßungen über die »wahre Gestalt« der »Ambersons« überfliege, was für ein seltsamer Zufall oder wahrscheinlich doch nur Einbildung, dass bei diesem Schicksalsfilm zum ersten Mal und vielleicht für immer dem sechsundzwanzigjährigen Welles Stimme und Körper durcheinandergeraten: Um Zeit zu sparen, ließ Welles seine Schauspieler alle Dialoge vorab aufnehmen. Am ersten Drehtag, die Szene einer Dinnerparty, fiel die Klappe, die Bänder wurden gestartet. Aber entweder waren die Stimmen aus den Lautsprechern zu leise oder es ertönten stattdessen ohrenbetäubende Geräusche, und die Schauspieler, die mit größter Mühe in ihrer Rolle zu bleiben versuchten, öffneten und schlossen die Münder zum Brummen und Kreischen der Rückkopplung.
Dass Welles’ Karriere als Regisseur nach dem ›Ambersons‹-Desaster vorbei war, lässt sich nicht behaupten. Wenn ich die sehr überschaubare Liste seiner zwölf Kinofilme herunterscrolle, die er in siebzig Jahren gedreht hat, stechen mir sofort Namen ins Auge, die ich als Klassiker »abgespeichert« habe, ›Die Lady von Shanghai‹, ›Othello‹ und ›Im Zeichen des Bösen‹, wobei ich plötzlich unsicher bin, ob das der richtige Begriff ist, abgespeichert, und wann er überhaupt in unseren Wortschatz eingegangen ist, und ob es eigentlich heute, um diese Uhrzeit, nicht schon zu spät für so eine Recherche über so einen Giganten wie Welles ist. Trotzdem macht es mich plötzlich unerklärlich traurig, als mir auf der »Google Bilder«-Seite ein alter, bärtiger, bulliger Mann in einem Mosaik aus Bildern seiner selbst entgegensieht, erwartungsvoll, und mir Siri erklärt, dass fast alle seine Filme von den Studios verstümmelt wurden. Sie zählt mir die Titel jener Projekte auf, an denen Welles teilweise über Jahrzehnte hinweg drehte, ohne sie je zu vollenden, ›Don Quijote‹, ›The Other Side of the Wind‹ und ›Moby Dick‹ – mit sich selbst in sämtlichen Rollen. Was für eine Vergeudung, denke ich mir, als Siri weiter die zahllosen B-Movies herunterrasselt, in denen Welles als Schauspieler auftrat, um seine eigenen, nie fertiggestellten Filme zu finanzieren. So auch in seinem letzten Auftritt, 1985, als Stimme, in dem Zeichentrickfilm ›The Transformers: The Movie‹. Welles spricht Unicron, einen Roboter-Planeten, der andere Gestirne verschlingt, verstrahlt, zerstört, bevor er selbst aus der Welt geschafft wird. Ein Planet aus Metall, gefräßig und einsam.
Und als ich an diesem Abend, in Gedanken darüber, wie alles so kommen konnte und was für Filme wir heute hätten, hätte Welles doch nur einen großzügigen Mäzen gefunden, noch einmal den Fernseher anschalte und ich mich durch die Programme zappe, kommt es mir in einem absurden und beglückenden Augenblick so vor, als hörte ich ihn, wider aller Wahrscheinlichkeit, als sei das alles er: die Nachrichtensprecherin, der Comedian, Angela Merkel, Marlon Brando, Tom Schilling, Martina Gedeck, der Mann der tausend Stimmen, Orson Welles.
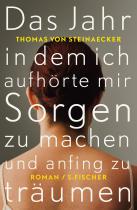
Risiken abzusichern ist ihr Geschäft. Doch sie verstrickt sich in Unsicherheiten, trügerische Phantasien und Ängste. Brillant, packend und raffiniert erzählt Thomas von Steinaeckers großer Zeitroman von unserer Welt, in der alle Sicherheiten endgültig abhanden gekommen sind und unsere Sehnsüchte in die Irre führen. Ein schlau-präzises und gespenstisch-surreales Porträt unserer Gegenwart.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /