Gewöhnlich notiere ich viel, während ich einen Roman vorbereite. Anekdoten, Bilder, Wörter, die mir gefallen und die sich nach und nach zu einem groben Plan des Buches fügen. Doch dieser Plan ist mehr Wegweiser als detaillierte Route. Dann schreibe ich den Text ohne große Unterbrechungen und überlasse mich dabei den Geschichten, die ausgehend von ihrem ursprünglichen Kern wuchernd wachsen.
Der Kern von ›Abgesang des Königs‹ ist die Beziehung von Kunst und Macht. Mein Vorbild war das Spannungsverhältnis zwischen den Künstlern an europäischen Königshöfen und den Monarchen, für die sie arbeiteten. Doch ich beschloss, als Schauplatz den Ort zu wählen, an dem ich damals lebte, die Grenzregion zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten. Daraus entwickelten sich die verschiedenen Elemente der Geschichte wie von selbst: Der Machthaber würde ein Capo des organisierten Verbrechens sein und der Künstler in seinen Diensten ein Mann, der in der Wüstengegend dessen Heldentaten besingt. So konnte ich meine eigenen Gedanken über die Sprache und ihre politische Vereinnahmung darstellen, ebenso den Wahn, der die Mächtigen umgibt und sie – in allen Epochen und allen Kulturen – bisweilen zu größenwahnsinnigen Ungeheuern mutieren lässt. Die Verbrecher, mit denen wir in diesen finsteren Zeiten in Mexiko kämpfen müssen, haben den Sadismus nicht erfunden, sie üben ihn nur ohne den Prunk jener Monarchen aus, die ich mir zum Vorbild nahm, sind jedoch vom gleichen Stamm. Der Sänger im Roman ist eine aktuelle Version früherer Künstler (Gaukler, Maler, Musiker), die hin- und hergerissen waren zwischen dem Gehorsam gegenüber der etablierten Macht und ihrer eigenen schöpferischen Freiheit.
Der Kern von ›Zeichen, die vom Weltende künden‹ ist die Reise, auf die sich Makina begibt, eine intelligente Frau, die sich zu helfen weiß und auszieht, um ihren verschwundenen Bruder zu suchen. Als Gerüst des Romans diente mir der Mythos der Unterwelt Mictlan und der einzelnen Stufen des Abstiegs dorthin. Darin beschrieben die Azteken ihre Vorstellung von den Etappen der Fahrt, die jeder nach seinem Tod anzutreten hatte, bis er in die tiefste Unterwelt gelangte, nach Mictlan. Vorher mussten mehrere Unterwelten durchlaufen werden, in denen man mit Widrigkeiten zu kämpfen hatte, und in jeder von ihnen legte man einen Teil seines menschlichen Wesens ab, bis schließlich der Ort der Wiedergeburt erreicht war. Der Leser muss die Mexica-Kultur nicht in ihren Einzelheiten kennen um zu verstehen, wie sie sich in den Roman einfügt. Ich habe mich dieses Mythos bedient, wie man ein Fundobjekt aufnimmt und es einem anderen Zweck zuführt als dem, für den es gedacht war: Das Objekt kann im neuen Kontext Neues bewirken, doch etwas von jener ursprünglichen Welt lebt weiter. Der Abstieg nach Mictlan stellt das Gerippe für Makinas Geschichte dar, und dank dieser Leihgabe kann der Leser vielleicht erahnen, auf welche andere Weise unsere Vorfahren die Zeit und den Tod verstanden. Dies gibt der Geschichte einen doppelten Boden, doch ihr Kern bleibt Makinas Reise und das, was sie dabei über sich selbst erfährt, über ihr Land und das Land, in das sie gelangt.
Die ›Körperwanderung‹ hat unter anderem mit der alten Frage zu tun, ob der Mensch dem Wesen nach gut oder schlecht ist. Diese Fragestellung führt meiner Ansicht nach in eine Sackgasse, denn wir Menschen sind häufig Grenzerfahrungen ausgesetzt, bei denen wir unsere moralische Kompetenz immer von neuem beweisen müssen. Wir sind aus keinem ewig gleichen moralischen Stoff gemacht, sondern müssen immer wieder neu an ihm weben. Eine Epidemie, bei der jeder lernen muss, gegen die Angst, das Misstrauen und die Paranoia zu kämpfen, gehört zu diesen Grenzerfahrungen, auf die man sich schwer vorbereiten kann. Ich hatte mit der Arbeit an dem Roman bereits begonnen, als ich die grauenvollen Wochen durchlebte, die auf die Meldungen über die Schweingerippe A/H1N1 folgten. Ich wohnte damals in Mexiko-Stadt und machte die Erfahrung, in einer Megacity zu leben, die von der Angst entvölkert wurde. Die meisten schlossen sich zu Hause ein, und wenn sie hinausgingen, dann mit tiefstem Misstrauen gegenüber denen, die sie ein paar Tage zuvor noch als freundliche Nachbarn angesehen hatten. Aber der Roman erzählt nicht von diesen Tagen, sondern gibt den kollektiven Gemütszustand wieder, in dem wir seit einigen Jahren in Mexiko leben: den der Beklemmung und des Misstrauens, die mit dem unermüdlichen Wunsch einhergehen, weiterzuleben und wieder eine Art Gemeinschaftssinn zu entwickeln.
Diese drei Romane fügten sich während des Schreibens zu einer Trilogie, die ursprünglich nicht als solche geplant war, doch in einer Art Rückkoppelung verbanden sich ihre Themen und sprachlichen Register. Ich schrieb den ersten und hatte bereits den zweiten im Kopf, ich überarbeitete den zweiten und machte Notizen für den dritten. Es sind drei unabhängige Geschichten, die jedoch einige meiner fixen Ideen zu Sprache, Körper oder Tod gemeinsam haben. Doch ebenso stellen sie den Versuch dar, zu begreifen, was in der letzten Zeit in meinem Land vorgeht. Die drei Geschichten teilen die gleiche Perspektive, und in allen drei lebt die Sprache von der lebendigen, zerklüfteten Landschaft, die das moderne Mexiko ausmacht.
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
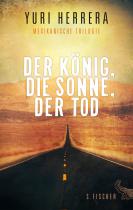
›Der König, die Sonne, der Tod‹ versammelt drei Romane des Mexikaners Yuri Herrera, die ihn zu einem der eigenwilligsten lateinamerikanischen Erzähler der letzten Jahre machen. Die mexikanische Wirklichkeit, die wir aus den Nachrichten kennen – die Welt der Drogenkartelle, der sinnlosen Gewalt, der illegalen Einwanderer in den USA –, ist der Bodensatz, auf dem Herrera seine Geschichten ansiedelt. Auf berückende Weise gelingt es ihm, von Figuren zu erzählen, die sich in dieser Wirklichkeit bewegen und zugleich über ihr zu schweben scheinen – wie El Lobo, der die Tochter des Drogenbosses liebt; wie Makina, die auszieht, die Grenze zu queren; wie Alfaki, der nicht anders kann, als den Dreck wegzumachen. Es sind Erzählungen aus dem Inneren eines Landes, die sich weiten zur großen Erzählung über das Innerste unserer Welt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /