Der Missionare Rede von Wandel und Neugeburt hatte auf meinen Vater einen so tiefen Eindruck gemacht, dass er seinen erstgeborenen Sohn Frank Okwuofu (»Neues Wort«) nannte. Die Welt hatte es mit meinem Vater nicht besonders gut gemeint. Er war Waise; seine Mutter war bei der Geburt ihres zweiten Kindes gestorben, und sein Vater Achebe, vor einem bitteren Bruderkrieg in seiner Heimat geflohen, überlebte sie nur kurze Zeit. Mein Vater wuchs demzufolge nicht bei den Eltern auf (an die er keine Erinnerung hatte), sondern bei Udoh, einem Onkel mütterlicherseits. Ausgerechnet dieser Mann nahm, wie es das Schicksal wollte, die ersten Missionare des Dorfs bei sich auf. Doch der Familienlegende zufolge hatte dieser offenbar sehr großzügige und tolerante Mann schließlich von der Sache genug und bat seine Gäste, auf den Dorfplatz zu ziehen, und zwar vor allem ihrer Gesänge wegen, die er als zu schmerzlich für die Heimstatt eines Lebenden empfand. Seinen jungen Neffen aber hielt er nicht davon ab, die Gesellschaft der Sänger zu suchen und ihrer Botschaft zu lauschen.
Das Verhältnis zwischen meinem Vater und seinem alten Onkel war für mich lehrreich. Die Ehrerbietung in Tonfall und Miene meines Vaters, wenn er von diesem Verwandten sprach, verlieh der Verbindung eine geradezu mystische Innigkeit. In seinen letzten Lebensjahren erzählte er mir eines Tages von einem seltsamen Traum: Sein Onkel war ihm erschienen, er hatte wie auf einer langen, beschwerlichen Reise eine kurze Rast eingelegt, um nach dem Rechten zu sehen und das »moderne« Haus seines Neffen mit den weiß getünchten Lehmwänden und dem Wellblechdach zu bewundern.
Mein Vater war ein wortkarger Mann, und stets habe ich bedauert, ihm nicht mehr Fragen gestellt zu haben. Heute weiß ich, dass er sich alle Mühe gab, mir das aus seiner Sicht nötige Wissen mit auf den Weg zu geben. So erzählte er mir beispielsweise, wenn auch indirekt, von seinem einen zaghaften Versuch, seinerzeit den Onkel zu bekehren. Dazu kann es nur im ersten missionarischen Überschwang gekommen sein! Der Onkel jedenfalls wies das Ansinnen zurück und zeigte auf die ehrfurchtgebietenden Insignien seiner drei Titel. »Was würde aus denen?«, fragte er meinen Vater. Es war eine ehrfurchtgebietende Frage: Was würde aus dem, der ich bin? Was würde aus meiner Geschichte?
Wir sehen also auf der einen Seite ein in widrige Zeiten hineingeborenes Kind, Waise und Erbe von Umbruch, Barbarei und Aufruhr auf einem ins Chaos gestürzten Kontinent; wen wundert da noch, dass er empfänglich war für Erklärungen und Losungen von Propheten und Verkündern einer neuen Heilsbotschaft?
Und wir sehen auf der anderen Seite seinen Onkel Udoh, einen der führenden Männer seiner Gemeinschaft, einen aufrechten und zugleich aufgeschlossenen Mann, einen, der, als er den Ehrentitel eines ozo erlangte, ein so üppiges Fest für das ganze Dorf ausrichtete, dass man ihm dafür einen eigenen Preisnamen verlieh; sollte er das alles nun wegwerfen, bloß weil Fremde aus weiter Ferne kamen und darauf drangen?
Diese beiden – mein Vater und sein Onkel – begründen die Dialektik, die mich geprägt hat. Udoh hielt unverrückbar am Hergebrachten fest, ließ jedoch zugleich seinem Neffen Raum, nach eigenen Antworten zu suchen. Die Antwort wiederum, die mein Vater im christlichen Glauben fand, löste viele Probleme, aber längst nicht alle.
Die größten Geschenke meines Vaters an mich waren die Wertschätzung, die er der Bildung entgegenbrachte, und die Einsicht, dass für die Einzelfamilie wie auch für die Gesellschaft der Fortschritt nur langsam vonstatten ginge, sodass jede Generation diejenige Aufgabe erkennen und übernehmen müsse, die ihr die Geschichte und die Vorsehung zudenken.
Aus meiner heutigen Warte sehe ich in meinem Großonkel Udoh Osinyi und in der Treue, die er vorlebte, ein wertvolles Vorbild. Ebenso verneige ich mich vor meinem Vater Isaiah Achebe, der fünfunddreißig Jahre lang als Christenprediger wirkte, und vor dem Wohl, das sein Werk und das Werk seinesgleichen unserem Volk gebracht haben. Ich selbst bin in hohem Maße Nutznießer der Bildung gewesen, der die Missionare ein Gutteil ihrer Anstrengungen widmeten. Mein Vater fand viel lobende Worte für die Missionare und ihre Botschaft, und die habe ich auch. Doch betrachte ich sie mit einer Skepsis, zu der er keinen Anlass sah. Was bedeutet es, frage ich mich, dass über die langen Jahrhunderte, bevor diese europäischen Christen auf ihren Schiffen zu uns kamen, um das Evangelium zu verkünden und uns aus dem Dunkel zu erlösen, ihre Vorfahren, ebenfalls auf Schiffen, unsere Ahnen dem horrenden transatlantischen Sklavenhandel überantworteten und die Finsternis über unsere Welt brachten?
1996
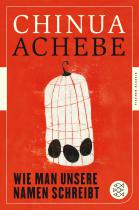
›Mein Vater und ich‹, ›Meine Töchter‹ - in 17 persönlichen, polemischen und politischen Essays betrachtet Chinua Achebe den Bogen seines Lebens. Kein Autor hat die Signatur, mit der ihn Afrika prägte, so deutlich beschrieben, analysiert und um seine Anerkennung gekämpft wie Achebe. In dem zum ersten Mal auf Deutsch vorliegenden Band erzählt er von seiner Kindheit, seiner Herkunft und seinem Erbe: von dem Kind in Nigeria bis zu dem Verkehrsunfall, der ihn über zwanzig Jahre an den Rollstuhl fesselte.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /