Mit dieser Selbstbeschreibung sind wir schon tief in der kulturhistorischen Vorgeschichte des personal essay. Was Rutschky (auf dem Cover seines Bandes ›Die Meinungsfreude‹ von 1997) als die Bauform seiner dort versammelten Stücke ausplaudert, ist nichts anderes als die Renaissancetugend der sprezzatura, die Baldassare Castiglione 1528 in seinem ›Il libro del Cortegiano‹, einem berühmten und folgenreichen Buch über die Tugenden des Hofmanns, beschrieben hat als eine Art metaphysische Coolness, die Leben und Tod beiläufig behandelt, Detailfragen höfischer, modischer oder erotischer Etikette aber mit ironischer Ernsthaftigkeit. Der französische Politiker und Fürstenberater Michel de Montaigne verwirklichte sprezzatura als literarisches Verfahren. Zwar widmet er in seinen ›Essais‹ von 1580 zum Beispiel einem so wichtigen und ernsten Thema wie dem Sterben ein Stück (er hält den Tod für ebenso unvermeidlich wie überschätzt; eigentlich ist das Gespräch über den Tod langweilig, da man nicht viel über ihn sagen kann). Sein eigentliches schriftstellerisches Engagement dagegen gilt so auf den ersten Blick trivialen oder abseitigen Themen wie ›Über die Hinkenden‹, ›Über einige Verse des Vergil‹, ›Über Wagen‹, ›Über die Daumen‹, ›Über das Schlafen‹ oder ›Über belanglose Spitzfindigkeiten und Spielereien‹. Aber seltsam: Man hat nach der Lektüre dieser provozierend subjektiven und oft völlig improvisiert wirkenden Gedankenspaziergänge oft das Gefühl, mehr über die Welt und unseren Platz in ihr gelernt zu haben als beim Lesen einer philosophischen Abhandlung, die Tod, Leben und das Große Ganze dröhnend, frontal und autoritativ angeht.
Nach Amerika kam die Gattungserfindung Montaignes (nach einer komplizierten europäischen Geschichte, die wir hier nicht im einzelnen verfolgen können) zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. Nachrevolutionäre amerikanische Intellektuelle, die New England Transcendentalists um Ralph Waldo Emerson und David Thoreau sahen im personal essay den passendsten literarischen Ausdruck ihrer philosophischen und politischen Intentionen. Emerson war eine Art literarischer Anarchist, der sich um die Systematisierung seiner Einsichten so wenig kümmerte wie um die Folgerichtigkeit ihrer Darlegung. Er sprach seine Intuitionen, geschützt und getragen durch die junge amerikanische Demokratie, möglichst radikal aus. Dann waren die anderen dran. Keiner mußte für immer recht haben. Emerson glaubte im achtzehnten Jahrhundert an die priority of democracy over philosophy, wie der amerikanische neo-pragmatist Richard Rorty einen seiner Aufsätze im zwanzigsten überschrieben hat. Berühmt ist Emersons »A foolish consistency is the hobgoblin of little minds, adored by little statesmen and philosophers and divines. With consistency a great soul has simply nothing to do«. Für Emerson stand die Persönlichkeit des einzelnen idiosynkratischen Denkers im Vordergrund. Aus ihr – und aus dem Gespräch, das sich seinen Statements anschloss – ergab sich alles Übrige.
Dieser kleine Erkundungsgang in Geschichte und Wesen der in Deutschland unterbewerteten Form des personal essay ist Teil eines online-Gedankenaustausches über die politischen Folgen der Literatur. Wieso eigentlich? Was kann eine Form, die Überschriften hervorbringt wie ›Über die Hinkenden‹ (Montaigne); ›Selbsterniedrigung durch Spazierengehen‹ (Wackwitz); ›Der Soziologe im Freibad‹, ›Die Hippies aus der Zone‹ oder ›Kunst des Schwadronierens‹ (Rutschky) ausgerechnet im politischen Raum bewirken, wo es doch wirklich um Wichtigeres geht? Wie kann eine Form, die so schamlos in die Kontingenz verliebt ist, es wagen mitreden zu wollen, wenn es um die politische Entscheidung, um das Eindeutige, um das demokratisch Legitimierte und verantwortlich Handlungsbegründende geht?
Zur Beantwortung dieser Fragen ist es lehrreich, die Diskussionskultur der frühen amerikanischen Demokratie mit – zum Beispiel – dem Diskussionsklima der zeitgenössischen deutschen zu vergleichen. Was man von Emersons Subjektivismus erstens lernen kann, ist zunächst mal der Mut, etwas zu sagen, das sich in der anschließenden Diskussion auch als falsch herausstellen wird, oder zumindest als etwas, dem die Mehrheit nicht folgen wird. Das es aber trotzdem gesagt zu werden verdiente. Die Diskussion in Deutschland – das fällt besonders jemandem wie mir auf, der ich seit 30 Jahren dort nicht mehr durchgehend gelebt habe – ist derzeit in einer Weise zwischen Befürwortern und Gegnern der »Willkommenskultur« festgefahren, die den wirklich anstehenden Entscheidungen nicht besonders gut tut. Unser Diskussionsklima ist vergiftet durch eine Kultur des Rechthabens und der moralischen Verurteilung der Kontrahentin, die tiefe Wurzeln in der deutschen Tradition hat. Denn die beiden Fraktionen, in die das politische Deutschland derzeit zerfallen ist, bedienen sich – wieder ein Begriff, den Rutschky 1997 in seinem Band über die »Meinungsfreude« elegant und cool (nämlich in der alten Tradition der sprezzatura) ausgearbeitet hat – beide der Schweren Zeichen apokalyptischer Rede. Im Grunde ist in Deutschland derzeit, wenn über Angela Merkels Umgang mit Migration und Globalisierung diskutiert wird, immer von den letzten Dingen die Rede.
Besonders auffällig ist das bei den Gegnern der Bundeskanzlerin. Sie sprechen als Apokalyptiker. »Deutschland schafft sich ab«. Wir stehen vor dem Untergang. Das »Abendland« muß sich gegen seine »Islamisierung« wehren. Die letzten Dinge werden ganz, ganz schlimm. Es ist fünf vor 12. »Ausländer raus!« Über dem Lärmen dieser Fraktion übersieht man oft, daß auch die »Wir schaffen das«-Fraktion sich äußert und gegenseitig bestätigt mithilfe von Pathosformeln, die aus der apokalyptischen Rede über das Zeitenende stammen. Sie sprechen allerdings im Gegensatz zu ihren Gegnern als Chiliasten. Ihre optimistischen Sprachspiele stammen aus einer anderen, aber auch sehr alten Vorstellungswelt, derjenigen, die annahm, daß vor dem Ende der Welt mit der Wiederkunft des Messias tausend Jahre anbrechen werden, in denen die Welt wieder heil wird. Alles Trennende wird verschwinden. Alles Verlorene kehrt wieder. Der Löwe wird mit den Lämmern grasen. Alle Grenzen werden aufgehoben. Alle Menschen werden Brüder. Wir bekommen Menschen geschenkt. Die letzten Dinge werden ganz, ganz prima. Aber auch bei den Chiliasten ist es kurz vor zwölf. Was nämlich den glücklichen Ausgang der letzten Dinge noch stört und alles zu ruinieren droht, ist die Apokalyptikerfraktion, die Pegida, die AfD, die »Rechtspopulisten«. Sind wir schon wieder soweit? Steht der Faschismus vor den Toren? »Nazis raus!«
Eigentlich ist aber, wenn apokalyptisch oder chiliastisch geredet wird, jedes Gespräch schon von vornherein zu Ende. Angesichts Schwerer Zeichen hat die subjektive Erfahrung einen ebenso schweren Stand wie das, was man gemeinhin den gesunden Menschenverstand nennt. Und hier, glaube ich, können sprezzatura und personal essay helfen. Sie können das Gespräch wieder in Gang bringen. Wie, möchte ich anhand eines Aufsatzes in Rutschkys bereits erwähntem Band über die Meinungsfreude zeigen, genauer gesagt einem Stück von 1993 mit dem Titel ›Wer sind die Ausländer?‹ Ein Jahr vor dessen Erscheinen in einer deutschen Zeitung – 1992 – erlebte die Bundesrepublik eine Art Probelauf der derzeitigen Migrationskrise, den Zuzug einer halben Million von Flüchtlingen und Asylbewerberinnen aus dem sich in verschiedenen Bürgerkriegen auflösenden Jugoslawien. Es gab, wie heute, furchtbare Brandanschläge auf provisorische Flüchtlingsunterkünfte. Die Diskussion war, wie heute, apokalyptisch und chiliastisch erregt. Rutschky diskutiert in seinem personal essay die politische Lage scheinbar unpolitisch. Er berichtet über seine Stadtspaziergänge und darüber, daß er an den Hauswänden Berlins hingesprühte »Textkämpfe« beobachten kann, in deren Verlauf sich zwei Fraktionen sozusagen gegenseitig ausbürgern. »Ausländer raus!« Das sind die einen. »Nazis raus!« Das sind die anderen. Und nun kommt eine Volte, die für den personal essay typisch ist. Sind demnach, fragt sich der spazieren gehende Beobachter, die »Nazis« eigentlich dasselbe wie die »Ausländer«? Oder ist es ganz anders? Ist es eigentlich die Jugend, die rausmuss, wie seine Nachbarin, eine ältere Dame (wieder so eine provozierend scheinunpolitische subjektive Essayistengeschichte) ihm neulich anvertraute? Die Situation wird immer unübersichtlicher. 1992 mussten offenbar alle mal raus. Aber so geht es doch nicht.
Ich muss jetzt, um klarzumachen, wie es vielleicht doch geht, ein bisschen ausführlicher Rutschky zitieren (was sich ja immer lohnt). »Wenn ›Ausländer, der raus muß‹ ein Zuschreibungsprodukt ist, wie die Soziologen sagen, wenn ich, du, er, sie unter gewissen Umständen für mich, dich, ihn, sie ebensolche Ausländer werden können – dann nimmt doch jeder gern den humanistischen Standpunkt ein, wir sind doch alle Menschen und sollten solche Zuschreibungen unterlassen. Sind wir damit tatsächlich aus dem Schneider? Wer den Hass mitbekommt, von dem Humanisten überschäumen können, wenn du nicht auf der Stelle humanistisch reagierst und die Gleichheit aller blanko unterschreibst, gerät in Zweifel. Wie gesagt, Humanisten lassen über die Parole ›Nazis raus‹ mit sich reden, während die Parole ›Ausländer raus‹ ihnen nur dazu taugt, den nächsten Nazi, der raus muss, zu identifizieren. Ich habe eine kleine Übung vorzuschlagen. Statt uns bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit als Humanisten zu profilieren, die jeden beliebigen ›Ausländer‹ als Zuschreibungsprodukt zu erkennen vermögen – in den USA nennt man das ›political correctness‹ und langsam dringt’s herüber – statt dessen beschäftigen wir uns mit der Frage, auf wen denn wir mit Xenophobie zu reagieren bereit sind (abgesehen natürlich von den Nazis; da scheinen wir ja a priori gerechtfertigt in unserem humanistischen Zorn).«
Rutschkys Xenophobieexperiment führt ihn dann auf eine Fahrt mit der U-Bahn-Linie 1 vom Schlesischen Tor Richtung Ruhleben. Und er erlebt dort, in der U-Bahn, seine ganz persönliche Xenophobie. »Jene dort sind die Ausländer, die raus müssen, und zwar subito: Diese beiden Säufer da, deren Schmutz- und Schnapsgestank den Waggon verpestet. Der eine hat sich die Hose vollgemacht, dem anderen ist die Büchse aus der Hand gefallen. Das Bier bildet eine Pfütze auf dem Boden. (…) Diese beiden Säufer mit unzweifelhaft deutscher Staatsbürgerschaft sind es, auf die ich mit Xenophobie, schwerem körperlichem Widerwillen reagiere. Entweder ihr geht oder ich; besser ihr. Die Säufer, das sind meine Ausländer, die müssen raus, sofort. Meine Xenophobie entspricht also dem klassischen Erklärungsmuster. Was raus soll, das ist ein abgewehrter Teil meiner selbst, die lockende, drohende Verwahrlosung, gegen die der Zivilisierte sich Tag für Tag neu organisieren muss.«
Was ist mit dem Perspektivwechsel des personal essay von den unbefragten Schweren Zeichen zum detaillierten Blick auf das Abseitige und auf sich selbst gewonnen? Ein neues Komplexitätsniveau der Diskussion. Ein gewisser Abstand zu den eigenen Meinungen. Die Wiederherstellung eines emotionalen Kontakts zu den eigenen abgewehrten Persönlichkeitsanteilen (dem »Schatten«). Eine gewisse Gelassenheit, die 1528 sprezzatura hieß. Möglicherweise passgenauere politische Lösungen, die sich einem Blick auf die Details der soziologischen Situation verdanken könnten. Nicht zuletzt die Fähigkeit, die Situation (und andere) mit Humor zu sehen. Kostbare Errungenschaften. »Jetzt seid ihr dran«, schreibt Rutschky. »Was graust den Türkenfeind, den Feind der Schwarzen, Polen, Muttis? Was graust den Humanisten? Erst wenn genug Geständnisse vorliegen, reden wir weiter über Humanismus.«
Der personal essay ist zu genau dem Zweck oft ein Fragment, damit die Leserin ihn im eigenen Kopf fertigschreiben kann. Und jetzt seid ihr dran.
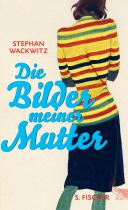
Stephan Wackwitz erzählt das Leben seiner Mutter, wie es war und wie es hätte sein können – mit Warmherzigkeit und Einfühlung, mit Intelligenz und Genauigkeit. Hineingeboren in eine schwäbische Industriellenfamilie in Esslingen am Neckar, flieht die 1920 geborene Margot vor dem autoritären Vater ans Berliner Lettehaus, wo sie das Modezeichnen erlernt. Aber trotz frühen künstlerischen Erfolgen und einer Amerikareise gelingt es ihr im Wirtschaftswunder-Deutschland nicht, aus ihrer Begabung mehr zu machen als das Hobby einer Ehefrau und Mutter in der deutschen Provinz. Das 20. Jahrhundert hat Frauen wie ihr alle Möglichkeiten eröffnet – und sofort wieder verschlossen.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /