Paul Scheerbart – in dessen Namen wir heute einen Übersetzer-Preis vergeben – hatte eine große Vision von Transparenz und mystischer Umschlossenheit, die vor 100 Jahren Realität wurde. Auf der Kölner Werkbund-Ausstellung baute Bruno Taut den Palast, den Paul Scheerbart in seinem Roman ›Die Glasarchitektur‹ beschrieben hatte. Ein orientalisch anmutender Turm, dessen ananasförmige Kuppel wie die Wände, auf denen sie ruhte, aus bunten Glasscheiben und -ziegeln bestand. Im Innern fühlte man sich – so die Zeitgenossen – wie in einem Kristall, dessen Farben von einem dunklen Blau über Moosgrün bis zu einem leuchtenden Gelb wechselten.
Ein utopisches Stück Architektur, ein expressionistisches Traumreich, das für die Besucher vielleicht eine ebenso verwirrende Erfahrung war wie die erste Begegnung mit der arabischen Poesie. Hört man zum Beispiel Adonis – der libanesisch-syrische, in Paris lebende Lyriker, dessen Übersetzer Stefan Weidner wir heute auszeichnen – seine Gedichte, vorlesen, vortragen, rezitieren, ist man von vielen Stimmen umfangen, von dem »Wortgesang«, wie er seine Poetik überschrieben hat. Adonis hebt zu einer fremden Vokalise an, die plötzlich mit rauen Konsonanten, nasalen Passagen, explodierenden Vokalen durchsetzt ist. Es ist ein rhythmisch gegliedertes Fließen, dessen Silben in einem Strudel vorbeirauschen. Ein Wort scheint in das nächste hinüberzugleiten, der Rhythmus wird schneller, Emotionen scheinen den Klang einzufärben, lange bevor wir Worte und Sätze, Verse und Strophen unterscheiden. Kein Zweifel, diese Sprache ist in einem anderen Aggregatzustand als unsere, hier baut keine gemeinsame Grammatik oder ähnlich klingende Phonetik eine Brücke. Schlagen wir eine zweisprachige Ausgabe auf, um der Stimme zu folgen, wird die Situation nur verzwickter. Da ist keine Partitur, deren Notation uns Anhaltspunkte gibt, und fast ist man versucht, dem mittelalterlichen Grammatiker al-Djahiz resigniert recht zu geben, der von dieser »Goldmine sprachlicher Ausdruckskraft« meinte, dass »der Nutzen der arabischen Dichtung allein den Arabern zugute kommt und jenen, die des Arabischen mächtig sind.«
Anders als die Musik, die überall hinreisen kann, lebt die Poesie in dem Paradox, dass wir zwar ihrem »Wortgesang« mit Intuition und Empathie folgen können, das Gedicht selbst uns aber vollkommen verschlossen bleibt, wenn wir seine Sprache nicht verstehen. Man mag vor diesem Paradox kapitulieren und sich mit der Unübersetzbarkeit des Gedichts abfinden – nicht aber Stefan Weidner, dem die Unmöglichkeit zum Motiv wurde und der in Adonis' Verse:
Dies ist mein Traum –
Nimm ihn
Nähe ihn und trage ihn
Als Kleid
einen Auftrag und eine Ermunterung heraushörte, das Unmögliche zu versuchen. Vorsichtig und hellhörig sondiert er die Lücken zwischen den beiden Sprachen, bringt die Aporien der verschiedenen Kulturen miteinander ins Gespräch und versucht in seinen Büchern und Kommentaren, unablässig uns Vorurteile gegen den Islam und den Koran auszureden. Sein Terrain, von dessen unleugbarer Dringlichkeit er uns seit den letzten Jahren nicht mehr überzeugen muss, ist wahrlich von Abgründen zerpflügt. In seiner Anthologie ›Die Farbe der Ferne‹ steckte er dieses weite Feld anhand der zeitgenössischen arabischen Lyrik ab – eine Lyrik, die in einer Sprache entsteht, die heute in Marokko und Tunesien, Ägypten, Palästina und Saudi-Arabien bis im Libanon, und Irak entsteht. Unterschiedlicher könnten die verschiedenen Kulturen in dieser einen Sprache nicht sein. Trotz dieser Heterogenität einen Korpus zu erstellen ist eine Leistung, die unseren ganzen Respekt verlangt, eine Arbeit, die Stefan Weidner noch mit Einzelbänden von Mahmud Darwish und Taha Muhammad Ali fortsetzte.
Der Widerstand dieser Gedichte gegen ihre einfache Übersetzung, und auch das enorme spezifische Gewicht der hermetischen Verse von Adonis, konnten Weidners optimistischen Enthusiasmus nicht dämpfen. Er findet sogar Zeit, um in der Germanistischen Bibliothek Tonbänder mit Lesungen von Thomas Kling zu hören. Der Rat, den der arabische Philosoph Ibn Khaldun vor 500 Jahren gab, »der Vater aller Zungenfertigkeit ist das Hören«, verlangt von der Übersetzung ein melodisches Pendant. Stefan Weidner geht es so nicht nur darum, das zu dechiffrieren, was das arabische Gedicht sagen will und sagen muss, es geht auch darum, eine deutsche Gestalt dafür zu finden, die sich auf Augenhöhe, oder besser: Ohrenhöhe, mit dem lyrischen Ausdruck unserer Sprache jetzt befindet:
Die beiden Dichter
Zwischen Stimme und Echo zwei Dichter
Der eine spricht, als wäre er
Ein zerbrochener Mond
Der andre ist still wie ein Kind
Das jede Nacht
Im Schoß des Vulkans schläft
»Zwei Dichter« – wenn man staunend der Kunst Weidners folgt, kann man nicht anders und in diesem Dichterpaar einmal den Kalligraphen mit der Rohrfeder und zum anderen den Nachdichter in Köln zu sehen, der im »Schoß des Vulkans« schläft. »Vulkan«, denn ein Gedicht von Adonis ist voller Andeutungen, Metaphern, voller mythisch-mystischen Verweisen auf die Kultur der Sufis und Verbeugungen, Anleihen und Einsprüche zur Tradition der westlichen Moderne. Adonis' Lyrik ist eine Lyrik des Werdens, die sich nie auf ein fixes Symbolsystem stützt, sondern dessen Symbole und Bilder sich immer auf etwas Anderes, Weiteres beziehen. Adonis' Semantik ist genauso fließend wie seine Phonetik.
Übersetzen, wie es Stefan Weidner versteht, ist eine unendliche Aufgabe, die erst zu einem relativen Ruhepunkt kommt, wenn die Fassung des Gedichts in der zweiten Sprache mit dem Gedicht in der ersten Sprache spricht – wenn er zwischen ihnen einen Dialog wahrnimmt, der eine Ahnung von der poetischen Tiefenschärfe seiner Arbeit vermittelt. Für uns bleibt dies oft im Obertonbereich der Sprache – wir, die wir kein Arabisch können, können diesen Dialog nicht hören, aber wir spüren seine Resonanz: und das macht Stefan Weidners Übersetzungen so einzig.
In seinen Essays entwickelt Adonis eine Vision einer arabischen Moderne, die im Mittelalter stattgefunden hat, als sich mystische Autoren zum ersten Mal von der Verschriftlichung und Kodifizierung der arabischen Lyrik befreiten und eine subversive Verssprache entwarfen. Ihre Radikalität entdeckte Adonis erst durch die Augen Baudelaires, Mallarmes und Bretons und machte ihre Errungenschaften zum Motor seines poetischen Entwurfs, der die engen Grenzen der Poetologie sprengt, und zum zivilisationskritischen Denkansatz wird: zum Postulat der Möglichkeit und unbedingten Notwendigkeit einer arabischen Moderne, die ihre Identität aus der richtig verstandenen eigenen Tradition gewinnt, die nichts mit blindem Befolgen der Scharia zu tun hat. So, und nur so hofft er die Defizite des westlichen Modernisierungsdrucks auszugleichen. Das ist die Utopie des Adonis, deren gedankliche Genese Stefan Weidner mit seinem neuen Übersetzungsprojekt auf einer Zeitreise zurückverfolgt. Nach den Dichtern des 20. Jahrhunderts hat er es sich zur Aufgabe gemacht, auch die Autoren am Beginn der arabischen Literatur für uns zu entdecken. Wie zum Beispiel Ibn al-Arabi:
Wüsst ich doch ob sie wissen
welches herz sie besitzen
wüsste die seele
welchen pfad sie beschreiten
ob sie es schaffen oder
ob sie wohl scheitern
wer meinte die liebe zu meistern
der verstrickt und verliert sich in ihr
Dir, lieber Stefan Weidner, werden neben Deinen eigenen Büchern, Zeitschriftenprojekten, Kommentaren und Glossen die Gedichte zum Übersetzen nie ausgehen, das wissen wir. Aber wir wünschen Dir, dass Dir auch die Liebe nie ausgeht – herzlichen Glückwunsch zum Paul-Scheerbart-Preis!
Der mit 5.000 Euro dotierte Paul Scheerbart-Preis wird von der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung seit 1998 jährlich zur Frankfurter Buchmesse verliehen.
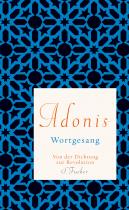
Adonis ist der interessanteste und wichtigste arabische Dichter und Denker. Der in Paris lebende Syrier ist dafür prädestiniert, die kritische Lage der arabischen Länder zu kommentieren. In seinen Essays zur arabischen Dichtung, zu Politik, Kultur und Gesellschaft fordert Adonis eine Zwiesprache zwischen Autor und Leser, die darin besteht, dem anderen zuzuhören, über sich selbst nachzudenken und zu wissen, dass niemand die Wahrheit kennt. Adonis denkt politisch und fühlt als Dichter. Ein Buch, das einem den Schlüssel zur arabischen Poesie gibt und zugleich einen verblüffenden, höchst interessanten Bogen von der Dichtung zur Revolution schlägt.






 © S. Fischer Verlag GmbH /
© S. Fischer Verlag GmbH /