Schloyer versus litBei einem Tischtennisspiel sprach lit mit dem Lyriker Christian Schloyer über die Risiken und Nebenwirkungen des Schriftsteller-Daseins und über seine Strategie, beim Schreiben die richtigen Worte zu finden Ein stillgelegtes Fabrikgelände im Hildesheimer Stadtteil Moritzberg. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Der deutsche Literatennachwuchs liegt im Gras, liest Bücher, isst gelben Reis aus Pappschalen, sitzt auf Schaukeln oder spielt Tischtennis. Einer von ihnen ist der 1976 in Erlangen geborene Lyriker Christian Schloyer, der 2007 mit „spiel-ur-meere“ seinen ersten Lyrikband im KOOKbooks-Verlag veröffentlichte. Gerade war er noch auf der Bühne, hat gemeinsam mit Ron Winkler und Ulrike Almut Sandig Lyrik vorgelesen, nun wird er von lit zu einem Frage-und-Antwort-Spiel gebeten. Punktestand: 0:0lit: Nein, das ist nicht nur ein Tischtennisspiel, das ist auch ein Interview. Und nein, das ist nicht nur ein Interview, das ist auch ein Tischtennisspiel. Muss man immer mehrere Dinge gleichzeitig tun können, wenn man im Literaturbetrieb Fuß fassen möchte? Schloyer: Was meinst du mit Literaturbetrieb? Die kleine „Dichterszene“? OK, ich bin gerne unterwegs auf Lesungen, ich mag den Austausch mit Lyrikerinnen und Lyrikern. Ich bin glücklich, dass ich meinen Wunschverlag dazu bewegen konnte, meine erste Buchveröffentlichung zu machen. Und ich bin freilich sehr zufrieden mit den bisherigen Rezensionen zu meinem Buch. Von daher sieht’s so aus, als hätte das „Fußfassen“ erstmal ganz gut geklappt. Besser jedenfalls als das Tischtennisspielen. Ich glaube aber, dass „die Schriftstellerei“ ein ebenso spezialisiertes Ding ist wie andere hoch qualifizierte Berufe auch. Ich kann weder schmettern noch Topspin. Mehreres gleichzeitig zu tun, ist dem Schreiben also nicht unbedingt zuträglich. Trotzdem kann man fast nicht anders, weil man halt selten ein verlässliches Einkommen hat. Man muss improvisieren. lit: Du bist ja auch nicht nur Lyriker, sondern außerdem auch Lektor und Texter. Du hast sogar, so weit ich weiß, deine eigene Firma. Schloyer: Ich habe mich nie getraut, ausschließlich literarisches Schreiben zu praktizieren. Mir wurde immer gesagt, dass ich auch etwas „Vernünftiges“ tun können muss im Leben. Wenn man noch dazu eine Zeit von Hartz IV-Leistungen abhängig war (ich muss mich ja nicht nur um mein finanzielles Überleben kümmern, ich habe ja auch einen Sohn) – braucht man sich um „mangelnde Erdung“ nicht zu sorgen. Die holen einen brutalstmöglich auf den Boden der Tatsachen zurück. OK, der Ball ging jetzt daneben. Meine Selbstständigkeit, „Firma“ klingt etwas übertrieben, war da zunächst mal reine Notwehr. Damit die das mit dem Schriftsteller schlucken, musste ich mich eben als Schriftsteller selbständig machen, der auch Auftrags- und Werbetexte macht und da eine entsprechende Auftragslage vorweisen kann. lit: Als Lyriker ist das ja noch einmal schwieriger mit dem Geld verdienen, da sich Lyrik nun mal nicht so gut verkaufen lässt. Romanciers haben es da leichter. Braucht man als Junglyriker Lebenskünstlerblut in den Adern, um nachts trotzdem schlafen zu können? Schloyer: Ich kann zum Glück sehr gut schlafen, so dass ich die wenigen Stunden Schlaf, die ich mir gönne, auch tatsächlich schlafend verbringe. Mal sehen, vielleicht wird das ja auch bei mir mal was mit einem Roman. Sorgen und Ängste kenne ich reichlich, finanzielle Sorgen kann ich da noch vergleichsweise leicht verdrängen. Risiken und Nebenwirkungen… Aber ich beklage mich nicht, ich will es ja so. lit: Du hast 2004 den Open Mike gewonnen und 2007 den Leonce-und-Lena-Preis bekommen. Wie wichtig sind Preise und Auszeichnungen? Und wie haben sie deinen Werdegang beeinflusst? Schloyer: Wenn es um das Fußfassen im sogenannten Betrieb geht, dann sind Preise und Auszeichnungen, vor allem in der Lyrik, sicherlich sehr wichtig. Der Leonce-und-Lena-Preis ist für mich endlich die Eintrittskarte in die „Lyrikszene“ gewesen. Ich kann mich ganz und gar unaltruistisch über einen solchen Erfolg freuen – im Grunde wäre mir aber eine Situation lieber, in der ich Ausnahmeerfolge bzw. Erfolgsausnahmen weniger nötig hätte. Copyright © Tessa Müller – Sep 15, 2008 |
|
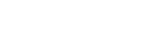





![Christian Schloyer [Copyright (c) n/a]](mueller-schloyer-tischtennis-portrait.jpg)

![Christian Schloyer: spiel - ur - meere [Copyright (c) KOOKbooks]](mueller-schloyer-tischtennis-cover.jpg)