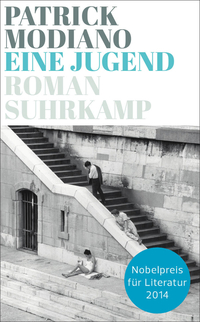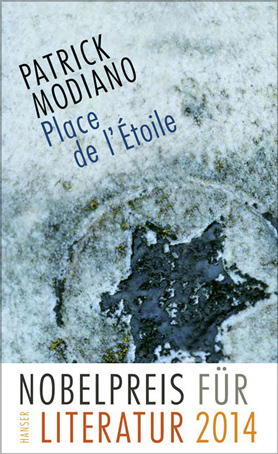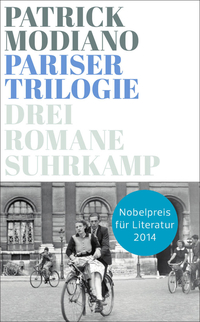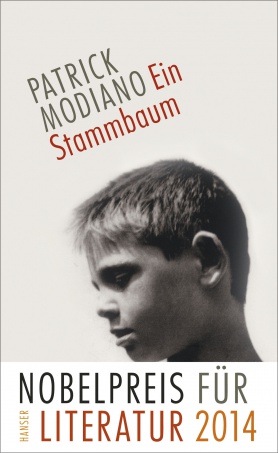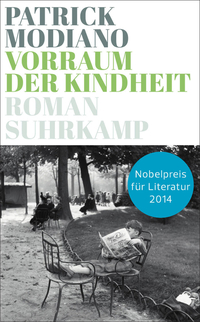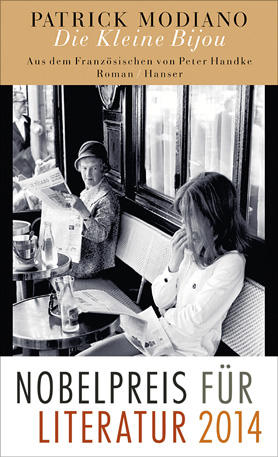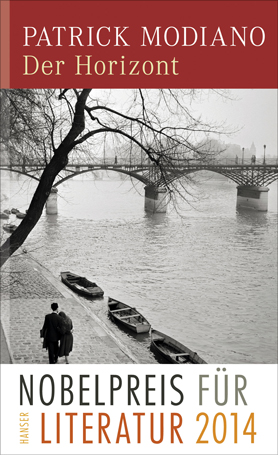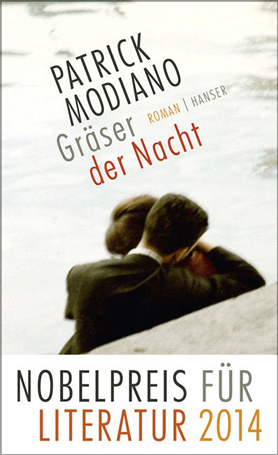|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Politik Geschichte Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
|
||
|
|
Rekonstruktionen
Über
Patrick Modianos Erzählen der Erinnerung Ein Essay von Lothar Struck |
|
|
Wer die Wettquoten zum Literaturnobelpreis bei »Ladbrokes« in den vergangenen Jahren studiert hatte, konnte von der Wahl Patrick Modianos zum Preisträger 2014 nicht besonders überrascht sein. Für große Teile des deutschen Literaturjournalismus hingegen war es eine veritable Wissenslücke. Modiano, 1945 geboren, hat im deutschsprachigen Raum lange ein tristes publizistisches Dasein zubringen müssen. Im Februar 1981 schrieb Peter Handke seinem Verleger Siegfried Unseld, er lese gerade Une jeunesse. Modiano schriebe »wie Simenon, ein Nachfahr von Bove«. Handke, ein großer Verehrer von Simenon, hatte damals begonnen, Bücher von Emmanuel Bove (1898-1945) zu übersetzen (Meine Freunde 1981, Armand 1982 und 1984 Bécon-les-Bruyères - Eine Vorstadt), die im Suhrkamp-Verlag erschienen waren. Boves Protagonisten waren häufig Kleinbürger, die an den Zeitläuften scheiterten. Im Begleitwort zu seiner Übersetzung des Romans Armand schrieb Handke: »Boves Kunst besteht darin, daß es ihm gelingt, aus dem Verhängnisballett immer wieder auszuscheren. Und in ein paar kleinen, unscheinbaren Sätzen, ein fast tonloses Lied anzustimmen.« In Modiano erkannte Handke eine Art Nachfolger Boves. Dessen Figuren streifen das »Verhängnisballett« ihrer Kindheit und Jugend irgendwann ab – und beginnen zu leben.
Der Erstling – eine wilde Phantasmagorie
Wer Modianos Literatur kennenlernen möchte, sollte besser zuerst auf die drei Romane der sogenannten »Pariser Trilogie« zurückgreifen: Abendgesellschaft (La ronde de nuit, 1969), Außenbezirke (Les boulevards de ceinture, 1972) und Familienstammbuch (Livret de famille, 1977). Übersetzt wurden sie von Walter Schürenberg. Erstmalig erschienen sie in Deutschland 1981 bei Ullstein, inzwischen liegen sie als Taschenbuch »Pariser Trilogie – Drei Romane« bei Suhrkamp vor. Abendgesellschaft und Außenbezirke spielen während der Besatzungszeit Frankreichs. Während in Abendgesellschaft ein junger, 20jähriger Protagonist zum Doppelagenten zwischen Kollaboration und Widerstand wird, trifft in Außenbezirke der Ich-Erzähler Serge Alexandre auf eine illustre Gesellschaft von »Schmierfinken, Kanaillen, Schakalen« am Rande von Paris, die sich mit kriminellen Geschäften, Sexspielchen und Alkohol vergnügt und sich mit der Besatzung arrangiert haben. Der Ich-Erzähler dieser Geschichte, ein gewisser Serge Alexandre, stößt eines Tages zu dieser Gesellschaft, in der auch sein Vater lebt, der ihn jedoch nach Jahren der Abwesenheit nicht erkennt. Serge gibt sich als Schriftsteller aus, bekommt prompt ein Engagement wird »Pornoschreiber, Gigolo, Vertrauter eines Alkoholikers und eines Erpressers«. Der Roman ist als Anrede auf den Vater formuliert. Das Wort »Papa« wird dennoch in Anführungszeichen gesetzt. Fassungslos sieht der Sohn, wie sein Vater innerhalb der Gruppe erniedrigt wird. Modiano zeigt fast nebenbei die hässliche Fratze des Antisemitismus der französischen »Eliten«, die sich unter der Nazi-Besatzung nicht großartig verbiegen mussten. Im Gegensatz zu Abendgesellschaft und Außenbezirke wird in Familienstammbuch größtenteils die Zeit nach dem Krieg erzählt. Nicht nur aus diesem Grund erscheint eine Zusammenfassung zu einer »Pariser Trilogie« eher nicht geboten. Die Ursache für diese Einordnung liegt womöglich in der Publikationsgeschichte von Modianos Büchern in Deutschland. Nach Außenbezirke hatte er 1975 mit Villa Triste einen neuen Roman in Frankreich publiziert, der in Deutschland bereits 1977 bei Ullstein erschienen war (übersetzt von Walter Schürenberg; 1994 als Das Parfum von Yvonne bei Suhrkamp). Und so nahm man das danach erschienene Buch Livret de famille (1979)/Familienstammbuch in die »Trilogie« auf. Familienstammbuch besteht aus 15 titellosen, mit römischen Ziffern versehenen Erzählungen, die vorwiegend das Leben eines Ich-Erzählers aufzeigen, der mehr als nur einmal unmissverständlich benannt wird: Er heißt Patrick Modiano. Eine Chronologie gibt es nicht, aber zumeist wird erwähnt, wie alt Modiano zum Zeitpunkt der Geschichte ist. Die Zeitspanne reicht von 1950 bis 1975, vom ersten wunderbar erzählten Schultag über zahlreiche Adoleszenz-Erzählungen bis zur Taxifahrt mit Frau und einjähriger Tochter 1975. Modiano thematisiert hier den Zufall bzw. Entscheidungen, die das Leben anderer verändern bzw. sogar erst ermöglichen. Wäre seine Mutter, eine Schauspielerin, 1940 für einen Film in die USA emigriert, hätte sie seinen Vater nicht kennengelernt. Hätte der vermeintliche Nazi-Kollaborateur aus Lausanne Erfolg gehabt und den Vater Modianos, der sich als Jude in Paris versteckt hielt, erwischt, wäre er seiner Mutter nicht begegnet. »Ohne diese Epoche…wäre ich niemals geboren worden«, so lautet denn auch ein paradox anmutendes Fazit. Die Nazi-Zeit als Geburtshelfer – das ist die Perversion, der Modiano auf den Grund geht. Er ist abgestoßen und fasziniert zugleich von diesem Fatum. Und man erinnert sich an Literatur von Holocaust-Überlebenden, die mit der »Schuld« des Davongekommen-Seins nicht klargekommen sind. So suggestiv Modiano in Familienstammbuch als Ich-Erzähler auftritt – die Erzählungen selber sind durchaus literarisch bearbeitet. Man merkt es daran, wenn er innig über Ereignisse seiner Eltern erzählt, die sich eindeutig vor seiner Geburt ereignet haben. Oder wenn sich »Erinnerungen« an den Frühsommer 1937 einstellen und evoziert werden. »Man ist immer begierig, seine Ursprünge kennenzulernen«, heißt es schon in Außenbezirke. Der Episoden-Roman ist eine literarische Selbst- und Familiensuche, eine Huldigung an das Dasein im Wissen um der Unabänderlichkeit der äußeren Ereignisse – respekt- und furchteinflößend zugleich. Und noch einmal 28 Jahre später
Es geht darum, die »Empfindung von Abhängigkeit und Luftmangel« zu durchbrechen und zu überwinden. Etwa wie Odile und Louis in Eine Jugend (Une jeunesse, publiziert 1981). Es ist die retrospektive Erzählung von sieben Monaten, die die beiden fast gleichaltrig 19jährigen kurz nach dem Kriegsende in Paris durch- und erlebten. Die Erinnerung geht fast genau 15 Jahre zurück. Louis und Odile werden im Nachkriegs-Paris wie Billardkugeln hin- und hergestossen. Odiles Karriere in einem Varieté scheitert; einmalig prostituiert sie sich für Geld. Zusammen mit Louis schließen sie sich immer mehr dem kriminellen Milieu an, verschieben Geld. Der Alltag und die Zukunftslosigkeit zehrt jedoch zu sehr an ihren Kräften, um eine auch nur halbwegs romantische Stimmung aufkommen zu lassen. Am Ende emanzipieren sie sich von ihrem Paten, dessen Stern sinkt, und behalten das Geld, welches sie eigentlich als Boten überbringen sollten. In der ewigen Gegenwart
Interessant, dass Modiano Jimmy/Jean mit biographischen Daten versieht, die den seinen ähneln. So ist die Figur am 20. Juli 1945 geboren, Modiano nur zehn Tage später. Der Geburtsort Boulogne-Billancourt ist sogar identisch. Der Roman endet mit der ausführlichen Erzählung des letzten Tages von Jean in Paris, den er im Schwimmbad seines »Exils« herbeibeschwört. »Alles vermischte sich wie bei einer Doppelbelichtung« – die Erinnerung hat gesiegt; man kann ihr auf Dauer nicht entkommen. Zäsuren
In den sehr stark autobiographischen Romanen Familienstammbuch und Ein Stammbaum übernimmt Modiano die Rolle des Verlassenen selber. Aber auch als er die Kälte und Unfähigkeit seiner Eltern fast protokollarisch wie eine Art Zwang »herunterbetet« (Ein Stammbaum), verfällt er nicht in Larmoyanz oder gar einen selbstgerechten Anklageton. Seltener erzählt Modiano aus Sicht der Weggeher, ja: Flüchtlinge, wie Serge Alexandre in Außenbezirke und vor allem Jimmy Sarano alias Jean Moreno in Vorraum der Kindheit. Modiano nimmt niemals eine wertende oder gar moralische Position ein. Beiden Seiten – den »Flüchtlingen« wie den Verlassenen – ist gemein, dass sie die Erinnerung an das Gewesene löschen wollen. Man gibt sich neue Namen, wechselt den Ort und verlässt Bekannte und Freunde, nicht selten: Kinder – und führt ein »geheimes anderes Leben«, meist ohne Nachricht und ohne neue Adresse. So soll ein Leben in der Gegenwart entstehen, in der das Vergangene keinen Raum mehr hat. Man fühlt sich an ein Tagebuchnotat Peter Handkes erinnert, in dem zwischen einer Weltflucht vor einem Problem und der Mitnahme des Problems auf dieser »Flucht« differenziert wird. Modianos Figuren versuchen die Flucht vor dem Problem. Aber das ist unmöglich: »Was man vergessen wollte, kommt wieder« (Die Kleine Bijou). Irgendwann ereignet sich etwas, das die künstlich errichtete Welt zum Zusammenbrechen bringt. Eine neue Person, die Erinnerungen wachruft, ein Bild, eine Geste – ein Déjà-vu genügt. Sofort stürzen die aufgestauten Erinnerungsmassen auf den Protagonisten ein. Lange Zeit bewusst Verdrängtes strömt unaufhaltsam heran. Dabei soll die »Suche nach der verlorenen Zeit« die Vergangenheit nicht verklärend heraufbeschwören. Hier liegt der grundlegende Dissens zu Prousts monumentalem Romanprojekt, mit dem Modianos Romane gelegentlich voreilig verglichen werden. Obwohl er sich auf die Schriftsteller des 19. Jahrhunderts beruft, erläutert er in seiner Nobelpreisrede, warum das Zurückholen nicht mehr funktioniert: »Ich denke, dass die Erinnerung nach der verlorenen Zeit leider nicht mehr mit Marcel Prousts Kraft und Offenheit durchgeführt werden kann. Die Gesellschaft, die er beschreibt, ist die des 19. Jahrhunderts, also eine stabile Gesellschaft. Prousts Erinnerungen ließen die Vergangenheit in all ihren Einzelheiten wie ein lebendes Bild wieder erscheinen. Heute habe ich das Gefühl, dass die Erinnerungen immer weniger sicher sind und sich in einem ständigen Kampf gegen Gedächtnisverlust und Vergessen befinden.« Es gibt keine Idyllen, derer zu gedenken wäre. Stattdessen Kränkungen, gescheiterte Lebensentwürfe, Zäsuren. Schließlich leben Modianos Helden in gefährlichen, mindestens jedoch Umbruchzeiten: Besatzung, Nachkriegszeit, 60er Jahre-Proteste. Es gibt einschneidende Lebensabschnitte, die oft nur wenige Wochen oder Monate dauern. Hier stellen sich Weichen, werden Lebenspläne entworfen, entstehen Liebschaften , aber nahezu alles vergeht, verliert sich oder scheitert. Jahrzehnte später erst raffen sich die Figuren zu präzisen Rekonstruktionen des Geschehenen auf. Erst wenn man sich den Erinnerungen stellt, ihnen den entsprechenden Raum in seiner Biographie einräumt, sie als einen Teil des Lebens begreift, ohne sie zu verleugnen oder sich ihnen zu entziehen, erst dann befreit man sich von ihrer dämonischen Kraft.
Die Topographie von Paris Dies gilt erst recht für die Bücher, in denen sich Modiano mit der Okkupation der Nazis beschäftigt. Hier ist es entweder die Erinnerung der Nachgeborenen, die sich der Verdrängung und Abschottung der Kollaborateure als überlegen erweist. Oder die Erinnerung an die Opfer, die Ermordeten, denen durch die Erzählung das »ewige Leben« eingehaucht wird. Besonders zu Beginn seines Schreibens wählte Modiano auch eine an den magischen Realismus erinnernde Variante: Seine Figuren erinnerten sich an die Besatzungszeit, obwohl sie damals noch gar nicht geboren waren. So schreibt der Erzähler Modiano einmal in Familienstammbuch, dass er »ganz sicher [war], im besetzten Paris gelebt zu haben«. Aber auch in dieser Thematik verblüfft sein Erzählen durch größtmögliche Nüchternheit, die man aber nicht mit Empathielosigkeit verwechseln darf. Fast alle Romane Modianos könnte man auch als Ortserzählungen von und über Paris bezeichnen. Selbst wenn sich die Protagonisten inzwischen in andere Orte verzogen haben, erinnern sie sich an ihre Pariser Zeit, die prägend war. »Ich liebe sie, diese Stadt. Mein Mutterboden. Meine Hölle. Meine alte, allzu geschminkte Mätresse«, schwärmt der Erzähler schon in Abendgesellschaft. Dabei bekommt das Pariser Universitätsviertel zuweilen einen separaten Status als eine Art exterritoriales Gelände, ein leicht glorifiziertes »Königreich« (Eine Jugend), welches vom üblichen Überlebenskampf der Stadt unbehelligt bleibt. Nicht selten tummeln sich dort »Geisterstudenten«, die vor allem das intellektuelle Klima genießen; durchaus eine Selbsteinstufung Modianos, der zwar eingeschrieben war, aber nie eine Vorlesung besucht hat (Ein Stammbaum). Immer wenn Jean aus Gräser der Nacht mit anderen durch die Straßen flaniert, bekommen die topographischen Einzelheiten die gleiche Widmung wie die Personen. Straßenzüge und Stadtviertel werden mit Ereignissen und Menschenschicksalen identifiziert: »Es war eine Manie, alles kennen zu wollen, was im Laufe der Zeit und in aufeinanderfolgenden Schichten irgendeinen Ort von Paris ausgefüllt hat.« Die Veränderungen im Stadtbild werden akribisch vermerkt. Jede Straße in einer Stadt ist eine Art Speicher, »Begegnung, Kummer, ein Moment des Glücks« für all diejenigen, »die dort geboren wurden und lebten« und deren Geschichten nun drohten, dem Vergessen anheim zu fallen, so Modiano in seiner Nobelpreisrede 2014, in der er die Bedeutung der Topographie von Städten für die Dichter des 19. Jahrhunderts herausstellt: »Balzac und Paris, Dickens und London, Dostojewski und Sankt Petersburg, Tokio und Nagai Kafū, Stockholm und Hjalmar Söderberg«. Orte wie Paris sind für den Dichter wesenhaft; Gedächtnisspeicher, denen die »Erinnerung« entlockt werden muss, bevor das Vergessen (der Abriss eines Gebäudes, eines Stadtviertels) droht: »Damals war ich genauso empfänglich wie heute für Menschen und Dinge, die im Begriff sind zu verschwinden«, so Jean über sich reflektierend. In seinem jahrzehntealten Notizbuch entdeckt er schließlich freudig ein »Verzeichnis der Pariser Bänke entlang verschiedener Strecken«. Andere Motive Neben Paris spielen immer wieder Annecy, Lausanne und Wien (das Café Hawelka!) als andere Erzählorte (zumeist Rückzugsplätze) eine Rolle - wie auch die stets namenlos bleibenden mittelmeerischen, nordafrikanischen Städte. Die autobiographischen Konnotationen sind leicht zu rekonstruieren, wenngleich Elisabeth Edl in ihrem Nachwort zu Ein Stammbaum warnt, dass das »für Modiano so charakteristische Vexierspiel zwischen Fiktion und Biographie…nicht mit Hinweisen durchbrochen werden [darf], die auch der Autor selbst nicht gibt.« Was aber, wenn der Autor genau diese Lesart geradezu herausfordert und zuweilen literarische Verfremdungen bewusst vermeidet? Sich wiederholende Motive bleiben natürlich nicht aus. Da ist beispielsweise die fast magische Affinität zur Zahl 20, die so oft als Zäsurdatum oder einfach nur als Symbol für eine Generation besteht (und so auch die 40). Oder der Oktober: Einige wichtige Ereignisse seiner Protagonisten spielen in diesem Monat und in Gräser der Nacht heißt es einmal: »Ich glaube, das Jahr beginnt im Oktober«.
Etwas übersinnlich auch die Erinnerungspassagen in seinen Romanen, in denen er Zeitkorridore und regelrechte Parallelwelten evoziert: für winzige Momente erscheinen die Personen aus vergangenen Zeiten als gegenwärtig wie in einem Traum. Surreal auch, wenn sich eigentlich stillgelegte Telefonnummern als eine Art offene Leitung entpuppen, in denen Menschen miteinander kommunizieren. Es ist »Das Netz« (Die Kleine Bijou): »Die Nummer ist nicht mehr vergeben. So wird sie benutzt, Bekanntschaften anzuknüpfen und Rendez-vous zu vereinbaren.« In Gräser der Nacht wird der Faden weiter gesponnen. Die Nummern, unter denen so eine Art von Funksprechverkehr möglich ist, »waren nur ein paar Eingeweihten bekannt, die sich ihrer bedienten, um im geheimen miteinander zu verkehren.« In den späten Romanen erscheint immer wieder das Motiv des Hundes als Sehnsuchtsobjekt (meistens von Kindern). In Ein Stammbaum verwendet Modiano die Hund-Metapher sogar auf sich selbst: »Ich bin ein Hund, der so tut, als habe er einen Stammbaum«. Der Umgang des Menschen mit einem Hund wird zu einem Kriterium für dessen Menschenfreundlichkeit. Eltern, die ihren Kindern Hunde verwehren oder diese gar »verlieren«, sind hartherzig, kalt und empathielos. Man sollte sich durch den schmalen Umfang der Romane nicht der Täuschung hingeben, dass es sich um leichte Lektüre handelt. Wenn man sich jedoch auf den Modiano'schen Kosmos einlässt, ist es auch ohne Stadtplan von Paris und trotz so manch erahnbarer übersetzerischen Klippe möglich, für kurze Augenblicke verzaubert zu werden. Und Paris kann ja überall sein.
Die
Übersetzungen aus der Nobelpreisrede wurden von mir, LS, nach der englischen
Version vorgenommen. |
||
|
|
||