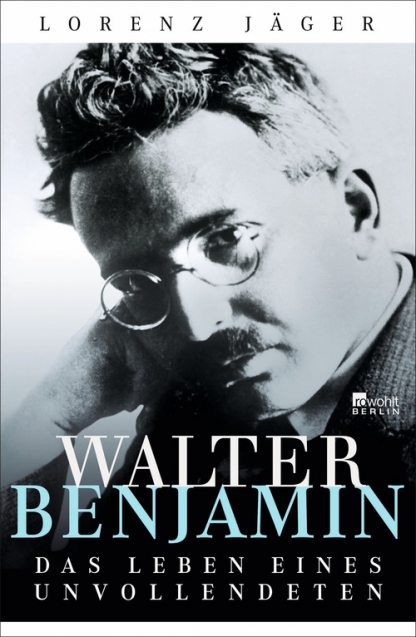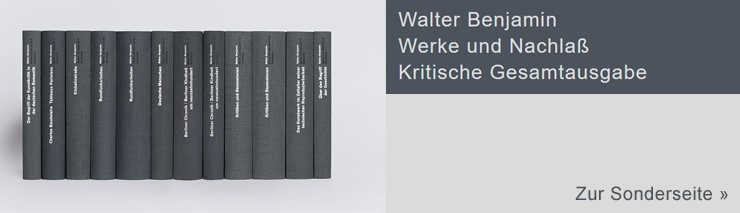 |
||
|
|
||
|
Glanz&Elend Walter Benjamin - Leben & Werk |
||
|
Home Termine Literatur Krimi Biografien, Briefe & Tagebücher Philosophie Impressum & Datenschutz |
||
|
Auf den Spuren Walter Benjamins
I Der
Gedenkstein im spanischen Portbou ist von Kieselsteinen umsäumt, einige von
ihnen sind – einer alten jüdischen Tradition folgend – an der Oberkante des
Steins und dem dahinter liegenden Felsbrocken zu kleinen Haufen aufgetürmt.
Unter der Gravur mit dem Namen »Walter Benjamin« findet sich ein Zitat aus der
siebten These über den Begriff der Geschichte. Zwei Fehler haben sich in
den Satz eingeschlichen. Dass ausgerechnet das Wort »Barbarei« falsch
geschrieben wurde, gibt dem Andenken einen bitteren Beigeschmack. Eine spanische
Übersetzung schließt die Erinnerung an den Schriftsteller und Philosophen Walter
Benjamin ab. In Portbou nahm er sich, 48 Jahre alt, auf der Flucht vor den Nazis
am 26. September 1940 das Leben. Für
die 12 Kilometer Fußweg von Banyuls-sur-Mer in Frankreich nach Portbou über die
Pyrenäen gibt Google Maps knapp drei Stunden an. Heute gibt es dort einen
Walter-Benjamin-Pfad, den man beschreiten kann und der den Wanderer vergessen
lässt, dass der herzkranke Kritiker sich diesen Weg mit seinen Gefährten zu
großen Teilen durch Gestrüpp und Geröll allererst erarbeiten musste. Wer
von Banyuls-sur-Mer mit dem Auto die Küste entlang über die Berge fährt,
passiert nach etwa einer halben Stunde die französisch-spanische Grenze auf
einem Hochplateau mit niedergerissenen Schlagbäumen und einem heruntergekommenen
Grenzhäuschen voller Graffiti, ein recht trostloser Anblick. Was dann folgt,
gleicht einer Zeitreise in die Vergangenheit. In Spanien werden die Straßen
schmaler, steiler, kurvenreicher, wilder. In der Hoffnung, dass nun kein Auto
mehr aus entgegengesetzter Richtung kommt, erreicht man nach ein paar Minuten
Portbou und ist erstaunt, wie unaufgeregt es hier zugeht. In dieses gewiss nicht
ganz leicht zu erreichende Örtchen verlieren sich nicht allzu viele Touristen.
In
der Bucht lädt ein größeres Café zum Verweilen ein. Die mobile Imbissbude am
Strand versorgt eine Handvoll Menschen mit Snacks. Nichts gleicht hier den
beinahe schon mondän anmutenden Badeorten, die nur wenige Kilometer entfernt an
der französischen Küste Menschen aus ganz Europa anlocken. Die
Gedenkstätte für Benjamin muss man suchen. Die Hinweisschilder sind so winzig
wie seine Handschrift. Von einem Schotterparkplatz aus geht es zur Steilküste
hinauf. Hier oben herrscht beinahe gespenstische Stille. Eine leichte Brise, ein
paar Vögel, das Meer, vom Passagen-Denkmal aus betrachtet, die Frühjahrssonne am
Ende einer Welt, die sonst nirgends so friedlich scheint. Unter
dem Namen »Benjamin Walter« ist er zunächst katholisch begraben worden, ehe man
sich bewusst wurde, wer der Tote tatsächlich ist. Über den kleinen jüdischen
Friedhof gehend erreicht man heute, in einer unscheinbaren Ecke gelegen, den
schmucklosen Gedenkstein. Ich bin ganz allein hier oben. Die wohltuende Stille
und der traumhafte Blick über das Meer sind unbeschreiblich. Man kann gar nicht
anders als unmittelbar das Zwiegespräch mit Walter Benjamin zu suchen.
II
Lorenz Jäger führt ein solches Zwiegespräch mit Benjamin seit über zwei
Jahrzehnten. Ohne Zweifel gehört er zu den ausgewiesenen Benjamin-Experten in
Deutschland. Die Summe seiner Auseinandersetzungen hat er nun in eine Biografie
einfließen lassen, die den »Unvollendeten« wohlwollend neutral charakterisiert.
Auf eine Kontroverse wie damals bei seinem Adorno-Portrait hat es Jäger nicht
angelegt. Überhaupt fragt man sich, für wen er Benjamins Leben nachgezeichnet
hat. Im Grunde ist doch alles bereits gesagt, die Details, soweit möglich,
weitestgehend aufgearbeitet und bekannt. Jäger kommt auch ganz ohne
Archivmaterial aus, lässt man die Fotografien außer Acht. Doch selbst die zeigen
meist Bekanntes. Das fängt bei Charlotte Joël-Heinzelmanns Cover-Fotografie an
und hört bei den Schachaufnahmen von Brecht und Benjamin auf. Jägers Portrait
schöpft aus Benjamins Schriften, Briefen und einigen Sekundärquellen. Genutzt
hat Jäger die Gesammelten Schriften, nicht jedoch die noch nicht vollständig
abgeschlossene, kommentierte Kritische Gesamtausgabe. Mit Ausnahme der älteren
(nicht ganz fehlerfreien, aber wegweisenden) Biografie von Bernd Witte finden
sich in der Literatur die einschlägigen Hinweise: Brodersen, Friedländer, Heye,
Kramer, Lindner, die zweibändige Ausgabe zu Benjamins Begriffen von Opitz und
Wizisla, ebenso Wizislas »Begenungen«, selbstredend Palmiers Standardwerk, zudem
Steiner und Weigel. Doch
der Hinweis auf den »Unvollendeten« reicht kaum aus, um einen neuen Aspekt in
den Benjamin-Diskurs einzubringen. Zumal auch diese Umschreibung ja lediglich
seinem Kafka-Aufsatz entliehen ist. Dort sind es die »Unfertigen« und
»Ungeschickten«, die Benjamin als dritten Gestaltenkreis bei Kafka entdeckt. Es
sind die Narren und Bauernfänger, die kauzigen Kreaturen, die sich aus der
Schusslinie stehlen, wenn die beiden anderen Gestaltenkreise ihre Kämpfe
austragen. Da ist zum einen die Welt der Väter, der Beamten, der durchgenormten
Abläufe, der Ordnung und der unnachgiebigen Gerichtsbarkeit. Dem steht die Welt
der Söhne gegenüber, die unverschuldet dieser Gerichtsbarkeit zum Opfer fallen,
nichts ahnend, ungläubig, verzweifelt. Für die Unfertigen und Ungeschickten gibt
es Hoffnung, alle anderen müssen sich dem Schicksal fügen.
Insbesondere der Protagonist K. aus dem »Prozess« leidet darunter. Benjamin
macht diesbezüglich auf Kafkas Erzähltechnik aufmerksam: Immer dann, wenn andere
Romanfiguren dem K. etwas Wichtiges oder Überraschendes mitteilten, so täten sie
dies auf beiläufige Art und Weise, gerade so, als müsse er das doch schon längst
gewusst haben. Jägers Erzähltechnik verhält sich genau umgekehrt. Er erzählt
Bekanntes so, als hörten wir davon zum ersten Mal. Lässt
sich sein Portrait so deuten, dass Benjamin, der »Unvollendete«, zum
Gestaltenkreis der Unfertigen und Ungeschickten zählt? Tatsächlich dürfte dies
kaum zutreffen. Denn Benjamin vermochte es zeitlebens nicht, sich wie Kafkas
neutraler Gestaltenkreis aus der Kampflinie zu nehmen. Bis zuletzt stand er
zwischen allen Fronten. Mehr als den »Unfertigen« hat er sich Kafkas Romanfigur
K. verbunden gefühlt. Seine Schriften waren die Offerte an diese Figur, sich
selbst ein eigenes, ein anderes Schicksal zu geben.
III
Sein
letzter Text, an dem er arbeitete, ehe er in Portbou starb, trägt den Titel
Über den Begriff der Geschichte. Es ist eine in loser Abfolge von Thesen
formulierte Arbeit, in die sein gesamtes Geschichtsverständnis kulminiert. Dort
präsentiert er die Theologie als den Zwerg an der Seite des Historischen
Materialismus. Dieser Zwerg, dessen Tod im 19. Jahrhundert bereits proklamiert
worden war, und den Benjamin nun revitalisiert, bildet den Garant für einen
wirklichen Umsturz der herrschenden Verhältnisse. Denn die Geschichte könne
nicht atheologisch begriffen werden.
Schon die
1928 erschienene »Einbahnstraße« führt die Bemerkung mit sich, alle
entscheidenden Schläge müssten mit der linken Hand, d. i. marxistisch, geführt
werden. Nun, in den Thesen, stellt Benjamin seiner Maxime, die Geschichte gegen
den Strich bürsten zu wollen, die jüdische Mystik beiseite, die letzten Endes
die Last der Legitimation trägt. Vorbereitet hat er diese theoretische Grundlage
schon in dem von Adorno so genannten »theologisch-politischen Fragment« der
frühen 1920er Jahre. Dort heißt es, erst der Messias vollende alles historische
Geschehen wie er zudem die Beziehung des historischen Geschehens zur Erlösung
selbst initiiere. Die Geschichte, so Benjamin gegen den universalhistorischen
Anspruch, sei keineswegs in der Lage, sich auf den Messias zu beziehen, weil sie
endlich und Teil der Naturgeschichte des Menschen sei. Eine Beziehung kann
allein der Messias stiften. Erlösung und Vollendung innerhalb der Geschichte
sind aus diesem Grunde zu denken unmöglich. Somit fällt auch die paulinische
Erwartung auf die Ankunft des Messias weg und das Reich Gottes ist nicht länger
Telos historischer Dynamik, bricht doch der Messias die Geschichte ab.
Benjamin
geht es in dem zweiseitigen Fragment vor der Folie der Marx´schen Philosophie in
erster Linie um die Mobilmachung des Glaubens in einer zusehends profanen Welt:
»Mein Denken«, schreibt er, »verhält sich zur Theologie wie das Löschblatt zur
Tinte. Es ist ganz von ihr vollgesogen. Ginge es aber nach dem Löschblatt, so
würde nichts, was geschrieben ist, übrig bleiben.«
Das Bild
einer homogen verlaufenden Entwicklung sowie die Idee einer geschichtsimmanenten
Vernunft werden von Benjamin gleichfalls dekonstruiert. Die Geschichte, so
Benjamin, als in einem Brennpunkt gesammelt, ruht in der Gegenwart als eines
latent vollkommenen Zustands. Die weit aufgerissenen Augen des Engels der
Geschichte, den er in der neunten These skizziert, bilden hierbei das
Oneiroskop, dessen Brennweite insbesondere auf das 19. Jahrhundert eingestellt
ist. Die unbewältigte Vergangenheit prägt die unmittelbare Gegenwart. Sie birgt
den Sprengstoff, der zur Entzündung gebracht werden will, soll nicht nur der
Dämmerzustand vorangegangener Generationen beendet, sondern auch die Gegenwart
verändert werden. Die Jetzt-Zeit, so nennt sie Benjamin in seinen Thesen, ist
die Schwelle, auf der wir innehalten müssen, um nichts verloren zu geben, um die
Namenlosen nicht zu vergessen, das Unsagbare auszusprechen, das Anonyme: »Die
kopernikanische Wendung in der geschichtlichen Anschauung ist diese: man hielt
für den fixen Punkt das Gewesene und sah die Gegenwart bemüht, an dieses
Feste die Erkenntnis tastend heranzuführen. Nun soll dieses Verhältnis umkehren
und das Gewesene zum dialektischen Umschlag, zum Einfall des erwachten
Bewusstseins werden. Die Politik erhält den Primat über die Geschichte. Die
Fakten werden etwas, was uns soeben erst zustieß, sie festzustellen ist Sache
der Erinnerung. Und in der Tat ist Erwachen der exemplarische Fall des
Erinnerns: der Fall, in welchem es uns glückt, des Nächsten, Banalsten,
Naheliegendsten uns zu erinnern.«
IV
Müsste
eine Biografie über Benjamin nicht mit dieser Idee des Erwachens spielen und die
Geschichte in die Gegenwart einfallen lassen, um sich des Naheliegendsten zu
erinnern? Müsste man nicht, wie Jäger das 1992 gemäß den Worten Hugo von
Hofmannsthal bereits getan hat, lesen, »was nie geschrieben wurde«?
Ohne
Frage: Jäger hat Benjamin sehr genau gelesen, beinahe schon zu genau; er
versteht es, sich souverän zu seinen Schriften zu äußern, rekapituliert den
Lebensweg des Denkers detailliert; alles in allem eine überaus solide Arbeit.
Allein, es fehlt der Biografie das Besondere, das sie von den ungezählten
anderen Benjamin-Büchern abheben könnte. Zwar führt sie vieles zusammen,
präsentiert aber lediglich bereits bekannte Aspekte. Benjamins eigener Anspruch
ist das nicht.
Die 18
Kapitel orientieren sich an der Lebenschronologie und lassen in diese die
einzelnen Arbeiten Benjamins einfließen. Von der Berliner Herkunft über die
Jugendbewegung folgen wir Benjamin in die Schweiz, nach Paris bis hin nach
Portbou. Äußerst gelungen ist die Beziehung Benjamins zu F.C. Rang, zu dem Jäger
bereits zuvor gearbeitet hat. Auch die Exkurse in Benjamins Werk machen dieses
verständlich und lassen die Kontexte noch einmal deutlich hervortreten.
Doch für
wen ist das geschrieben? Für Benjamin-Kenner eher nicht. Für
Benjamin-Interessierte vielleicht? Aber gibt es die neben den Kennern? Am
ehesten wird das Buch einer Einführung gerecht. Doch im Klappentext heißt es:
»Eine hochspannende Biographie, die das Werk dieses großen Denkers neu
erschließt.« Freilich ist das nicht der Anspruch des Buches, denn in diesem geht
es doch vorrangig um das Leben eines »Unvollendeten.« |
|
|
|
|
||