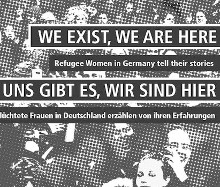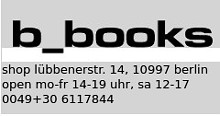Waehrend meines Thailandtrips machte ich mich mit meinen Freunden natuerlich auch auf zum Had Rin. Das ist der Ort, wo es die beruehmten Vollmondpartys gibt. Wir kamen um 22 Uhr dort an und der Strand war schon total voll. Als wir so ueber den Strand schlenderten trafen wir zwei polnische Maedchen – es war das einzige Mal, dass ich Polnisch hoerte in meinen drei Wochen in Thailand. Die Maedels tranken polnischen Wodka aus der Flasche, die sie selbst mitgebracht hatten. Sie hatten naemlich Angst davor, Drogen in ihre Cocktails gemischt zu bekommen. Na ja, ich glaub nicht, dass an diesem Strand irgendjemand etwas for free
herausgerueckt hat.
Der Strand jedenfalls war voll von Touris, die Unmengen von Alkohol in sich hineinschuetteten, kifften, ins Meer kotzten, in Ohnmacht fielen und dann leblos im Sand lagen. Ausserdem trieben sich dort noch thailaendische Polizisten rum, die wohl ein bisschen angenervt waren von den vielen Partybesuchern, die bereits total hinueber waren. Deshalb haben sie uns wohl insgesamt drei Mal durchsucht und uns jedes Mal Viel Spass weiterhin!
gewuenscht. Gegen drei Uhr habe ich meine Freunde aus den Augen verloren – gerade hatte ich sie noch mit einer Gruppe von Thai-Lady-Boys
schaekern sehen. So ganz allein und ohne Geld fuehlte ich mich ziemlich verwundbar.
Mehrere Male klatschten Besoffene auf meinen Po. Meine wuetenden Schreie der Entruestung verstanden sie dann auch noch als Einladung. Irgendwann war mir dann alles egal. Ich verbrachte ungefaehr eine Stunde damit, meine Freunde zu suchen ohne auch nur eine Person anzulaecheln. Dann kam mir der Gedanke, wie ich es zurueck ins Hotel schaffen wuerde, ohne auch nur einen Pfennig Geld dabei zu haben. Ich bekam richtig Schiss. Schliesslich haben wir uns dann doch noch wieder gefunden. Die anderen waren auch schon ziemlich fertig. Gegen fuenf Uhr entschlossen wir uns dann, dieses Schlachtfeld mit all den leblosen Koerpern zu verlassen.
Gestern musste ich im Muell wuehlen. Nicht direkt im Muell, aber immerhin im Staubsaugerbeutel meines Techtelmechtels. Dass sich unsere Art von Beziehung auch einmal auf diese Ebene erstrecken wuerde, war mir anfangs nicht bewusst. Aber seitdem zwei meiner Ohrringe, die ich nachlaessigerweise auf dem Kaffeetisch liegengelassen hatte, beim nachmittaeglichen Aufraeumen einfach weggesaugt wurden, musste sich das Ganze zwangslaeufig verlagern. Manchmal kommt man gegen eine intimere Gangart einfach nicht an.
Also sass ich nun gestern im Flur, vor mir auf altem Zeitungspapier das Opfer, ein prall gefuellter Staubsaugerbeutel. Ein Schnitt mit der scharfen Spitze der Schere – schon quollen geschaetzte sechs Monate haeuslichen Schaffens meines Techtelmechtels hervor. Neben den erwarteten Staubflusen fand ich ein Wattestaebchen, gefuehlte zweitausend Zigarettenfilter, zwei Naehnadeln, ein 1-Cent-Stueck sowie ein Feuerzeug (wie das in den Staubsaugerbeutel gekommen sein soll ich will es nicht wissen). Welches Bild ergab sich fuer mich aus diesem Durcheinander?
Ich habe es mit einem leicht chaotischen Suchtmenschen zu tun (Zigarettenfilter en masse), der bei allen Abhaengigkeiten doch Wert auf Sauberkeit legt (das Wattestaebchen fuer die Ohren) und immer fuer eine Ueberraschung gut scheint (das Feuerzeug). Von meinen Ohrringen natuerlich keine Spur (zaubern kann mein Techtelmechtel folglich auch). Gluecklicherweise war ja neulich gerade Ostern. Ich bin das Suchen also gewohnt, das Nicht-Finden leider nicht.
Mein Arbeitsbereich ist die Uni. Beschleunigungsmoeglichkeiten – und damit einhergehend Beschleunigungszwaenge – zeigen sich dort gegenwaertig durch technische Entwicklungen (Internet, Computer, Vervielfaeltigungstechniken), durch institutionelle Oeffnungen (akademischer Disziplinen, Arbeitsmaerkte, Kommunikationskanaele) und durch den starken Druck zu Wirtschaftlichkeit und globaler Wettbewerbsfaehigkeit des Unibetriebes. Diese Beschleunigungszwaenge fuehren in den Arbeitszusammenhaengen, in denen ich mich bewege zu einem Herumexperimentieren mit Moeglichkeiten des Zeitsparens hinsichtlich der Textaneignung, der Textproduktion, der Seminarvorbereitung und – durchfuehrung, der Beschaeftigungszeit pro Studierendem ohne dabei die Qualitaet der Ergebnisse zu vermindern. weiterlesen »

Wild Campen in Berlin? Berliner Gazette-Autorin Anne Grieger hat eine Frau entdeckt, die das dauerhaft betreibt. Und fragt sich, warum. weiterlesen »
Seit einiger Zeit ist Mobilitaet
das Schlagwort einer Gesellschaft, die sich dem permanenten Druck der Globalisierung stellen will. Mobil muessen alle werden, die nicht als Globalisierungsverlierer enden wollen. Mobilisiert werden restlos alle Ressourcen, damit unsere Gesellschaft nicht in die Globalisierungsfalle tappt. Doch was steckt hinter diesen selbstverstaendlich gewordenen Appellen? Tom Holert und Mark Terkessidis haben beschlossen der Frage nachzugehen. Konkret: Sie haben die Mobilitaetsantipoden Tourismus und Migration gegenuebergestellt.

Foto: Tom Holert/Mark Terkessidis
Auf Reisen, bei ausgedehnten Recherchen in Bibliotheken und waehrend Interviews sowie Gespraeche ist ihr gemeinsames zweites Buch >Fliehkraft< entstanden. Es denkt Tourismus und Migration zusammen als zwei Seiten ein und derselben Mobilitaetsmedaille. Interessant an der bisherigen Rezeption ist: Vor allem in der Migrationsdebatte ist das Buch hellhoerig aufgenommen worden. Sturm auf die Festung Europa? Fliehkraft zeigt, dass die afrikanische Bedrohung eine hausgemachte ist.
Und legt ferner die intrikaten Manoever des Grenzschliess- muskels offen, der immer nur unter der Hand offen ist und dann auch nur, wenn Arbeitskraefte gebraucht werden. Was das Ganze mit Tourismus zu tun hat, scheint niemanden wirklich zu interessieren. Damit wird die zentrale These des Buches belegt: In unserer Gesellschaf gelten beide Seiten der Mobilitaetsmedaille als unvereinbare Gegensaetze. Vielleicht bestaetigen die meisten Journalisten auf ihre Art einfach nur, wie sich Mobilitaet als eine so wirksame Ideologie erhalten konnte. Niemand will ihre jeweilge Kehrseite sehen.
Stell dir vor es ist Montagmorgen und du bist, ganz unboheme, auf dem Weg zur Arbeit. Und dass nachdem du am Freitag so besoffen warst, wie seit dem Abi nicht mehr (als du dir so hemmungslos die Kante geben musstest, nicht etwa wegen deines berauschenden Abis, sondern um nicht vollends vom Anblick deines schmerbaeuchigen Physiklehrers traumatisiert zu werden, dessen Blick nur noch zu hauchen vermochte: no future!) Und dieser Grad an Betrunkenheit (verursacht durch ein Giftgemisch namens Mad Dog = Wodka, Himbeersirup und Tabasco) hat dich auch erst an jenem fruehlingshaften Morgen wieder vom Zombie zum Menschen werden lassen. Stell dir das also vor. Was kannst du tun, um noch ein paar Sekunden dieses Gefuehls des Berauschtseins in die Tretmuehlenwoche zu retten? Klar, waehrend der Fahrt den MP3-Player anschmeissen (wahlweise auch iPod wenn du nichts anderes hast). Und solltest du genau in diesem Augenblick in dem Dilemma stecken: ja aber welche Mucke soll ich denn da anmachen? – dann habe ich den passenden Soundtrack parat: The Klaxons mit ihrem Album Myths of the Near Future
. Ich weiss, ich weiss, die sind auch schon wieder nicht mehr der allerneueste
heisse Scheiss aus UK, sondern vielleicht gerade mal noch der neueste
. Wie auch immer, in einer bestimmten Situation
gibt es nichts Besseres. Es wirkt!
Medien-Kunst? Fast natuerlich erscheint es, dass sie sich in einem Dilemma befindet, ueberblendet vom Dauerrausch[en] der omnipraesenten Medialisierung der Welten. Das aesthetische und inhaltliche Provozieren und damit Evozieren von Kontroversen, Bestimmen von Diskursen faellt ihr immer schwerer, draengen die kommerziellen Medien doch jede Rezipienten-Reizschwelle staendig weiter (vom Ertraeglichen). Die wahre Provokation scheint heute in der Reduktion zu liegen, dem Mut zum still, zur Dauerschleife mit langer Weile. Doch auch hier wirkt das Feld dekliniert: Haben nicht Ikonen wie Bruce Nauman die Geduld des Zusehers schon vollstaendig und im positivsten Sinne ausgereizt?

Bild: Norbert Bayer
Vielleicht kann eine Zukunft medialer Kunst im Neubesinnen auf Inhalte liegen, auf eine Intermedialitaet, die herkoemmlichen, bescheideneren Medien, wie zum Beispiel Text, neue Dialog-Mittel eroeffnet. Einem neuen Medien-Kunst-Projekt staende der Versuch gut zu Gesicht McLuhan widerlegen zu wollen, das Vordergruendige, die Oberflaeche, das selbstreferentielle Auto-Erzaehlen abzustreifen und die Kanaele wieder staerker fuer die eigentlichen Botschaften zu oeffnen. Eine solche Verfeinerung und Selbstbeschraenkung haette, meiner Meinung nach, die Konsequenz, dass Medien als Medien wieder Reiz-voller, durch ihr Zuruecktreten mittelbarer werden und damit wieder wesentlicher auf sich verweisen. Der teilweise kunstvolle Verzicht der Medien auf sich selbst waere noch einmal eine neue Provokation
Medienkunst ist das Produkt eines Vermittlungszusammen- hangs. Die Legitimation ihres Diskurses wird aus der Problematik der technischen Medien selbst abgeleitet. Sie ist das Produkt einer institutionellen und administrativen Bedarfsituation bei der Einfuehrung neuer Technologien: (Modernisierungsdruck, Folgen fuer die Gesellschaft, Adaption des Kulturbetriebs.) Medienkunst hat die Funktion, den Prozess der Kulturalisierung durch die Medien zu regulieren, gleichzeitig technisch-oekonomisch zu beschleunigen und inhaltlich zu verlangsamen oder zumindest zu kanalisieren.

Bild: Norbert Bayer
Es geht also um Repraesentation und den Machtanspruch traditioneller Kulturinstitutionen bei der Konstruktion von Relevanz und Wissen bestehende Strukturen zu unterstuetzen. Medienkunst ist also das Produkt eines Strukturkonservatisismus. Medienkunst verbindet oft nicht konkurrenzfaehige Ideen und Methoden mit einem unhinterfragbaren technolgischen Determinismus. Es ist ein nachweisbarer Attraktor fuer schlechte Kunst – siehe dazu etwa die transmediale-Ausstellungen ueber mehrere Jahre hinweg, mit durchweg im weiteren Kunstbetrieb weitgehend irrelevanter Auswahl aber doch vielen Bezuegen zum etablierten Galeriekunstbetrieb. Medienkunst ist das Produkt eines Interfacephaenomens zwischen einer technischen Avantgarde und einer nachfolgenden technischen Massenkultur.
Wurde das jeweilige Medium eingefuehrt, gibt es keinen utopischen, dystopischen oder spekulativen Mehrwert zu vermitteln und der jeweilige Medienkunst-Subdiskurs verschwindet (free wireless, piracy, net.art, cd-roms, digitaler Videoschnitt). Ebenso wie Medienkunst gibt es Medientheorie, und Medienjournalismus mit kurzer Halbwertszeit. Wurde der Vermittlungsauftrag erfuellt, loest sich der Legitimationsanspruch auf und es wird auf das naechste kommende Medium verwiesen. Medienkunst soweit sie institutionell organisiert ist, operiert opportunistisch und dennoch medienkritisch. Kritik ist das Feigenblatt ihrer institutitonellen Legitimation. Das Thema der Institutionskritik, und weitere Methoden der 1990er kamen bisher nur Bruchstueckhaft an. Net.art z.B. war davon inspiriert.
Der Sand ist hell. Fast weiss. Er gibt angenehm nach unter den Fuessen. Langsam schmiegt sich kuehles, klares Meereswasser an ihn. Je weiter sich das Meer erstreckt – meereinwaerts sozusagen – desto blauer wird es. Obwohl blau
nicht den richtigen Klang hat, um diese Farbe zu beschreiben. Nein, das hier ist azur
(mit einem schoen gelispelten Z und einem gerollten R). Es ist Maerz und die Putzkolonnen haben die Straende Kroatiens noch nicht von dem Muell befreit, den der Winterwind, die Bura, angeweht hat. Fein saeuberlich aufgereiht liegen am Strand mit dem klarsten Wasser und dem weissesten Sand alte Bierkaesten, vereinzelte Badelatschen, Wasserflaschen, Badehosen, kaputte Kinderschuhe, benutzte Kondome und Vieles mehr. Die Muellstuecke glaenzen unter der Sonne in wahnsinnigen Farben. Waehrend sich an anderen Straenden Treibholz ansammelt, findet man hier Treibmuell
. Er erzaehlt die Strandgeschichten des letzten Sommers. Hier haben Menschen gefeiert, getrunken, sich mit Sonnenoel eingecremt, versteckt am Waldrand Out-Door-Sex gehabt. Familien haben beim eiligen Aufraeumen einzelne Kinderschuhe liegenlassen. Bald werden die ganzen Muellstuecke aufgesammelt, der Strand gesaeubert fuer neue Besucher, fuer neue Geschichten.









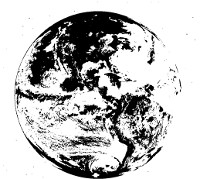





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN