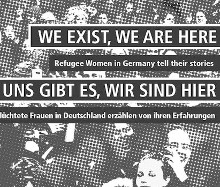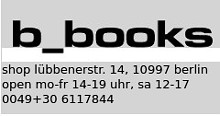Auf Reisen in Thailand triffst du ziemlich viele Leute. Es kann etwa passieren, dass du den gleichen Leuten, mit Lonely Planet-Guide und Sonnenbrille ausgeruestet, an verschiedenen Orten immer wieder begegnest. Abgesehen davon solltest du dich darauf einstellen, viele Australier zu treffen. Fuer die ist Thailand quasi so was wie Mallorca fuer die Deutschen – also zumindest entfernungstechnisch. Dann gibt es noch viele amerikanische Paerchen und alleinreisende College-Girls. Und Unmengen von Schweden (ich habe keine Ahnung warum). Die Briten kommen wahrscheinlich nach Thailand wegen ihres imperialistischen Gemuets, weil die Thais auch auf der linken Seite fahren und weil Alkohol so unglaublich guenstig ist (obwohl der letzte Punkt wahrscheinlich auf alle Touristen zutrifft).
Dann waeren da noch Schweizer. Sie reisen einfach gern durch ganz Asien mit der transsibirischen Eisenbahn – Endstation Thailand. Ein paar Deutsche gibt es noch, Franzosen und Russen mit vielen Klunkern aber keine Polen – bis auf mich, versteht sich. Unter den Amerikanern traf ich eine Alleinreisende
, wie sie ihren Status selbst beschrieb. Sie hiess Cathleen, wollte aber Cat genannt werden. Cat brachte es fertig, mir ihre Lebensgeschichte in nur 15 Minuten zu erzaehlen, ohne auch nur meinen Namen zu kennen. Ihr Freund, ein grossartiger schottischer Gentleman, hatte ihr eine Woche zuvor einen Antrag gemacht.
Und er ist so niedlich
, meinte sie, wie alle europaeischen Maenner, irgendwie anders und suess und und und
. Aber sie wusste einfach nicht, ob sie Ja sagen sollte. Klar der Typ war suess und alles, aber war sie wirklich schon bereit sich zu binden? Deshalb hatte sie sich sicherheitshalber erstmal in die Maschine nach Thailand gesetzt, um zu sich selbst zu finden
. Das Rueckflugticket war offen, vielleicht wollte sie ja laenger bleiben. Ausserdem offenbarte sie mir noch, dass sie eine Protein-Diaet und Yoga machte und erst 27 Jahre alt war. Sie beendete unsere Unterhaltung
ziemlich abrupt, als mein englischer Freund zu uns stiess, ein gutaussehender Europaeer…








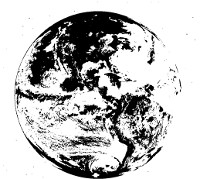





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN