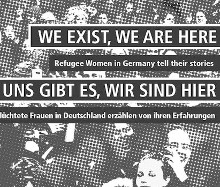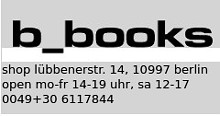Ich wohne in einer Vorstadt von Melbourne, etwa 15 km von der Stadtmitte entfernt in einem einstoeckigen Einfamilienhaus mit meiner Frau Irene. Unsere 25-jaehrige Tochter Joanna wohnt seit Beginn des Jahres nicht mehr zu Hause, verbringt aber noch viel Zeit bei uns. Wir haben sie zweisprachig erzogen. Ich spreche seit ihrer Geburt immer auf Deutsch mit ihr, meine Frau, die kein Deutsch spricht, aber durch die Immersionserfahrung zu Hause vieles verstehen kann, dagegen immer auf Englisch. weiterlesen »
- An/Greifbar: Warum BerlinerInnen gegen die digitale Kolonialisierung ihrer St…
- Hacking Women: Ein Blick über den Tellerrand der männlich dominierten Compu…
- Abschaffung der Arbeit? Künstliche Intelligenz, Kapitalismus und Transhumani…
- SILENT WORKS: Berliner Gazette Jahresprojekt zu verborgener Arbeit im KI-getr…
- Gemeinsam machen: Wie die feministischen Prinzipien des Internets entstanden …
- In der Schneekugel: Wie Literatur virtuelle Räume erinnern, erschaffen und n…
- Klimawandel und Selbstkritik: "Wir gedeihen, uneingeladen, wo wir nie wachsen…
- Bild des Monats: Warum wir im Jahr 2020 noch viel mehr Gretas brauchen werden…
- Am Ground Zero des Klimawandels: Green Grabbing, Massenmigration und die Roll…
- Jenseits des Menschengemachten: Indigene Kosmologien als Roadmap für die Kli…
-
Die unsichtbarste Minderheit
-
Die Reisen des grossen L
Jeder kennt sie und hat sie bestimmt auch schon einmal benutzt: die gelben Buecher mit dem blauen L. Doch kaum jemand kennt den Urheber dieser nuetzlichen Werke, die es moeglich machen, sich in einer erlernten Sprache so gut wie ungebremst zu verstaendigen. Genau diese Ungebremstheit, die uns heute zuteil werden kann, suchte der spaetere Erfinder der nach ihm benannten Woerterbuecher in seinem Alltag vergeblich. Zeit seines Lebens reiste Gustav Langenscheidt durch Europa und lernte die verschiedenen Kulturen, deren Traditionen sowie unterschiedlichen Sprachen kennen.
Er erkannte bald, dass es ein wahrhaft peinliches Gefuehl sei, unter Menschen nicht Mensch sein und seine Gedanken austauschen zu koennen. Doch trotz dieser Einsicht setzte er seine Fussreise durch das alte Europa fort. Er ging ohne Furcht in die grossen Metropolen wie Bruessel, London, Paris, Mailand, Venedig, Wien, Muenchen und sogar Breslau. Langenscheidt lernte auf seinem Weg gute und schlechte Menschen kennen und beschloss letztendlich aus Heimweh und finanziellen Gruenden nach Berlin zurueckzukehren.
Daheim kam er zu dem Schluss, dass es zwar nichts Schoeneres auf der Welt gibt als sich fortzubewegen. Langenscheidts Buecher sind also nicht nur eine Hilfe fuer Reisende sondern auch eine staendige Reiseempfehlung. Wer mehr ueber den Reisebegeisterten erfahren moechte, sollte sich sein Reisetagebuch als Hoerbuch zulegen, das gerade bei Langenscheidt erschienen ist. Eine sehr interessante Geschichte, die nicht nur zum Mitreisen einlaedt sondern auch zum selbstaendigen Weiterreisen auffordert.
-
Koenig der Sprachforscher
Sein Gebiet ist die Mehrsprachigkeit, sein Name lautet Michael Clyne. Sein Geburtsort ist Melbourne, wo es heute die groesste urbane Konzentration deutschsprachiger Einwanderer in Australien gibt – er selbst ist Kind deutschsprachiger Eltern, die sich in den Wirren des Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat in Europa nach Australien fluechteten. Sein Studium absolvierte Clyne an der University of Melbourne, an der er, nach langjaehriger Taetigkeit an der Monash University, im Jahr 2001 eine Professur fuer Linguistik erhielt. Mehrfach ausgezeichnet und international bekannt ist er fuer Forschungsarbeiten ueber die sprachliche Assimilation deutschsprachiger Einwanderer nach dem Zweiten Weltkrieg in Australien sowie fuer die weltweit erste Studie, die zu den Sprachen der Gastarbeiter in Deutschland angefertigt wurde. Seit 2004 ist er offiziell im Ruhestand, hat allerdings noch ein Arbeitszimmer mit einer schoenen Aussicht ueber die Stadt in einem Gebaeude seiner Universitaet. Dort betreut er mehrere Doktoranden und arbeitet an diversen Forschungsprojekten. Neulich war Clyne in Bonn auf Einladung der Humboldt Stiftung, um ueber die Sprachenpolitik in Deutschland zu dozieren. Heute ist sein Beitrag ueber die Verbreitung der deutschen Sprache in Australien im Newsletter der Berliner Gazette zu lesen. Morgen auf dieser Website. Der Koenig der Sprachforscher – er ist ein seltenes Reptil, das durch seine Arbeit dazu anregt, die Debatte um die deutsche Sprache aus einer internationalen Perspektive zu fuehren. Man sollte ihm dankbar sein.
-
Die Lust der Negation
Es ist nicht einfach nur ein alter Stereotyp ueber England: Deutschland geniesst auf der Insel einfach kein besonders hohes Ansehen. Trotz der Kampagnen, die die deutsche Botschaft in England mehrmals durchgefuehrt hat, um diese Situation zu aendern, scheint es, dass die Vorurteile und der Mangel an Interesse sich nicht so einfach vertreiben lassen. Die lachenden Gesichter von Boris Becker, Claudia Schiffer und Schumacher auf den Plakaten in Central London waren wohl nicht locker genug, um einen Wandel herbeizufuehren… Deshalb fuehle ich mich manchmal ein bisschen komisch, wenn ich in diesem Land, wie vor ein paar Tagen, mit Freunden in einem Zimmer vom St. Johns College sitze und ueber unser Interesse an der deutschen Literatur rede. Ich komme mir dann vor wie Teil einer Gruppe von Verschwoerern, die ihre Geheimnisse mit den anderen Eingeweihten der Untergrundsorganisation teilt. Bei der letzten interessanten Diskussion ging es um die Ausdruecke, die unserer Meinung nach typisch deutsch sind. Die allgemeine Meinung zu diesem Thema war, dass die deutsche Sprache eine auffaellige Expressivitaet aufweist, wenn es zur Negation kommt. Es ist nicht unbedingt so, dass die Sprache mehr Formen der Negation hat als andere. Aber es wird offenbar mit mehr Genuss geleugnet, verneint und negiert.
Das stimmt aber gar nicht.
Was fuer eine grossartige Form der Negation! Im Vergleich dazu, klingt der Ausdruckthats not true at all
charakterlos. Vielleicht ist unsere Meinung zum Thema nur das letzte Beispiel der englischen Vorurteile ueber die Deutschen. Das stimmt aber gar nicht! In unseren Diskussionen verneinen wir einfach nur so liebend gern. Vor allem auf Deutsch. -
Ich liebe Derrida
Eigentlich hiess es
Ich liebe einen Jacques Derrida
(I’m in love with a Jacques Derrida) in einem mehr als 20 Jahre alten Scritti Politti-Popsong. Der Scritti Politti-Kopf Green Gartside konnte ueber all jene nur lachen, die solche Zeilen woertlich nahmen. Sicher, Gartside verschlang die philosophischen Schriften des in Algerien geborenen Franzosen und faedelte sogar ein Treffen mit seinem Idol ein. Dennoch waren diese Zeilen weniger ein Liebesgestaendnis, als vielmehr der poetische Hoehepunkt eines Pop, der nicht mehr und nicht weniger sein wollte als sofistiziertes Zitat.Bis heute taucht Gartsides gehauchter Satz haeufig dann auf, wenn ein theoretischer Zugang zu Pop paraphrasiert oder dann, wenn auf den Einfluss der Philosophie im Pop verwiesen werden soll. Ersteres kommt uebrigens bestens in der Publikation >Plattenspieler< zum Ausdruck – ein absolut lesenswerter Gespraechsband von drei Kulturschaffenden gleichen Jahrgangs (1955), die anhand von Popmusik ueber ihre Sozialisation reflektieren. Letzteres zeigt sich in dem Orange Press-Buch >Jacques Derrida<, das ein zugaenglicher Fuehrer zu dem Denken des vor exakt zwei Jahren Verstorbenen sein will. Und zurecht.
Dieser Band aus der von Klaus Theweleit konzipierten Reihe ist ein weiterer Beleg fuer ein tolles Konzept: Biografie und Werk durch einen selektiven Filter engzufuehren, gebuendelt auf nicht mehr als 200 Seiten. Das Buch als perfektes Pop-Album, Einstiegsdroge oder kompakte Option, einen neuen Zugang zu einem sperrig anmutenden Output zu finden, das man hier und da zitiert. Das man irgendwie zu kennen glaubt. Und das man als schon abgehakt zu den Akten gelegt hatte. Das man aber jenseits von coolem Halbwissen und studentischem Eifer, neu betrachten sollte. Kategorie: Basiswissen.
-
Wer Deutsch spricht, riskiert Arbeitsplatz
In Deutschland ist eine neue Zeit angebrochen, die Zeit des Denglisch. Das bekam auch Herr Vogelsang, ein Mitarbeiter der Lufthansa Technik AG, neulich zu spueren. Er wollte nicht einsehen, dass in seiner Firma Dossiers nur auf Englisch abgefasst werden und begann einfach alles ins Deutsche zurueck zu uebersetzen. Dabei hat er jedoch nicht beachtet, das es sich bei der Lufthansa und ihrer Tochtergesellschaft um ein global operierendes Unternehmen handelt. Somit ist auch sein Argument, dass englische Begriffe in einem deutschen Unternehmen nicht notwendig seien, widerlegt. Das Argument mag fuer andere nationale Firmen zutreffen jedoch nicht fuer eine internationale. Herr Vogelsang muss sich also mit dem Gedanken vertraut machen, dass er in Zukunft die englischen Begriffe benutzen muss, da er sonst seinen Arbeitsplatz riskiert. In diesem Fall werden die Folgen der Globalisierung deutlich sichtbar: Deutsch wird in urspruenglich deutschen Unternehmen zur Zweitsprache erklaert. Wer der englischen Sprache nicht maechtig ist, oder sogar wagt ihr zu trotzen wird zunehmend desorientiert und isoliert sein in einer Gesellschaft, die sich vollkommen der Vernetzung und Vereinheitlichung der Kommunikation und der Kulturen verschrieben hat. Es gibt drei Gruppen von Menschen. Die erste passt sich der Globalisierung an und akzeptiert die Verschmelzung bzw. die Ausloeschung von Sprachen und Kulturen. Die zweite bemueht sich unaufhoerlich diese vor den gerade order carisoprodol genannten Folgen zu bewahren. Doch niemand vermag zu sagen wie lange sie diesen Kampf noch fuehren kann. Die dritte Gruppe befindet sich irgendwo in der Mitte. Sie ist bestrebt, ihre Kultur zu erhalten, doch moechte sie sich auch mit anderen auseinandersetzen und austauschen. Doch die Menschen, die sich zu dieser Gruppe zaehlen, muessen sich irgendwann fuer eine der anderen entscheiden. Da eine dauerhafte Koexistenz von den ueber Tausend verschiedenen Kulturen der Erde, bedingt durch die Globalisierung nicht mehr moeglich sein wird. Zu welcher Gruppe zaehlen Sie sich?
-
Alarmstufe Auslaender
Nuechterne Farbbalken: Blau, gruen, rot. Die Startseit von Auslaender-Statistik sieht auf den ersten Blick sehr sachlich aus. Auf den zweiten Blick erinnert die Gestaltung an die Farbsymbolik der Homeland Security der USA: ein aesthetischer Code, der den Angsthormonhaushalt reguliert. Denn eines draengt sich auf. Wie beim Homeland Security-System einzelne Farben fuer Gefahrenstufen stehen, so atmen auch die Farbbalken der Auslaender-Statistik Alarmstufenluft. Der Blick in die statistischen Zonen bestaetigt mein Gefuehl. Das Datenpanorama ist durch einen tendenziell fremdenfeindlichen Filter erstellt worden – wer Kriminalitaet einschliesst, sollte auch Bereiche wie Sprache, Bildung und Kultur nicht aussen vorlassen. Die Integrationsfaehigkeit
unserer
Auslaender zeigt sich ja nicht zuletzt an ihrer Praesenz in Kultur und Medien, sowie an ihrer Faehigkeit sich die deutsche Sprache anzueignen. Uebrigens bin ich bei meiner Recherche zu diesem Zusammenhang nach wenig fruchtbaren Suchbegriffen wie Einwanderer und Gastarbeiter erst fuendig geworden, als ich Auslaender eingegeben habe. Ich finde, das spricht fuer sich. Dieser Begriff steht nicht umsonst in der Kritik. Leider war allerdings seine Eingabe in die Suchmaschine nicht umsonst. Offenbar sindwir
noch nicht soweit. -
Charlotte Chronicles.10
Neulich dachte ich einmal ueber die Woerter, die es nicht gibt, nach. Gewissermassen Loecher in unserer Sprache, die wir umfahren koennen, was aber immer mit kleinen sprachlichen Umwegen verbunden ist. Zum Beispiel existiert kein Aequivalent zu dem Wort
satt
, um das Gegenteil vondurstig
auszudruecken. Versuche, ein Kunstwort zu erfinden und es als Bestandteil der Sprache zu etablieren, schlugen fehl. Ebenso gibt es kein visuelles Pendant zuStille
, fuer die Beschreibung eines Zustands in dem es, was die optischen Eindruecke angeht,ruhig
ist. Fuer Letzteres habe ich auch in anderen Sprachen noch nie von der Existenz eines entsprechenden Begriffs gehoert. Es gibt allerdings eine Vielzahl von Woertern, die in bestimmten, aber nicht allen Sprachen existieren. Beispielsweise beschreibt das spanische Adjektivalegal
etwas, das durch das Gesetz nicht geregelt ist und wird haeufig auch fuer nicht legale, jedoch von fast allen praktizierte und tolerierte Sachverhalte verwendet (z.B. Mieteinnahmen nicht zu versteuern). Im Deutschen benutzt man in solchen Kontexten meist Begriffe wieGrauzone
oderKavaliersdelikt
. Ein spezifisches und praegnantes Adjektiv gibt es jedoch nicht. Das mag auch damit zusammenhaengen, dass in vielen spanischsprachigen Laendern diese Grauzonen etwas groesser sind und staerker das alltaegliche Leben praegen. Doch wie sieht es dann im Italienischen aus? Gibt es dort analog zu den viel zitierten 100 verschiedenen Begriffen fuer Schnee, die die New York Times der Sprache der Inuit nachsagte (was uebrigens bei genauer Betrachtung nicht stimmt), 100 verschiedene Abstufungen der Grauzone zwischen Legalitaet und Illegalitaet? Ich habe noch nicht nachgeforscht, aber es koennte natuerlich auch sein, dass im Rahmen derBerlusconisierung
das klassische legale Vokabular ausreicht.
Im Schwedischen und einigen anderen skandinavischen Sprachen gibt es uebrigens ein Gegenstueck zu >satt<:Otoerstig
laesst sich mitundurstig
uebersetzen. Ein Zustand, den ich bei schwedischen Touristen in Deutschland allerdings noch nicht beobachten konnte, doch vielleicht ist es ja auch nur die Beschreibung eines Ziels. Der angestrebte Endzustand der irdischen Existenz, analog zum Erreichen des Nirvanas, auf den die durstigen Schweden mit grossem Einsatz hinarbeiten. -
Die Muttersprache der Zukunftsgesellschaft?
Boris Buden stellt diese Frage in seinem Vortrag am Maison de l’Europe, der am 12.10. stattfindet. Buden ist als Kulturkritiker bekannt, unter anderem aufgrund einer Veroeffentlichung zum Konzept der kulturellen Uebersetzung (Kadmos Verlag). In seinem Vortrag erlaeutert er dieses Konzept einmal mehr, das in seinen Augen eine Art Master-Modell der kulturellen Theorie zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist, immerhin stelle es die Loesung von kulturellen Konflikten in Aussicht und eine von ebensolchen Konflikte befreite Gesellschaft – eine Gesellschaft, in der Kulturen und Sprachen friedlich koexistieren. Doch Buden waere kein Kulturkritiker, wenn er die kulturelle Uebersetzung als Muttersprache der Zukunftsgesellschaft nicht in Frage stellen wuerde. Seine Bedenken und Kritikpunkte kommen ueberigens auch bestens in dem von ihm ko-initiierten Projekt translate zum Ausdruck. Ein Besuch der Homepage sei an dieser Stelle jedenfalls nachdruecklich empfohlen.








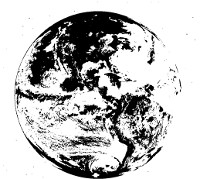





 KOMPLIZEN
KOMPLIZEN