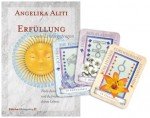Erich Zwirner, 22.09.1928 – 17.04.2003
Erich Zwirner wurde in Mürzzuschlag geboren. Lebte in der eigens für das Stahlwerk “Schoeller – Bleckmann“ angelegten Arbeitersiedlung Hönigsberg. Arbeitete in diesem Stahlwerk in verschiedensten Bereichen, als Walzer, Oberbau- und Platzarbeiter, Kesselwärter und zum Schluss, bis zu seiner Pensionierung, als Umspannwärter. Beschrieb diese Bereiche und seine Arbeit in zahlreichen Prosatexten mit größtenteils autobiographischen Zügen. Verstarb am 17. April 2003 in Mürzzuschlag.
Erich Zwirner war Mitglied im „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ und wurde für sein literarisches Schaffen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
Der folgende Text „Als der Nebel sich hob“ stammt aus: Erwin Zwirner: Im Schatten der Zeit. Erzählungen. 1992, merbod–Verlag, Wiener Neustadt.
„Im Schatten der Zeit“ ist leider heute nur mehr antiquarisch erhältlich. Ebenfalls vergriffen sind die Werkstatthefte der „Steirischen Werkstatt – Literatur der Arbeitswelt“, in denen Erwin Zwirner immer wieder publiziert hat.
Als der Nebel sich hob
Als der Nebel sich hob … standen sie in einer eiskalten, luftleeren Mondlandschaft.
So oder ähnlich würde ein Lyriker die Situation der Stahlarbeiter beschreiben. Ein Märchenerzähler nach Jahren im Atombunker der Regierung aber so: Es war einmal eine mächtige Eisen- und Stahlindustrie in unserem Lande, in der die Arbeiter bis zum Jahre 1979 fast glücklich und zufrieden ihr Brot verdienten. Ihre Regierung und ihre Gewerkschaft sagten ihnen täglich, dass sie auf einer Insel der Seligen lebten. Und sie glaubten es. Der Nebel, der über dem Lande lag, störte sie nicht weiter. Im Gegenteil. Er schützte sie sogar vor ein paar mahnenden Stimmen, deren Laute in dieser Watte versanken.
Genau so aber übersahen sie die unheimlichen Gestalten, die nur in Grauzonen lebten und immer besser gediehen, ohne etwas zu leisten. Eines Tages aber kam ein Sturm auf und wehte den Nebel fort. Als die Arbeiter daraufhin ihre Köpfe hoben und zum ersten Mal ihre Umgebung klar sahen, kroch eine schreckliche Kälte ihre Rücken hoch und setzte sich zwischen ihren Schultern fest.
Als die Nacht sich davonschlich, ließ sie einen düsteren, grauen Morgen zurück. Wolken hingen so tief vom Himmel, als wollten sie sich auf die Rauchfänge der Werke setzen. Der Lärm der Maschinen und Walzgerüste aber hörte sich leiser an als sonst. Bis er auf einmal ganz verstummte.
Kurze Zeit später kommen die Arbeiter aus dem Werkstor und sammelten sich auf dem Parkplatz. Die roten, gelben und blauen Schutzhelme bilden ein buntes Muster. Sie formieren sich zu einer dreireihigen Schlange und marschieren zwischen Bahndamm und Fluß der Stadt zu.
Karl hat sich mehr am Ende der Kolonne eingereiht. Er ist niedergeschlagen und verbittert. Er ist 1925 geboren. „Wieder marschieren“, denkt er sich. „Immer wenn marschiert wird, ist das Land krank. Immer hat es zuerst mit Wirtschaftskrisen und dann mit Kriegen zu tun. Und jede Straße endet in Armut, Not, mit verwüsteten Ländern und auf riesigen Schlachtfeldern. Er beobachtete seine Kollegen. Er hat den Eindruck von einer gesichtslosen Masse. Abweichende, nichtssagende, hassende Gedankensplitter glaubt er zu fühlen. Nur überlagert von der Angst des Arbeitsplatzverlustes. Keine Spur von Solidarität oder einem festen Ziel.
Er schiebt sich seinen Helm aus der Stirn. Er weiß auch nicht, was er täte, wenn er seine Arbeit verlieren würde. Denn die Arbeit zu verlieren heißt, sich selbst zu verlieren. Hieße für ihn Armut und ausgestoßen sein. Hieße nicht fähig sein, seine Kinder zu versorgen und ihnen eine Kindheit ohne Not zu bieten. Als Versager dazustehen. Und so wird jeder gegen jeden kämpfen. Das Wort „Solidarität“ wird zum Schimpfwort werden. Die Gewerkschaft wandert auf einem schmalen Grad und muss aufpassen, nicht zum Diener einer kapitalistischen Finanzpolitik zu werden.
„Belsazar!“ Die Schrift an der Wand,. Vor ihm geht Kurt. Ein lustiger, hübscher Bursche. Er ist ein Lebenskünstler. Immer auf der Butterseite. Ihm, Karl, ist er ein bisschen zu glatt. Er hält ihn für eine Wetterfahne, die sich immer nach dem Winde dreht. Karl hat Kurts Worte noch in seinen Ohren.
„Gehören sowieso 200 hinausgeschmissen. Die Krankenstandschinder und Blaumacher. Und die Zettelpicker.“ Und, und, und. Aber Karl hat noch nie gesehen, dass Kurt sich einen Hax`n ausgerissen hätte bei der Arbeit. Oder, wenn er an Fritz, der zwei Reihen hinter ihm geht, denkt. Ein guter Arbeiter, aber ohne Rückgrat.
„I moch meine Orbat und olles andere is mir wurscht“, sagte er bei jeder Gelegenheit, wenn ihn einer um seine Meinung fragt. Oder: „Vom Lesen wird man nur blöd.“
Die meisten sind schon in Ordnung, nur haben sie es sich in den letzten 30 Jahren abgewöhnt, selbst zu denken, und haben statt dessen alle Entscheidungen ihren Vorgesetzten und Betriebsräten überlassen. So scheuen sie sich, berechtigte Kritik zu üben. Sie schimpfen höchstens im Wirtshaus. Wenn ein Direktor kommt und ihnen erzählt, dass die Wirtschaftslage schwierig sei und eben dadurch von ihnen besonders große Opfer gefordert werden, so empfinden sie es zwar hart, aber keiner von ihnen denkt daran, ob das so sein muss. Oder ob es nicht auch andere Wege gibt, um diese Opfer zu vermeiden. Sie begreifen nicht, dass es scheißegal ist, was so einer quatscht, wenn nur die Arbeiter alles ausbaden müssen, was manche „da oben“ vermurksen.
Wenn ich zum Doktor gehe, weil ich krank bin und der sagt mir die Krankheit, kann, oder will mir nicht helfen, so wechsle ich eben den Doktor und gehe zu einem, der mir hilft, sagt sich Karl, wird aber jäh aus seinen Gedanken gerissen, weil er seinem Vordermann auf die Ferse gestiegen ist.
„Pass doch auf, du Idiot, willst wohl schon jetzt meinen Platz einnehmen“, zischte Heinz ihn an. Wahrscheinlich rauft er sich mit den gleichen Gedanken herum.
Karl antwortete: „Sei nicht blöd. Ich habe nur daran gedacht, wer die Idee gehabt haben könnte zu diesem überstürzten Marsch.“
„Das war der Betriebsrat. Viele von uns murrten, dass nichts geschieht, und da die Kommunisten für morgen eine Protestversammlung angekündigt haben, wollen sie eben denen zuvor kommen.“
„Aber das ist doch eine halbe Sache. Wenn schon Protest, dann muss die ganze Region mit. Denn es geht alle an, ob wir ein Industriefriedhof werden oder nicht.“
„Du kennst die Auffassung unserer Führung. Rebellieren bringt keine Arbeit.“
„Also schön still sein“, spottet Karl, „aber die im Schwesterwerk wissen, wo es ihnen wehtut. Und sie sagen es auch ganz laut.“
„Ja, ja! So ist es eben. Da kannst nichts machen, “ Heinz lacht. „Da hast ein Stück kapitalistisches Produkt.“
Er will Karl einen Kaugummi geben.
„Hör auf mit dem Scheißdreck.“ Karl fühlt, wie die Wut in ihm hochsteigt. „Dass du da noch Witze machen kannst, wenn es um unser Überleben geht. Du bewegst dein Maul immer sehr fleißig. Aber leider zum Kaugummifressen.“
„Ach, leck mich. Ich verputz mich weiter nach vorn. Such dir einen anderen zum Streiten.“
Heinz spuckt seinen Kaugummi auf den Bahndamm, schert aus und reiht sich weiter vorne wieder ein.
Karl ärgert sich über seine Ungerechtigkeit. Er weiß, dass Heinz kein schlechter Kerl ist. Er spricht kein Wort mehr, bis sie beim Werk 1 vor der Stadt angekommen sind. Dort vereinigen sie sich mit diesen Kollegen und gehen das letzte Stück bis zum Hauptplatz gemeinsam.
Es spricht zuerst der Nationalratsabgeordnete dieser Region, dann der Bürgermeister der Stadt und schließlich reden zwei Betriebsräte des Werkes. Einem Politiker der Stadtopposition wird das Wort verweigert, was Karl nicht für richtig hält. Aber alle, die sprechen, sagen sinngemäß das gleiche: Weiterführung des Stahlwerkes bis zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, Ausbau der Finalproduktion, Weiterführung des Blockwalzwerkes, und wissen doch schon, dass die Werke zwei und drei zum Tode verurteilt sind. Dass dieser Marsch nur eine Warnung vor einer richtigen Demonstration sein soll, sagen sie alle.
Als dann ein Betriebsrat die Führung der Vereinigten Stahlwerke mit harten Worten angreift und sie für unfähig erklärt, die Werke zu leiten, hört man auf einmal die Worte wie Verräter, Sauhunde, korrupte Schweine aus der Menge aufbrausen. Auch manche Politiker und Betriebsräte werden beschimpft. Am meisten der Zentralbetriebsrat. Er soll nämlich den Spruch von den Faulen und Unzufriedenen, die den Ernst der Lage nun hoffentlich begriffen hätten, in Umlauf gesetzt haben. Da war aber schon alles zu Ende, und wie eine Gewitterwolke, die von der Sonne aufgefressen wird, oder wie ein Luftballon, der zerplatzt, hat sich die Demonstration, die ja keine sein sollte, aufgelöst.