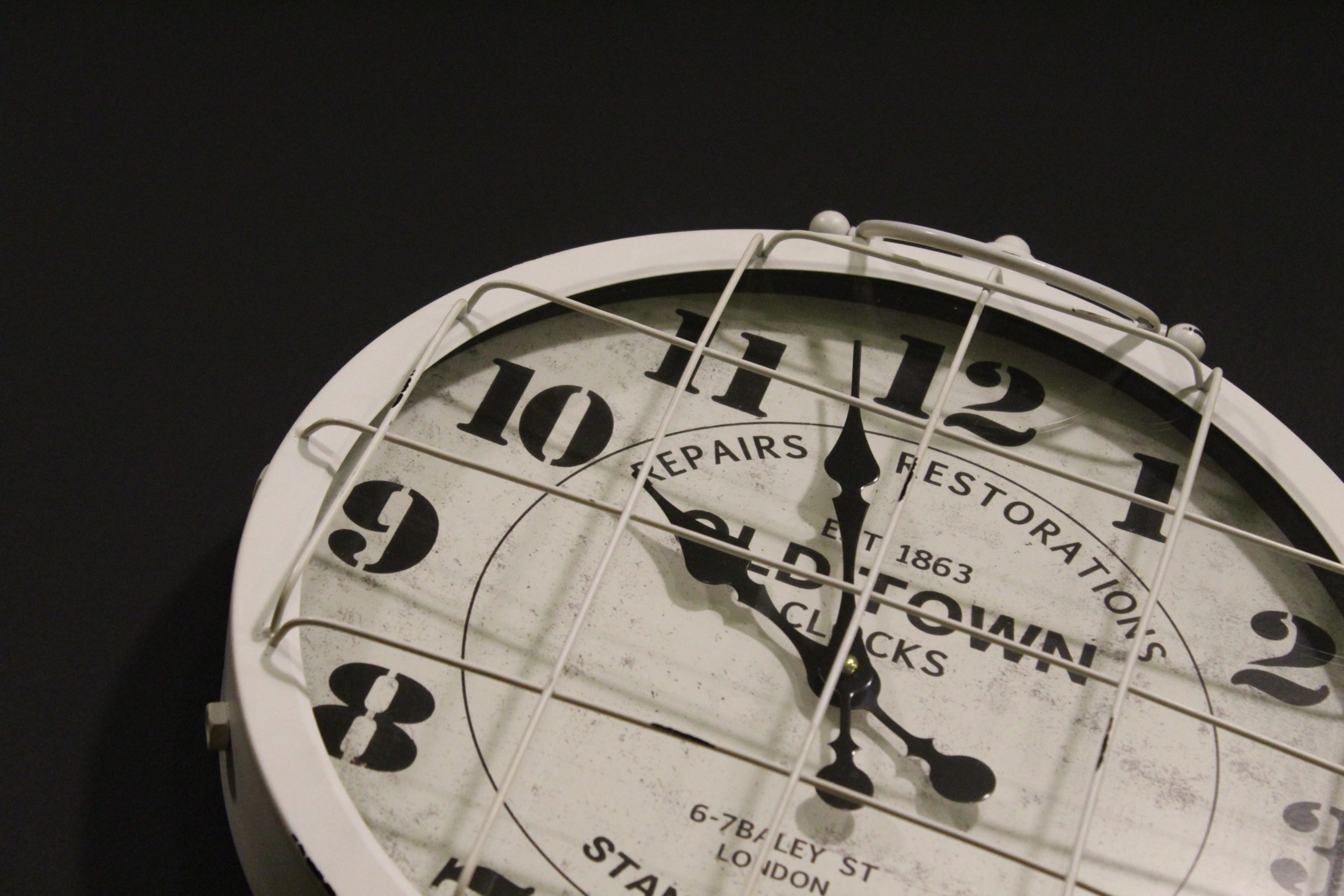von Solvejg Nitzke
Im Urlaub, als ich gemütlich Andri Snær Magnasons Wasser und Zeit lesend im Liegestuhl lag, stellte mir mein Mann eine Frage, die mich seitdem beschäftigt: „Wie viele solcher Bücher musst Du eigentlich noch lesen?“ Wäre er nicht auch ein Büchermensch, wäre diese Frage eine Frechheit. Ich kann ja schließlich lesen, so viel ich will. Da er aber zur statischen Verunsicherung unserer Wohnung durch immense Buchkäufe ebenso beiträgt, wie ich, kann die Frage nach der Zahl der gelesenen Bücher nicht Grund für seinen Kommentar sein. Auch das Prinzip, mehrere Bücher zu einem Thema zu lesen, ist ihm als Wissenschaftler nicht fremd. In seiner Frage lag vielmehr eine andere Sorge, denn „solche“ Bücher, meint: Bücher über die globale Klimaerwärmung, die Gefährdung von Ökosystemen und Biodiversitätsverluste, kurz, über eine Zukunft, die in beinahe jeder Hinsicht von Zerstörung und Verlust natürlicher Umwelten gekennzeichnet sein wird.
Die Sorge, die ich meinem Mann unterstelle, umfasst also nicht nur den Verdacht, ich arbeite im Urlaub (plausibel), sondern auch die Vorahnung, dass ich nach der Lektüre einmal mehr vollkommen frustriert sein würde. Denn ich muss kein Klimabuch mehr lesen – das Projekt zur „Zeit des Klimas“, in dem ich in Wien gearbeitet habe, ist abgeschlossen, das letzte ausstehende Sonderheft erschienen. Handelt es sich also um ein zwanghaftes Verhalten – masochistisches Lesen sozusagen?
Die Frage legt nahe, dass es ein „Genug“ gäbe, also eine Menge an Büchern, nach deren Lektüre man Bescheid wisse oder ab der es zumindest ratsam wäre, nicht noch mehr zu lesen und sei es nur, um sich wenigstens im Urlaub nicht noch einmal mit den drohenden Katastrophen einer sich radikal verändernden Welt und der weitreichenden Ignoranz gegenüber diesen wahrscheinlicher werdenden Szenarien zu konfrontieren. Diese Grenze zu überschreiten markiert dann vielleicht tatsächlich den Übergang von Wissensdurst und wissenschaftlichem Interesse zu etwas Anderem. Aber wozu?
Die Frage beschäftigt mich nicht nur, weil ich befürchte, es könnte etwas dran sein an der impliziten Unterstellung eines gewissen Lesemasochismus. Man müsste sie nämlich auch an die Autor*innen „solcher“ Bücher stellen: Wie viele Klima-Bücher müsst Ihr noch schreiben? Was könnt Ihr noch sagen, das wir nicht schon längst wissen? Leistet Ihr mehr, als uns zu frustrieren oder – vielleicht noch schlimmer – falsche Hoffnung zu wecken? Diesen Fragen, so grundsätzlich sie sind, muss sich ein Buch über „Wasser und Zeit“ stellen, denn gerade weil Bücher über Klima und Natur oft ein so großes Publikum finden, tragen sie eine Verantwortung. Das heißt nicht, dass sie letzte Antworten liefern oder gar Probleme lösen müssen, die Politik und Gesellschaft seit Jahrzehnten vehement verweigern, aber sie müssen sich fragen lassen, was sie zu sagen haben und wie.
Familienklimageschichte
Andri Snær Magnasons Geschichte unserer Zukunft versucht, die ‚Generationenfrage‘ zum Erzählprinzip zu machen. Nicht zuletzt angesichts des ersten isländischen Gletschertodes begann er, sich mit der Frage zu beschäftigen, in welcher Welt zukünftige Generationen, in diesem Fall seine Tochter Hulda, leben werden und wie sich die Welt in einem Zeitraum, der direkt mit ihrem Leben verbunden ist, verändern wird:
„Stell Dir mal vor! 262 Jahre! Das ist die Zeitspanne mit der du in Verbindung stehst, du kennst Menschen aus dieser gesamten Zeitspanne. Deine Zeit ist die Zeit von jemandem, den du kennst, den du liebst und der dich prägt. Und deine Zeit ist auch die Zeit von jemandem, den du kennen und lieben wirst, die Zeit, die du gestalten wirst. Du kannst 262 Jahre mit deinen bloßen Händen berühren. Deine Uroma bringt dir etwas bei, und du bringst deiner Urenkelin etwas bei. Du kannst direkten Einfluss auf die Zukunft nehmen, bis zum Jahr 2186.“ (22)
Es wäre kein Buch über die Zukunft, würde Andri hier nur seine Tochter ansprechen. (Da es im Isländischen statt Nachnamen Patronyme gibt, muss entweder der Vorname oder der vollständige Name verwendet werden – der persönliche oder intime Eindruck, der so im Deutschen entsteht, passt aber auch über die korrekte Benennung hinaus zu Andris Leser*innenansprache). In der Rechenaufgabe (wie lange lebt meine Urenkelin, wenn ich so alt werde, wie meine Uroma) steckt die Aufforderung, die „eigene Zeit“ selbst zu berechnen. Damit wären wir mitten in dem Forschungsfeld, an dem ich in den letzten Jahren mitgearbeitet habe. Im Projekt „Zeit des Klimas“ an der Universität Wien wäre das ein gutes Beispiel für den erzählerischen Einsatz „ästhetischer Eigenzeiten“ gewesen. Es ging dabei um die Verzeitlichung der Natur in der modernen Literatur, d.h. um den Paradigmenwechsel einer Vorstellung von Klima und Natur als statischen hin zu dynamischen und damit letztlich auch von Menschen veränderbaren Größen.
Gerade mit Blick auf das Klima ist die Literatur – in einem sehr weiten Sinne – eine zentrale Agentin dieser Transformation, denn sie kann (Zukunfts-)Szenarien unabhängig davon durchspielen, ob sie wahrscheinlich sind, sie kann „exotische“ Klimata vergegenwärtigen und Klima auf jeder erdenklichen Ebene manipulieren. Gerade im Erzählen lassen sich unbegreiflich komplexe Zusammenhänge auf eine Weise darstellen, die menschliche Dimensionen von Zeit und Raum mit den Größenordnungen von Erd- und Klimageschichte in einen sinnvollen Zusammenhang stellen. Andri greift genau diese Idee auf und versucht, sie zu einem Handlungsaufruf zu entwickeln.
Bis er dort ankommt, muss er all jene Szenarien von Verfall und Zerstörung aufrufen, die den Diskurs über die ökologische Krisenlage der Gegenwart bebildern und soviel Angst erzeugen, dass sie – zumindest bis die Corona-Pandemie dem vorerst ein Ende setzte – vor allem junge Menschen in Massen zu Streiks und Demonstrationen bringen. Dass er trotzdem nicht in einen apokalyptischen Tonfall verfällt, wie z.B. der von ihm zitierte David Wallace-Wells [1], liegt daran, dass die (Erd-)Geschichte den Menschen in der von Andri Snær Magnason geschilderten Welt (noch) nicht entglitten ist. Vielmehr verschiebt sie menschliche Agency, genauer, das Narrativ der Kontrolle über die Natur von einem Dominanzdiskurs zu einem der Sorge. Dazu muss er zunächst die Größenordnungen der ökologischen und klimatologischen Transformationen auf ein menschliches Maß bringen.
Andris genealogisches Gedankenexperiment dient genau diesem Zweck. Es bringt die Zeiträume der Zukunftszenarien des IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change – der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaveränderungen oder Weltklimarat) in Berührung mit tatsächlichen Menschen. Weil es verwandte Menschen sind, wird aus der Metapher der Berührung ein ‚natürlicher‘ Zusammenhang. Wasser und Zeit macht aus Klimageschichte Familiengeschichte – das macht das Buch nicht nur besonders lesbar, sondern auch problematisch, denn die Beziehung der Familie von Andri Snær Magnason zu den Gletschern wird über den nur scheinbar kleinen Umweg des Mythos zu einem genealogischen und nationalen Wir, das ohne viel Aufhebens pars pro toto für die ganze Menschheit einstehen soll.
Die scheinbare Unvereinbarkeit der neuen Wirklichkeit erfordere, so Andri zu Beginn des Textes, eine massive Anstrengung sowohl in Hinblick auf die materiellen Bedingungen der drohenden Veränderungen des Erdsystems, als auch auf die Sprache, in der sie beschrieben werden: „Wenn ein System zusammenbricht, befreit sich die Sprache aus ihren Fesseln. Wörter, die eigentlich die Realität beschreiben sollten, schweben frei in der Luft und sind nicht mehr zutreffend. […]“ (10).
Der Systemzusammenbruch, den Andri Snær Magnason zu Beginn beschreibt, ist die Bankenkrise, die Island besonders hart traf und (nicht nur) in seiner Darstellung an den Zauberlehrling erinnert, der die Geister, die er rief, nun nicht mehr loswird. Wie Zauberworte befreit sich dann auch die Sprache aus ihren Fesseln und verweigert den ihr anscheinend eigenen Zusammenhang mit der Realität. Die Leitmotivik des Buchs – Gletscher und Staudämme – klingt hier bereits an, denn die unfassbare Energie der gefrorenen, wie flüssigen Wassermassen, die in Andris Geschichte der Zukunft Island mit Tibet und damit ‚der ganzen Welt‘ verbinden, bricht sich hier bereits rhetorisch Bahn. Der Sprung von der Finanzkrise (immerhin einer globalen Krise) zur globalen Erderwärmung wird dadurch abgesichert, dass Island zum tertium comparationis, also zur Gemeinsamkeit oder zum Kontinuum in den Krisen wird. Island, als konkreter Ort ebenso wie als Idee, wird also zum Anfang und Ende einer Geschichte der Zukunft, die – so scheint es – nur von hier aus so erzählbar wird. Es hält alle Sprünge zusammen, weil alle Ebenen der Erzählung (Familie, Mythos, Klima) sich hier treffen.
Arbeit am Mythos
Es lohnt sich diese Sprünge, etwas genauer zu betrachten. Wasser und Zeit spielt sich auf drei Ebenen ab, die zugleich Erzählverfahren, Motive und Argumente bilden: Familie bzw. Familienbeziehungen, Mythos und Mythologie sowie die der ökologischen Verhältnisse, vor allem des Weltklimas. Die Aufgabe an die Tochter, auszurechnen, wie viele Jahre mit ihrem Leben „direkt“ verbunden sind, d.h. durch Verwandtschaft, Vor- und Nachfahren, denen sie begegnet ist oder denen sie begegnen kann, bildet den Kontrapunkt zur Entfesselung der Sprache, die der Schriftsteller (Andri Snær Magnason) selbst erlebt. Während der Zusammenhang zwischen Wörtern und Wirklichkeit mit der Gewalt eines Dammbruchs zerfällt, bildet die (Bluts-)Verwandschaft einen Zusammenhang, dessen Realität eben nicht durch Sprache konstruiert, sondern durch Genealogie gegeben ist. Sie holt die entfesselte Sprache wieder ein, indem sie eine Alternative anbietet, die – zumindest in dieser Logik – unabhängig vom Sprachvermögen ‚greifbar‘ ist.
Ob die dereinst 94 Jahre alte Urenkelin im Jahr 2186 für die zehnjährige Hulda ‚wirklich‘ greifbarer ist als ansteigende Meeresspiegel oder die „Versauerung der Meere“ sei dahin gestellt. Das Gedankenexperiment erzeugt eine vertraute Relation, die Tochter (wie Leserin) als Konzept näher ist, als die “Versauerung”. Denn die Zukunft der Gletscher wird durch die Familienverbindung zum Teil der eigenen Geschichte. Auf diese Weise kann Andri Snær Magnason nicht nur die Gletscher, sondern auch J.R.R. Tolkien und Robert Oppenheimer in „seine“ Geschichte einbeziehen – seine Großtante war Tolkiens Kindermädchen, sein Onkel, Arzt in New York, operierte Oppenheimer und den iranischen Schah.
Damit macht es Andri Snær Magnason sich und seinen Leser*innen allerdings eine Spur zu einfach. Die Krux seiner Geschichte der Zukunft liegt im Verhältnis von Mythos und Natur. Denn es handelt sich nicht um Gegensätze die Wasser und Zeit wieder vereint, sondern um gleichermaßen wirkmächtige Konzepte, die im Erzählen auf problematische Weise zusammen kommen. Diese erzählerische Operation leistet nämlich weit mehr, als Anschaulichkeit herzustellen, sie naturalisiert Relationen und Beziehungen.
Roland Barthes hat das Verfahren der Naturalisierung als zentrale Funktion des Mythos beschrieben: Der Mythos als Rede [2] verdoppelt den Zeichenprozess mit dem Ergebnis, die Arbitrarität des ursprünglichen Zeichens zu verschleiern bzw. zurückzunehmen. Der Mythos wird so zum Werkzeug von Ideologie, weil er menschengemachte, sprachlich erzeugte Zeichen, wie die Dinge selbst erscheinen lässt, also naturalisiert. Zugespitzt: der Mythos macht aus Geschichten Wirklichkeit. Damit lassen sich gesellschaftliche Ordnungen, Rituale und Vorlieben, aber eben auch nationalistische Erzählungen nicht nur rechtfertigen, sondern gleich unhinterfragbar machen. Weil Gletscher Teil der Familiengeschichte sind, wird ihr Verlust emotional belegt. „Unser“ Gletscher stirbt; „Ich kannte noch…“-Geschichten, die lang genug zu den Genres der Familiengeschichten gehörten, werden hier zum Gradmesser und Wertmaßstab nicht-menschlicher Natur und das, ohne dass dieser Wertungsprozess reflektiert werden müsste.
Die „deutsche“ Wald- und Heimatliebe gehören ebenso zu diesen Erzählungen, wie die bei Andri Snær Magnason ausgestellte isländische Gletscherverwandtschaft. Was abstrakt klingt, wird bei Andri insofern zum Programm, als er die semiotische Funktion des Mythos verdoppelt und verdreifacht. Denn wo die familiären Beziehungen doch (wiederum buchstäblich) zu kurz greifen, verbindet Andri sie mit isländischen und – in einer etwas abenteuerlichen, wenn auch charmanten Bewegung – tibetischen Mythen. Die Kuh Auðhumla dient ihm als Anlass, die scheinbar universale Bedeutung des Gletscherwassers für ‚die Menschen‘ zu behaupten. Auch wenn er die Unterschiede aufzählt, sie verschwinden hinter dem allzu passenden Bild der „heiligen Kuh“. Rund um den Himalaya hängen die Wasserversorgung von Millionen Menschen sowie das regionale Klima von den Gletscherflüssen ab. Das Verschwinden der isländischen Gletscher wirkt sich hingegen nicht so unmittelbar auf die Bevölkerung des Landes aus, zumal wenn man die Anzahl der direkt betroffenen Menschen bedenkt, denen ggf. der Zugang zu Frischwasser fehlt. Auch die Etymologie von Auðhumla und dem Himalaya bleibt assoziativ (u.a. über den tibetischen Distrikt Humla, 79).
Die Behauptung der globalen Gletscherverwandtschaft der Isländer und Tibeter auf die Tatsache zu gründen, dass Edda und Veden an (unterschiedlich) zentraler Stelle von einer Kuh erzählen aus deren Euter Flüsse aus Milch entstehen, ist philologisch so unsauber wie sie narrativ wirksam ist. Dennoch gelingt es Andri dadurch die geschilderten Verhältnisse einmal mehr zu naturalisieren – so, als müsse eine Gemeinschaft, die an Gletscherflüssen lebt (unabhängig davon, ob sie wissen kann, dass es sich um solche handelt) davon ausgehen, eine riesige Kuh „spende“ dieses Leben. Dass seine Besessenheit mit der Kuh zumindest zum Schmunzeln anregt, zeigt Andri Snær Magnason immerhin selbst auf. Sie leitet nichtsdestotrotz eine tour de force der Überblendungen von Familie, Mythos und Klima an, deren gut gemeintes Ziel sie nicht vollständig von ihren problematischen Aspekten befreit. Das Lachen des Dalai Lama über Andris „Magic Cow“ (245) ist in dieser Hinsicht sehr großzügig.
Problematisch ist Andri Snær Magnasons Geschichte der Zukunft im Grunde aus den gleichen Gründen, die sie so gut lesbar machen. Die Genealogie der Sorge für die Zukunft, die Wasser und Zeit avant la lettre entwirft, geht ein bisschen zu gut auf. Sie verknüpft einzelne Menschen mit den globalen, tiefenzeitlichen Systemen der Atmosphäre, der Wasserkreisläufe und damit mit der gesamten Biosphäre. Ein Problem dieser „Mythologie für die Gegenwart“ (114) benennt Andri selbst: „Bei Themen, die das gesamte Wasser auf der Erde, die gesamte Erdoberfläche und die gesamte Atmosphäre betreffen, erreicht man eine Dimension, die jegliche Bedeutung aufsaugt“ (12). Das „Rauschen“, das Worte wie „Versauerung der Meere“, „Gletscherschmelze“ und „globale Erwärmung“ verursachen, vergleicht er passend mit einem schwarzen Loch.
Die Dimensionen von Erd- und Klimageschichte verschlucken alle menschlichen Ereignisse und Bedeutungen in einem Rahmen, der 262 Jahre (mögliche) Familiengeschichte, nicht einmal anderthalb Jahrtausende isländischer Geschichte und selbst die zehntausendjährige Geschichte des homo sapiens mit viel gutem Willen zu nebensächlichen Ausnahmefällen der Erdgeschichte macht. Aber die (Zeit-)Verhältnisse haben sich verändert: „Die größten Kräfte der Erde haben die geologische Zeitskala verlassen und verändern sich nun auf einer menschlichen Skala“ (11). Das ist, für das, was es sagt, ein verhältnismäßiger Satz; aber wenn man bedenkt, was er bedeutet, kann man geradezu die Energie des schwarzen Lochs fühlen, von dem Andri Snær Magnason spricht. Dinge, die sonst im Rahmen von Jahrmillionen ablaufen (geologische Zeitskala), passieren nun im Zeitraum weniger Generationen (menschliche Skala).
Das Problem mit der Naturverbundenheit
Es leuchtet also unmittelbar ein, die eigenen Kinder und Kindeskinder (Nichten und Neffen tun es vielleicht auch) zu bedenken, um sich die Auswirkungen dieser Zukunft vor Augen zu führen. Sich über Nachkommen und Vorfahren aber an eine Landschaft zu binden, kann genau den gegenteiligen Effekt haben. Die Literaturwissenschaftlerin Ursula K. Heise hat in ihrer grundlegenden Studie Sense of Place and Sense of Planet. The Environmental Imagination of the Global (2008) auf die nicht zuletzt politische Notwendigkeit hingewiesen, zwischen lokaler und globaler Sphäre zu vermitteln, ohne die Spannung des Prinzips ‚act locally, think globally‘ einfach aufzulösen.[3]
Denn die Auflösung des spannungsvollen Gegensatzes von lokaler und globaler Handlung kann dazu führen, einen falschen Glauben an die Übertragbarkeit kulturell spezifischer Beziehungen zu Landschaft und Umwelt zu schüren und einen verschwindend geringen Teil der Menschheit – zumeist ein „Wir“ – zum Maßstab für alle zu nehmen. Wenn nämlich jede individuelle Handlung auf das globale Ganze abstrahlt, ist die umgekehrte Konsequenz allzu oft, dass eine lokale Besonderheit zum Maßstab für alle erhoben wird. Dieses Problem betrifft nicht allein Andri Snær Magnasons Text, ganz im Gegenteil.
Einer der berühmtesten Artikel über Klima und Geschichte, Dipesh Chakrabartys The Climate of History (2009)[4] spricht vom Zusammenbruch der Unterscheidung von Erd- und Humangeschichte und ruft nach einem „species thinking“ (213), also einem Denken, das alle Menschen als Teil einer (bedrohten) Art begreift. In diesem Sinne agiert Wasser und Zeit genau richtig: es macht keine Unterschiede zwischen Tibeter*innen und Isländer*innen, wenn es um die Zukunft geht, denn die Gletscher schmelzen überall. Wie aber Rob Nixon [5] und viele andere Wissenschaftler*innen und Aktivist*innen eindrücklich gezeigt haben, verkennt „species thinking“ die unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und Auswirkungen der globalen Krisen.
Andri Snær Magnason streift diese nur kurz. Er verweist zwar auf ein Bewusstsein dafür, dass sich die Gletscherschmelze im Himalaya anders auf den ohnehin mangelnden Wohlstand in Bangladesh und Indien auswirken wird als in Island und darauf, dass in China auch und vor allem deswegen so hohe Mengen CO2 ausgestoßen werden, um einen Lebensstandard zu erreichen, der auch nur annähernd dem der isländischen Familien gleicht, die Andri beschreibt; am Ende aber kommt er immer wieder am gleichen Punkt an: Wenn allein in der überschaubaren Zeitspanne seiner Familiengeschichte so große Transformationen stattfinden konnten, warum soll das nicht auch in der für seine Tochter überschaubaren Zukunft passieren?
Das ist eine berechtigte Frage und sie liest sich so viel angenehmer als die Alternativen (z.B. David Wallace-Wells Entzeitgeschichte The Uninhabitable Earth. A Story of the Future, 2019). Sie produziert dennoch ein Narrativ, das nicht nur anthropozentrisch bleibt, sondern historisch eine absolute Ausnahme bildet. Doch genau das ist der Punkt, Island – und hier droht Wasser und Zeit trotz aller Ausblicke in die Welt ins Nationalistische zu kippen – ist die absolute Ausnahme und eignet sich genau deshalb um von hier aus die Welt zu erklären. Wie die Gletscher ist auch das Leben hier so sichtbar prekär, dass es seinen Schutz geradezu einfordert: „Im Urwald ist das Leben allgegenwärtig und selbstverständlich, doch hier war es nackt und schutzlos, jeder Grashalm ein kleines Wunder“ (233).
Island und die Isländer*innen werden durch das genealogische Narrativ, das Landschaft und Leute untrennbar verbindet, zu privilegierten Beobachter*innen einer Ganzheit, die nur mythisch überhöht überhaupt herstellbar ist. Man könnte das eine „anthropocene fallacy“ [6] nennen – angelehnt an John Ruskins „pathetic fallacy“, die die poetische Übereinkunft innerer und äußerer Stimmungen benennt (z.B. dass es regnet, wenn jemand sehr traurig ist). Der Trugschluss der „anthropocene fallacy“ verführt, wenn man so will, dazu, den je ‚eigenen‘ Ort zum Maßstab für alle anderen zu machen und dabei nicht nur Gefährdung völlig falsch einzuschätzen. Dazu gehört die Überschätzung dessen, was ein einzelner Mensch erreichen kann und was eine ‚unmittelbare‘ Verbindung zur ‚eigenen‘ Landschaft und den Weisen, in denen frühere Generationen damit umgegangen sind, bewirken kann.
Denn auch wenn die in Island wachsenden Grashalme Andri Snær Magnason vorkommen wie „ein kleines Wunder“, sind die meisten Pflanzen in tropischen Regenwäldern viel empfindlicher als diejenigen, die es schaffen unter den geschilderten Bedingungen auf Island zu wachsen. „Empfindlicher“ ist wiederum bereits eine anthropomorphisierende Beschreibung, die hier darauf hinweisen soll, dass die Ökosystembedingungen in beiden Fällen so spezifisch sind, dass die Effekte der globalen Erwärmung sich negativ auswirken werden.
Indem er sich an solchen Stellen ausschließlich auf seinen eigenen Eindruck verlässt, reproduziert Andri eine Haltung, die allzu viel dessen kennzeichnet, was als Nature Writing gerade eine Renaissance erlebt. Es handelt sich um die Illusion, dass man „mehr“ erfahren kann, wenn man sich „direkt“ mit nicht-menschlicher Natur auseinandersetzt. Auch wenn Nature Writing intimes (und formales) Wissen über die beschriebenen Phänomene beinahe voraussetzt, erwecken die Texte vielfach den Eindruck, dass eine kritische Befragung die erhoffte Unmittelbarkeit nur stört. So spielt es dann keine Rolle mehr, welche Bandbreite von Umweltfaktoren ein Grashalm aushalten kann, es zählt der prekäre Eindruck, den er beim Betrachter hinterlässt.
Andri Snær Magnason ist in dieser Hinsicht reflektierter als viele, denn er sitzt nicht bloß – man verzeihe mir die Polemik – unter irgendeinem Baum (die in Island ohnehin rar sind) oder an irgendeiner Küste und zieht Schlüsse aus einer achso reinen Naturerfahrung, um von dort aus den Verlust der „old ways“ zu beklagen. Aber ich frage mich dennoch, ob er denkt oder den Eindruck erwecken möchte, der erste (Schriftsteller) zu sein, der sich auf diese Weise der aktuellen Krisenlage annähert.
Dass er nicht nur die familiäre Zukunft und Vergangenheit betrachtet, sondern das Projekt einer „Mythologie für die Gegenwart“ verfolgt, schließt produktiv an die Forderung des Schriftstellers Amitav Gosh nach einer Wiederbelebung des Epos an. [7] Aber wenn solche Bezüge implizit bleiben und zugunsten von Lesbarkeit auf Reflexionstiefe und –Schärfe verzichtet wird, dann wird es schwierig, die Frage zu beantworten, warum man dieses Buch auch noch lesen sollte. Es läuft vielmehr Gefahr, als feel-good-Lektüre zu ebenjener Massenapathie beizutragen, die es beklagt. Andri Snær Magnason stellt in Wasser und Zeit viele richtige Fragen (nach der angemessenen Sprache für Veränderungen, die keine Entsprechung in der Menschheitsgeschichte haben; nach dem, was Eva Horn „Katastrophe ohne Ereignis“ nennt [8]), es endet jedoch immer wieder allzu einfach: „Manche Lösungen sind ganz einfach, wir müssen nur auf unsere Großmütter hören“ (287). Damit fällt er genau dem „derangement of scales“ anheim, das Timothy Clark anschaulich als Ausgangspunkt einer kollektiven „anthropocene disorder“ benennt. Damit bezeichnet der Literaturwissenschaftler die Unfähigkeit, einzelne Handlungen in sinnvoller Weise (kausal) mit den Transformationen globaler Systeme wie der Atmosphäre zu verbinden. [9] Das Missverhältnis der Maßstäbe drückt sich nicht nur in Slogans zum Kipplüften aus, mit dem man „das Klima rettet“, sondern auch in Phänomenen wie „Flugscham“ und eben auch in der Hoffnung auf eine Heilsbringerin: „und wie in einem alten Volksmärchen erscheint das Kind Greta, das dazu bestimmt ist, uns die Wahrheit zu sagen“ (278).
Messianische Hoffnung und wütende Töchter
Mit „Greta“ zu enden, erscheint mir gefährlich und trotzdem vollkommen angemessen. Gefährlich, weil ich damit drohe, die Alarmknöpfe von Klimawandelleugnenden und sogenannten „Realisten“ (sprich: denen, die meinen, „die Wirtschaft“ müsse immer Vorrang haben und Klimamaßnahmen seien zu teuer) zu drücken; aber auch angemessen, weil sie mir erlaubt, Andri Snær Magnasons pars pro toto zu kontern: Greta steht (als Figur) für all diejenigen jungen Frauen denen, wie Andris Tochter Hulda, die Verantwortung für die Zukunft auferlegt wird.
Der Sorgearbeit, die es bedeutet, sich um eine lebenswerte Welt zu bemühen (möglichst auch noch für alle) nehmen sich auch die gutmeinenden Männer wie Andri Snær Magnason nicht vollständig an. Sie kümmern sich ein bisschen mit, aus sich selbst heraus (er)finden und erforschen sie große Naturerzählungen, wo Greta (als pars pro toto) notwendig zitiert und wiederholt. Das ist ihre größte Stärke: sie sagt, was schon hunderte, tausende Male gesagt wurde und sie fragt, weil ihr Wissen nicht neu ist, warum wir immer noch nichts getan haben. Sie verkündet also nicht, wie eine Märchenfigur, eine wenigen zugängliche „Wahrheit“; sie hat ihre Hausaufgaben gemacht und wiederholt, was sie gelernt hat – neu ist, dass sie Gehör findet.
Es ist vielleicht unfair von mir, der Klima-Kulturwissenschaftlerin, dem Schriftsteller vorzuwerfen, welche Bücher er nicht gelesen (oder zitiert) hat, aber wenn ich mir die Frage stelle, wie viele „solche Bücher“ ich noch lese, dann stelle ich fest, ich werde kritisch mit dem, was ich weiterempfehle.
Andri Snær Magnasons Buch liest sich streckenweise hervorragend, es ist synthetisiert und unterhält, es ist eine gute Geschichte. Aber anders als Greta schöpft er seine Geschichte aus mysteriösen, intransparenten Quellen, so dass sie kraftvoll erscheint, aber flach bleibt. Gretas Energie ergibt sich daraus, dass sie immer wieder sagt: Ihr wisst das alles, warum tut Ihr nichts!? „Shame on you!“ konnte sie der UN-Versammlung auch deswegen so beeindruckend entgegen schleudern, weil sie all die Dinge, die sie immer wieder neu gehört hat, schon tausende Male gehört hat und nicht mehr hören kann. Ihr „Wir“ ist ein anderes, als das von Andri (dessen Buch ich nun zugegebenermaßen auch zum Sündenbock mache), es ist die wütende Antwort der Töchter, die die Suppe werden auslöffeln müssen.
Wie viele solcher Bücher werde ich also noch lesen müssen? Vielleicht ist die Antwort nicht wichtig, vielleicht muss sie aber auch lauten: so viele, bis sie nichts mehr zu sagen haben. Denn bei aller Kritik: Wenn Andri Snær Magnasons Wasser und Zeit eine der selbstgestellten Aufgaben erfüllt, dann, etwas festzuhalten, was es so vielleicht bald nicht mehr gibt: Gletscher und Zeit, um es zumindest nicht ganz so schlimm kommen zu lassen.
[1] David Wallace-Wells ist der Autor von „The Uninhabitable Earth“, der Artikel im Intelligencer https://nymag.com/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html ist 2019 in erweiterter Form auch auf Deutsch als Buch erschienen. The unbewohnbare Erde, Ludwig: 2019.
[2] Roland Barthes: Mythen des Alltags. Vollständige Ausgabe, Suhrkamp 2010 (original: Mythologies. Paris: Edition du Seuil 1957), insbes.: „Der Mythos heute“ (S. 521-316).
[3] Eine ganze Reihe literaturwissenschaftlicher und historischer Arbeiten beschäftigen sich mit der Frage nach den Größenordnungen von Klimawandel und Anthropozän sowie ihrer (vermeintlichen) Unvereinbarkeit, so z.B. Timothy Clark: Ecocrictism on the Edge. The Anthropocene as a Threshold Concept (2015) und Deborah Coen: Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale (2018).
[4] Chakrabarty, Dipesh. „The Climate of History: Four Theses“. Critical Inquiry 35 (2009): 197–222.
[5] Nixon, Robert. Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 2011.
[6]Anders als der Ökonom Henrique Schneider, der mit „Anthropocene Fallacy“ meint, dass die zugrundeliegende Wissenschaft der Anthropozän-Forschung methodisch nicht haltbar sei, geht es mir hier um eine Perspektivverschiebung von Timothy Clarks „derangement of scales“. Vgl. Henrique Schneider: The Anthropocene Fallacy. Learning from Wrong Ideas, 2019 ; zum „derangement of scales“ vgl, Timothy Clark: Scale, in: Telemorphosis. Theory in the Era of Climate Change Vol. 1, 2012.
[7] Ghosh, Amitav. The Great Derangement: Climate Change and the Unthinkable. Paperback edition. The Randy L. and Melvin R. Berlin Family Lectures. Chicago London: The University of Chicago Press, 2017.
[8] Horn, Eva. Zukunft als Katastrophe. Frankfurt am Main: Fischer, 2014.
[9] Clark, Ecocriticism on the Edge, 139-159.
Photo by Agustín Lautaro