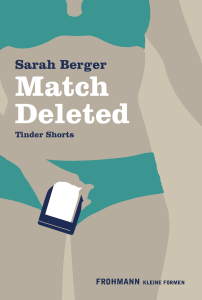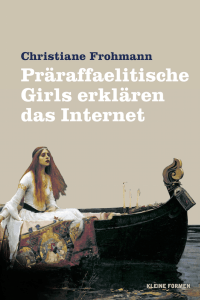von Berit Glanz
[CN Stille Geburt]
Die Bilder erscheinen und ich schaue mit angehaltenem Atem nach den kleinen bewegten Punkten in der schwarz-weißen Flimmerfläche – Herzschläge. Mein Freund drückt mir die Hand, als er die beiden Herzen auf dem überdimensionierten Bildschirm klopfen sieht und ich atme aus. Den Zwillingen geht es gut. Ihre kleinen Herzen schlagen gleichmäßig und es fühlt sich an, als würden sie mir einen Code senden, eine Nachricht, dass das Leben stärker ist als die Angst.
Der Herzschlag ist immer da, bis er eines Tages fort ist. Dann setzt die Ohnmacht binnen weniger Sekunden ein. Ob die Reanimation gelingt, hängt von vielen Faktoren ab. Bei großer Kälte braucht der Körper weniger Sauerstoff, man kann länger ohne Gehirnschäden wieder zurückgeholt werden. Vielleicht muss man im Sommer mehr Angst haben, dass das Herz stehen bleibt.
Das autonome Nervensystem des menschlichen Körpers zeichnet sich dadurch aus, dass man es nicht bemerkt. Der Herzschlag, die Atmung, die Verdauung – unbewusst ablaufende Vorgänge, vom Körper selbst gesteuert. Die Verlässlichkeit dieses Nervensystems habe ich jahrelang nicht hinterfragt. Es war da, wie eine leise gleichmäßige Uhr in meinem Alltag, mal schnell, Sport, Aufregung oder Vorfreude, mal langsam, kurz vor dem Einschlafen. Und nun plötzlich wie ein unregelmäßiger Motor, ein Auto, das stottert, hüpft und stehen bleibt. Todesangst. Sofort. Der Puls rast. Der Kopf wird kalt und heiß gleichzeitig und ein Band aus Metall zieht sich um den Brustkorb fest.
Deswegen hocke ich auf dem Rastplatz, am Rand der halb verdorrten Rasenfläche, und würge Galle. Eine Hummel schwirrt neben der Kotzpfütze um eine Hundeblume. Im Hintergrund rauscht die Autobahn lauter als das Blut in meinen Ohren. Aus meinem Augenwinkel sehe ich einen Lastwagenfahrer in seinem Fahrerhaus sitzen. Er beißt mit leerem Blick in ein belegtes Brötchen. An all dies erinnere ich mich mit sekundengenauer Präzision, weil man im Moment seines Todes die Zeit anders wahrnimmt.
In Filmen wird für solche Moment gerne die Zeitlupe eingesetzt, mit einer kurz darauf folgenden rasch geschnittenen Erinnerungssequenz, wenn das eigene Leben angeblich vor dem inneren Auge abläuft. Ich halte meinen Oberkörper umschlungen und wiege mich hin und her, während mir Erbrochenes, Tränen und Rotze das Gesicht herunterlaufen. Mein Freund schaut sonderbar ruhig, dafür dass ich gerade sterbe. Wahrscheinlich hat er sich mittlerweile an die Panikattacken gewöhnt, daran dass ich das Vertrauen in meinen Herzschlag verliere.
Als die Frauenärztin am Ende des ersten Trimesters eine Kollegin zur Beratung hinzuholt, wissen wir direkt, dass etwas nicht stimmt. Ich fixiere die zwei pulsierenden Punkte und halte mich daran fest, dass meine beiden Kinder noch leben. Unser Sohn entwickelt sich zeitgerecht, doch unsere Tochter bleibt klein und fällt nun Woche für Woche hinter ihren Bruder zurück. Der Grund dafür ist für die Ärztinnen, die uns in den folgenden Monaten betreuen, noch nicht ersichtlich. Es heißt nun abwarten und hoffen und abwarten.
Besonders beim Thema Schwangerschaft und Kinderwunsch wird unser Bedürfnis nach einer Kontrolle des eigenen Körpers sichtbar. Der Schock ist groß, wenn der Körper sich unserer Steuerung entzieht, seinen eigenen Regeln folgt und die eigene Kreatürlichkeit in einer Welle aus Kontrollverlust alles mitreißt. Wir wollen wissen, testen, planen, Sicherheit verspüren in einem Bereich, der sich diesem Bedürfnis fundamental verweigert. Verliert man die Kontrolle, können die Gefühle einen Strudel bilden, der einen mitreißt, zermalmt und verändert wieder auswirft.
Als ich das erste Mal in meinem Leben auf einen Schwangerschaftstest pinkelte, panisch auf der Universitätstoilette auf das ersehnte Resultat wartete, die sich in die Ewigkeit ausdehnende Zeit mit meinem Handy stoppte, wusste ich noch nicht, dass diese Gefühlskaskade nur ein Vorgeschmack war.
Der aufgeregt beobachtete Schwangerschaftstest, die blauen Striche, die Emotionen, wenn das Resultat sichtbar wird – Freude, Schock, Enttäuschung, Trauer. Diese Bilder werden oft in Film, Fernsehen und Werbung aufgegriffen, sie sind Teil des kulturellen Gedächtnisses. Dabei gibt es den heute bekannten Schwangerschaftstest für Zuhause erst seit den frühen 1980er Jahren. Die Ungewissheit über den Zustand des eigenen Körpers, mehrwöchige Schwebezustände zwischen Angst und Hoffnung, das hilflose Deuten von Symptomen, all das wurde durch bessere Testverfahren verkürzt.
Bereits in der Mitte des 20. Jahrhunderts konnte eine Schwangerschaft nachgewiesen werden, indem eine Urinprobe in einen männlichen Afrikanischen Krallenfrosch injiziert wurde, der unter Einfluss des Schwangerschaftshormons hCG binnen weniger Stunden begann Spermien zu produzieren, die sich unter dem Mikroskop nachweisen ließen. In den fortschrittsoptimistischen 50er und 60er Jahren wurde Schwangeren auch das Hormonpräparat Duogynon verordnet. Blieb nach der Einnahme eine Blutung aus, war die Schwangerschaft nachgewiesen. Erst sehr viel später erkannte man, dass die Einnahme dieser Hormone in der Frühschwangerschaft Fehlbildungen auslösen kann, die Gewissheit einen hohen Preis hatte.
Das Bedürfnis nach genauem Wissen, nach messbarer Kontrolle über den eigenen Körper und damit die eigene Zukunft ist so groß und so menschlich, dass der Urintest zur Feststellung der Schwangerschaft sich seit den den 80er Jahren rasant ausbreitete.
Bei jeder der Ultraschalluntersuchungen, die nun ständig erfolgen, suche ich zuerst die Herzschläge. Am Morgen vor den Untersuchungen ist mir übel, ich bekomme Herzrasen, sobald ich das Krankenhaus sehe und muss mich jedes Mal wieder mit weichen Beinen auf die Liege zwingen, das Zittern unterdrücken, wenn das kühle Ultraschallgel auf meinem Bauch verteilt wird. Ich freue mich über jede Untersuchung bei der meine Kinder lebendig in ihren Fruchtblasen zappeln und weiß doch, dass jede Woche, die vergeht, eine schwierige Entscheidung näher bringt, die uns mit ruhiger Stimme angekündigt wurde: Zu einem späteren Schwangerschaftszeitpunkt könnten wir beide Kinder holen und damit die Überlebenschance für unsere wahrscheinlich kranke Tochter erhöhen. Wir können aber auch die Schwangerschaft weiterlaufen lassen und das bestmögliche Ergebnis für unseren gesunden Sohn anstreben.
Es ist ein unerträglicher Schmerz ein schlagendes Herz auf dem Bildschirm des Ultraschalls zu suchen und nicht zu finden. Das Vertrauen in den eigenen Körper verlieren, die Zuversicht aufgeben, dass eine Schwangerschaft in der Ungerührtheit und Unvermeidlichkeit abläuft, die man sich immer vorgestellt hat. Plötzlich findet man sich in einer schweigenden Gemeinschaft von Trauernden wieder, als hätte man die falsche Tür gewählt und müsse sich nun in einem unwirtlichen Raum neu einrichten. Von erfolgreich verlaufener Schwangerschaft wird viel erzählt, aber Fehlgeburt, Totgeburt oder unerfüllter Kinderwunsch bleiben ein Tabu. Es ist schwer sich mit dem Tod zu befassen, mit dem Ende der Hoffnung, dem Scheitern, dem fehlbaren Körper, der nicht wie ein Uhrwerk seine Funktion erfüllt.
Unsere Tochter ist krank, den genauen Grund können uns die Ärztinnen ohne Fruchtwasserpunktion nicht sagen. Doch mit jeder Untersuchung werden neue Hinweise gefunden, die den Verdacht auf eine schwere Behinderung erhöhen. Wir surfen im Internet, lesen über das Leben mit kranken Kindern und wissen nicht, welche Entscheidung wir treffen sollen, ob wir überhaupt eine Entscheidung fällen können. Sollen wir das Leben unseres gesunden Sohnes höher bewerten als das Leben unserer kranken Tochter? Wie können wir Entscheidungen treffen, mit denen wir (über)leben können?
Mit dem Gefühl dem eigenen Körper nicht vertrauen zu können, kommen die Angstattacken. Wer einmal in der Gruppe der Unwahrscheinlichkeit war, in der Gruppe, für die nicht alles gut geworden ist, in der Gruppe der statistisch vernachlässigbaren Einzelfälle, für den verliert die tröstliche Erzählung vom glücklichen Ende ihre beruhigende Kraft.
Der Körper und seine Reaktionen, die Schweißausbrüche, das Herzklopfen, die Übelkeit fangen an den Alltag zu bestimmen. Das Bewusstsein kreist um mögliche Vorzeichen: Was bedeutet diese Schmierblutung? Warum spannen meine Brüste? Sollte mir Abends schlecht sein?
Wir wachsen auf und lernen unsere Körper zu lesen, finden eine Gewissheit in der spezifischen Sprache unseres ganz individuellen Leibes und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, entziehen sich uns die Zeichen. Verloren stolpern wird durch ein Gewirr aus unentzifferbaren Signalen, finden uns in der Fremde wieder, in der die Dinge keinen Sinn mehr ergeben. Wie kann mein Körper, der jahrelang ein vertrauter und verlässlicher Begleiter war, mich so enttäuschen?
Am Ende der 28. Schwangerschaftswoche findet die Ärztin nur noch einen Herzschlag auf dem Ultraschall. Sie verlässt das Untersuchungszimmer, schließt leise die Tür, um uns Raum zu geben. Ich rolle mich auf die Seite, auf meinem Bauch ist noch der Glibber von der Untersuchung. Wie komisch, dass ich mich genau daran so genau erinnere. Nach ihrer Rückkehr klärt uns die Ärztin darüber auf, dass es nun das Ziel sei, die Schwangerschaft so lange wie möglich fortzusetzen, damit unser Sohn den besten Start ins Leben bekommt. Jede weitere Woche ist ein Geschenk, idealerweise schaffen wir es bis zum errechneten Stichtag. Die normalen letzten Monate einer Schwangerschaft, bloß mit einem toten und einem lebendigen Baby im Bauch.
Der schwangere Bauch ist per se ein Zeichen für Körperlichkeit – traditionell konnten sich Spermium und Eizelle ohne Körperkontakt nicht in der Gebärmutter vereinen, den Bauch anwachsen lassen. Auch wenn sich diese Voraussetzungen durch den medizinischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte verändert haben, ist der sich rundende Bauch immer noch ein Verweis auf die elementare Körpergebundenheit des menschlichen Daseins und damit implizit auch auf den Kreislauf aus Entstehung und Vergänglichkeit, der unser Leben bestimmt.
Die Faszination für den schwangeren Körper als Neuanfang, als Beleg für die schaffende Kraft des menschlichen Körpers, führt dazu, dass die Person der Schwangeren zu oft in den Hintergrund tritt. Mit der sichtbar gewordenen Schwangerschaft wird das Individuum von der Körperlichkeit verdrängt. Vielleicht berichten deswegen so viele Schwangere davon, dass wildfremde Menschen ihren Bauch berühren, sie sich als eigenständige Menschen unsichtbar fühlen.
In einer bestimmten Lebensphase beginnt die Gebärfähigkeit immer mehr ins Zentrum zu rücken. Hast du schon Kinder? Willst du Kinder haben? Wieso hast du keinen Kinderwunsch? Die Fragen sind aufdringlich und intim, ignorieren die vielfältige Komplexität menschlicher Existenz und reduzieren Menschen auf das Funktionieren ihres Uterus.
Auf der einen Seite steht diese Reduktion auf das rein Körperliche und auf der anderen Seite der Versuch dieses Körperliche der menschlichen Kontrolle zu unterwerfen. Schwangerschaften exakt zu planen, das Ungeborene auf alle Eventualitäten zu testen, die unappetitliche Körperlichkeit einzuhegen. Die Schwangerschaft wird als leuchtende Lebensphase inszeniert und dabei die vielen unangenehmen körperlichen Realitäten ausgeblendet, die geschwollenen Füße, die Übelkeit, die Rückenschmerzen. Körper, die sich der Reproduktion verweigern, Krankheit und Tod von Schwangeren und Ungeborenen werden als Möglichkeit tabuisiert. Aus diesem Tabu kann eine große Einsamkeit resultieren.
Mein Sohn strampelt in meinem Bauch. Ich ziehe mich zurück, rede mit meiner toten Tochter und meinem lebendigen Sohn. Ich mag nicht mehr unter Leuten sein, denke, dass alle mich und meine beiden Kinder in meinem Bauch anstarren – das Leben und den Tod. Ich fühle mich wie ein lebendes Paradox und möchte mich nur noch verkriechen. Andere Schwangere hören Mozart, um ihr Kind im Bauch zu prägen, ich habe Angst, was die Trauer mit meinem kleinen Sohn macht, der in meinem Bauch so vielen Gefühlen ausgesetzt ist. Ich fürchte mich vor der Geburt, die der endgültige Abschied von meiner Tochter sein wird.
Manche Schwangere klagen über eine Symphisenlockerung, die entsteht, wenn das Wachstum des Ungeborenen die Beckenknochen so auseinanderdehnt, dass sich die Knorpel lockern. Dadurch fühlt es sich bei jedem Schritt so an, als würde jemand mit der Stricknadel von unten in das Becken stechen. Freude über das entstehende Leben zu empfinden, während jede Bewegung schmerzt. Sich nicht beschweren, dankbar lächeln, Leid kommentarlos ertragen, eine Vorbereitung auf die Geburt und das Wochenbett. Schwangerschaft und Geburt bringen den menschlichen Körper in Grenzgebiete, zwingen zu einer Auseinandersetzung mit unseren fehlbaren Körpern.
In den Monaten nach dem Tod meiner Tochter und der wenige Wochen später erfolgenden Geburt, habe ich oft auf dem Bett gesessen, ihr Zwillingsbruder schon schlafend im Bett neben mir, in seinem beige-braun geringelten Schlafsack, die Faust gegen die Stirn gepresst und die Nacht am Nordatlantik war keine Nacht, sondern Tag. Aus dem Fenster konnte ich das Meer sehen, das ein graueres Blau hatte, als der Himmel der Polarnacht – mit dieser eigentümlichen Helligkeit. Mir liefen dann die Tränen das Gesicht hinab. Ich habe wenig geschluchzt und irgendwann nicht mal mehr das Gesicht verzogen. Es war ein Ritual, sobald das Baby schlief, als würde ich einen Wasserhahn anstellen. In mir ein großes Loch, das sich nur nachts mit Wasser füllte. An guten Tagen konnte ich am Horizont die Schneekappe des Gletschers in der Ferne sehen. Wenn ich lange genug auf das Meer gestarrt hatte, die Atemzüge meines Babys schwappten wie leise Wellen durch den Raum, dann war es, als ob ich mich in Salz selbst aufgelöst hätte.
Ich funktioniere, bis ich irgendwann nicht mehr kann und die Angstattacken immer regelmäßiger kommen. Das Vertrauen in meinen Körper, das Leben selbst, ist nachhaltig erschüttert. Ich kann nicht begreifen, dass meine Kinder lebendig sein dürfen, gesund bleiben werden, dass nicht an jeder Ecke die Katastrophe und der Tod lauert.
In der Therapie balanciere ich auf einem wackelnden Balken. Ich soll an einem Punkt stehen bleiben, an dem ich mich wohlfühle. Aber die Anspannung bei dem Versuch das Gleichgewicht zu halten, lässt den Balken immer stärker wackeln. Ich falle herunter.
Die Entscheidung den eigenen Kinderwunsch umzusetzen, ist der Beginn einer langen Reise. Eine Reise, die in der Öffentlichkeit mit großer Leichtigkeit erzählt wird: der Kinderwunsch, das Glück des positiven Schwangerschaftstests, die Phase der Schwangerschaft, mit leichten Anstrengungen aber erträglich, die Geburt, der Schrei, die erschöpft lächelnde Gebärende, das glückliche Wochenbett. Die Realität dieser Reise ist eine andere. Sie kann in die Ziellosigkeit führen oder an Orte, von deren Existenz wir nie geahnt haben. Sie kann über Umwege an einen Ort führen, an den man immer wollte, aber der einem nun fremd und unwirtlich vorkommt. In jeder Reise ist ein Risiko verborgen, nicht jede Reise muss gut ausgehen und doch reisen wir. Es braucht lange, bis ich akzeptieren kann, dass es keine Gewissheit gibt, kein Anrecht auf einen positiven Ausgang der eigenen Erzählung. Mit der Akzeptanz verschwinden die Panikattacken. Ich werde ruhiger.
Ich möchte einen Text über meine tote Tochter schreiben, über meine Angst, über die Panikattacken, über die Trauer. Ich möchte die Dinge in eine Erzählung zwingen, einen Faden durch die Splitter ziehen, das unerträgliche Chaos auffädeln, das diese Zeit kennzeichnet. Aber die fragmentierte Erinnerung an meine Reise lässt sich nicht logisch an kluge Gedanken knüpfen, das Loch fügt sich nicht in ein erzähltes Leben, der Schmerz ergibt keinen Sinn. Es gibt kein glückliches Ende für diese Geschichte, bei dem mit der Erkenntnis alle Bruchstücke an einen Platz fallen, die Ordnung wiederhergestellt wird. Es ist ein Leben mit einem Loch und es ist ein gutes Leben.
Dieser Text wird im Januar 2021 in einer von Barbara Peveling und Nikola Richter herausgegebenen Anthologie mit dem Titel Kinderkriegen: Reproduktion reloaded in der Edition Nautilus erscheinen. Das Buch kann bereits vorbestellt werden. ISBN: 3960542534
Photo by Jilbert Ebrahimi



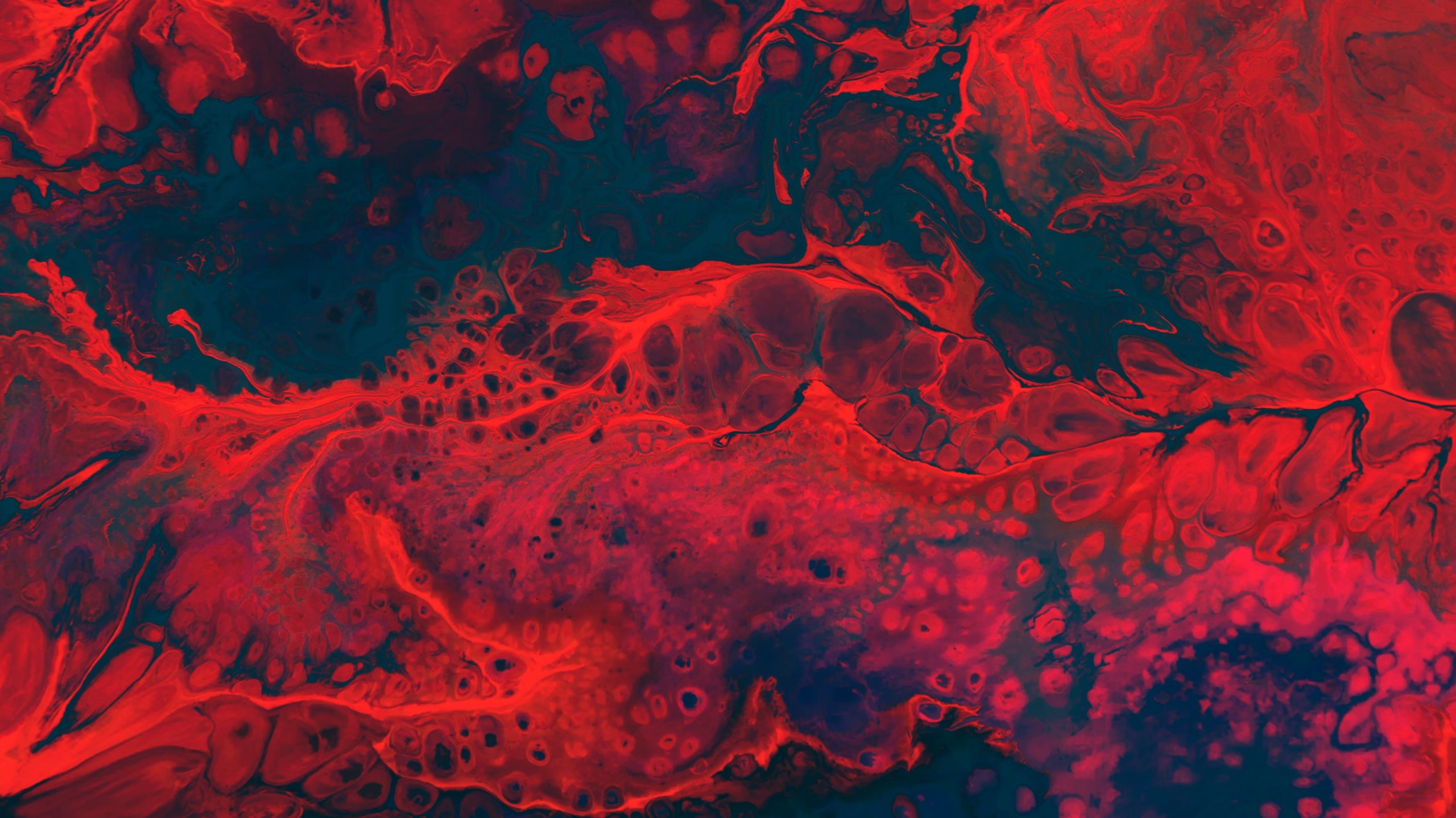

 „Arbeitstitel des Romans, von dem ich behaupte, ich würde ihn schreiben, den ich aber nicht schreiben kann, weil mich langes Erzählen langweilt: Die abgeschnittene Person.“ So schreibt Sarah Berger in Textfragment 503 von bitte öffnet den Vorhang. Das Label “Roman” wird mit langem erzählerischen Atem assoziiert, es ist in dieser Textstelle aber nur noch eine vorgeschobene Behauptung, unzeitgemäß und langweilig. Dieser kurze Ausschnitt verdeutlicht den erheblichen Wandel, dem der Literaturbetrieb gerade unterliegt – eine turbulente Situation, die sich nicht nur durch die verstärkte Medienkonkurrenz erklären lässt, in der literarischer Texte gegenwärtig stehen. Viele dieser Veränderungen stehen in enger Verbindung mit dem drastischen Wandel unseres Lese- und Schreibverhaltens aufgrund der Digitalisierung. Auch wenn es mittlerweile ein Allgemeinplatz ist, lohnt es sich immer wieder zu betonen, dass Menschen nicht weniger als früher lesen, sondern nur anders und an anderen Orten. Aber wie verändert sich das Schreiben oder – noch spezifischer – das Erzählen in Zeiten sozialer Medien? Wie nehmen Schreib- und Lesegewohnheiten im Internet Einfluss auf die Literatur und das Erzählen selbst?
„Arbeitstitel des Romans, von dem ich behaupte, ich würde ihn schreiben, den ich aber nicht schreiben kann, weil mich langes Erzählen langweilt: Die abgeschnittene Person.“ So schreibt Sarah Berger in Textfragment 503 von bitte öffnet den Vorhang. Das Label “Roman” wird mit langem erzählerischen Atem assoziiert, es ist in dieser Textstelle aber nur noch eine vorgeschobene Behauptung, unzeitgemäß und langweilig. Dieser kurze Ausschnitt verdeutlicht den erheblichen Wandel, dem der Literaturbetrieb gerade unterliegt – eine turbulente Situation, die sich nicht nur durch die verstärkte Medienkonkurrenz erklären lässt, in der literarischer Texte gegenwärtig stehen. Viele dieser Veränderungen stehen in enger Verbindung mit dem drastischen Wandel unseres Lese- und Schreibverhaltens aufgrund der Digitalisierung. Auch wenn es mittlerweile ein Allgemeinplatz ist, lohnt es sich immer wieder zu betonen, dass Menschen nicht weniger als früher lesen, sondern nur anders und an anderen Orten. Aber wie verändert sich das Schreiben oder – noch spezifischer – das Erzählen in Zeiten sozialer Medien? Wie nehmen Schreib- und Lesegewohnheiten im Internet Einfluss auf die Literatur und das Erzählen selbst?






 Dieses Zitat leitet der großartige Wolfgang Schivelbusch in seinem Buch „Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert“ nach einigen Vorüberlegungen zur Veränderung der Raumwahrnehmung durch die Eisenbahn mit einer scharfen Diagnose ein: „Die Unfähigkeit, eine dem technischen Stand adäquate Sehweise zu entwickeln, erstreckt sich unabhängig von politischer, ideologischer und ästhetischer Disposition auf die verschiedensten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts.“ Wenn ich nun heute Elegien darüber lese, dass sich die Leute keine Schmuckbände großer Autoren mehr ins Bücherregal stellen wollen oder
Dieses Zitat leitet der großartige Wolfgang Schivelbusch in seinem Buch „Geschichte der Eisenbahnreise: Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert“ nach einigen Vorüberlegungen zur Veränderung der Raumwahrnehmung durch die Eisenbahn mit einer scharfen Diagnose ein: „Die Unfähigkeit, eine dem technischen Stand adäquate Sehweise zu entwickeln, erstreckt sich unabhängig von politischer, ideologischer und ästhetischer Disposition auf die verschiedensten Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts.“ Wenn ich nun heute Elegien darüber lese, dass sich die Leute keine Schmuckbände großer Autoren mehr ins Bücherregal stellen wollen oder  Würden die Hohepriester des Kulturverfalls einen Moment innehalten und sich besinnen auf das, was ihnen vorgeblich so wichtig ist, nämlich den Wissensschatz in den eleganten Hardcovern in ihren Schrankwänden, dann würden sie vielleicht eine andere Tonart anschlagen. Unter B oder E beispielsweise, denn traditionell wurden die Bücher in den Regalen noch nach dem Alphabet sortiert und nicht nach
Würden die Hohepriester des Kulturverfalls einen Moment innehalten und sich besinnen auf das, was ihnen vorgeblich so wichtig ist, nämlich den Wissensschatz in den eleganten Hardcovern in ihren Schrankwänden, dann würden sie vielleicht eine andere Tonart anschlagen. Unter B oder E beispielsweise, denn traditionell wurden die Bücher in den Regalen noch nach dem Alphabet sortiert und nicht nach