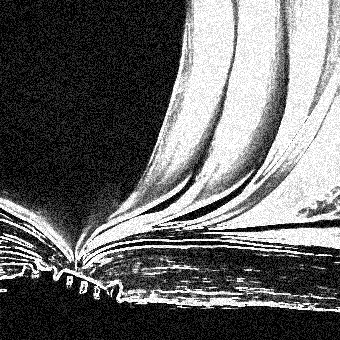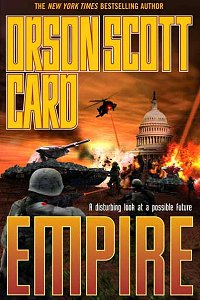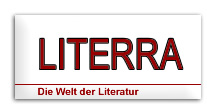
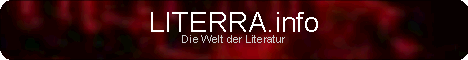
|
|
Startseite > Kolumnen > Thomas Harbach > TRASH & TREASURY > Dit und Dat in Science Fiction Land |
Dit und Dat in Science Fiction Land
Im Jahre 2002 veröffentlichte Kelley Eskridge mit “Solitaire” ihren ersten und bislang einzigen Science Fiction Roman. Im Jahre 2007 folgte noch eine Sammlung ihrer Kurzgeschichten und Novellen, für die sie mehrmals für den HUGO und NEBULA Award nominiert worden ist. Kelley Eskridge ist die Lebensgefährtin Nicola Griffiths, die sich noch den beiden ausgezeichneten und hervorragenden Science Fiction Romanen “Ammonit” und “Untiefen” aus dem Genre verabschiedet hat und jetzt Hardboiled Krimis schreibt. Wer immer darauf gehofft hat, das Nicola Griffith mit ihrer intelligenten Science Fiction mit starken, überzeugenden weiblichen Charakteren zurückkommen wird, findet im vorliegenden Buch mehr als eine Alternative. Im Mittelpunkt steht die Frage, was die Identität eines Menschen, einer Persönlichkeit wirklich ausmacht? Ist sie so von der Person an sich abhängig, das die Identität auch im einer nackten weißen Zelle ohne jegliche Kontaktmöglichkeit zu ihrer Umwelt unverändert weiter bestehen kann? Oder bestimmt doch zu einem gewissen Teil die Umgebung , der Umgang, die Herausforderungen, die Siege und Niederlagen im alltäglichen Kampf mit dem sozialen Dschungel das Ich? Eine Frage, welche insbesondere die Philosophen seit Jahrhunderten beherrscht. Sicherlich auch kein einfaches Thema für einen Erstlingsroman. “Solitaire” besteht handlungstechnisch im Grunde aus drei großen Abschnitten: Vorgeschichte, Strafe und schließlich Rehabilitierung. Alle Kinder, die um Mitternacht des ersten Tag der neuen Weltregierung geboren worden sind, werden “Hope” genannt. Zu ihnen gehört Ren Jackal Segura. Dieser Wunderkinder werden überall gehegt und gepflegt. Jeder globale Konzern ist glücklich, zumindest eines dieser Wunderkinder in seinen Reihen zu haben. Sie sollen spätestens mit Abschluss ihrer sündhaften Ausbildungen in den mächtigen Konzernen eine Art Gegenpol gegen die Weltregierung bilden. Zu Beginn des Roman erfährt die von allen vergötterte Segura, das ihr Leben auf einer Lüge aufgebaut worden ist. Zutiefst erschüttert wird sie Augenzeuge einer Katastrophe, welche fast vierhundert Menschen das Leben kostet. Da der Weltkonzern sich in einem langen Gerichtsprozess, der unweigerlich Seguras Geheimnis aufgedeckt hätte, nicht blamieren möchte, wird sie zum Baueropfern. Sie kann entweder vierzig Jahre ins Gefängnis gehen oder sich für ein fünftel der Zeit in eine Einzelzelle in der virtuellen Realität begeben. Sie entscheidet sich, an diesem neuen Versuchsprogramm teilzunehmen. Bis zu diesem Augenblick ist “Solitaire” ein sehr geradliniger, gut geschriebener Science Fiction Roman. Eskridge nimmt sich sehr viel notwendige Zeit, um Seguras Status, ihre Freunde, ihre Liebhaberin und schließlich auch das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter zu beschreiben. Trotz der stetigen Bewunderung, die ihr entgegenschlägt, ist sie nicht nur eine sympathische Frau, sondern vor allem aufgrund ihrer Fähigkeiten eine wichtige Stütze bei den Konzernprojekten. Der Leser hat durchaus den Eindruck, als ob sie sich ihre Position auch hart erarbeitet hat. Eskridge ist auch überzeugend, eine natürlich von den neuen Medien beherrschte Welt zu zeichnen, in der jeder überall und jederzeit zu erreichen ist, bzw. sich überall und jederzeit natürlich auch in den Nachrichten, SMS, Messages Strom einklinken kann. Dadurch wird der Bruch zur Einzelhaft noch stärker, denn Segura it bislang in ihrem kurzen Leben keinen Augenblick wirklich alleine gewesen. Als Hope hat sie die Macht eines Bush oder Clinton und die Popularität einer Spears oder Hillary Clinton in einem. In ihrer kleinen Zelle - mit virtuellen Lebensmitteln versehen und zumindest mit einem Zugang zu den Unterhaltungskanälen - lernt sie plötzlich, was es heißt, vollkommen alleine, vollkommen isoliert zu sein. Mit einfachen, aber einprägenden Sätzen beschreibt Eskridge eine Zelle, eine Situation, in der es keine Tür nach draußen gibt. Das macht den großen Unterschied zu den “normalen” Zellen aus, in denen sich der Gefangene zumindest durch das Ansehen der Tür die Hoffnung geben kann, irgendwann wieder sie “durchschreiten” zu können. Die Autorin führt ihre Leser in den scheinbar in die Luft geschriebenen Tagebuchaufzeichnungen direkt in die Persönlichkeit ihres Charakters ein. Der Leser verfolgt, wie diese Person nach und nach auseinander bricht. Diese Veränderungen in der inneren Landschaft fasst Eskridge mit sehr einfache Worten zusammen. Da es in diesem Fall für den Leser keine Außenstehende Figur gibt, welche eventuell das Geschehen erläutert, steht man genauso hilflos diesem Prozess gegenüber wie Segura. Nach dem Zerfall im ersten Jahr beginnt sich die junge Frau als Charakter wieder zusammensetzen und zu den stärksten Passagen des Buches gehört, wie sie sich erst mit der Isolation ängstlich auseinandersetzt und sie schließlich auf eine verstörende Weise zu überwinden sucht. Zumindest für Eskridge steht fest, das das Selbst, die eigene Identität in einer isolierten Zelle wie eine Pflanze ohne Licht zusammenfallen muss. Mit ihrer Entlassung aus der Haft beginnt allerdings ein vielleicht noch grausamerer Spießrutenlauf. Sie muss noch ein Jahr auf Bewährung mehrmals die Woche zu ihrem Bewährungshelfer und sich vor allem mit ihrer bekannten Strafe als Massenmörder Arbeit suchen. Einige Versuche schlagen fehl. Zumindest ist ihr eine große Summe Geldes überwiesen worden - der einzige plottechnische Kompromiss, der wirklich nicht überzeugend wirkt und vor allem dem “Überlebenskampf” in einer ihnen feindlich gesonnenen Gesellschaft die Effektivität nimmt -, so dass sie auf ihrer Suche schließlich auf einen Ort, eine Kneipe trifft, die wie ein Magnet andere “Solitaire” anzieht. Konträr am vorliegenden Buch ist vor allem die Tatsache, das Segura als potentielle Managerin und Projektleiterin zu Beginn des Plot eine erstaunlich passive, fast eindimensionale Figur zu sein scheint. Sie gewinnt an Persönlichkeit ausgerechnet in der Situation, die sie nicht mehr beeinflussen kann - in der virtuellen Zelle - und nutzt diesen Gewinn später an der realen Welt. Vergleicht der Leser kritisch die Segura vor und nach der Haft, so lässt sich zynisch feststellen, das sie an Format gewonnen hat. Sicherlich keine Absicht, sondern eher der Unerfahrenheit der Autorin zuzuschreiben, die immer wieder gegen unmenschliche Haftbedingungen im vorliegenden Buch appelliert. Weiterhin wirkt das Ende überstürzt und die Idee, das sie sich schließlich doch an ihrem Konzern “rächen” kann, weil dieser auf ihre Hilfe angewiesen ist, wirkt wie ein fauler Kompromiss. Hier wäre ein typisches Cyberpunkende mit einer fatalistischen Einstellung den Großkapitalisten gegenüber prägnanter und passender gewesen. Oder den Unfall mit den vielen Toten und die folgende Haft zum Teil eines grausamen Experiments zu machen, in dessen Mittelpunkt sich Segura freiwillig gemeldet hat. Die ganze Sequenz hätte dann mit den unabsichtlichen, fatalen Folgen im Cyberspace spielen können. Unabhängig von diesen kleineren Schwächen konzentriert sich Kelley Eskridge sich in erster Linie auf den sehr gelungen, sehr intensiv geschriebenen Mittelteil des Buches, der Einzelhaft in dieser kargen, nackten Zelle Diese Passagen gehört zu den eindringlichsten in ihrem bislang schmalen Werk. Ansonsten überzeugt “Solitaire” durch ihren angenehmen, fließenden Stil, ihren soliden Dialogen und vor allem ihrer technischen Fertigkeit, die Charaktere und Leser immer wieder mit neuen wichtigen Informationen an den Stellen zu überraschen, an denen er/ sie es am wenigsten erwarten. Für einen Erstling eine gelungene und empfehlenswerte Leistung, auch wenn ideologisch die Thesen des Mittelteils nicht alle und vor allem nicht konsequent genug in die spätere Realität übernommen werden.
Der kanadische Autor Robert J. Sawyer ist ein klassischer Ideenautor, wie ihn die Science Fiction nur noch selten hervorbringt. In seinen Romanen kombiniert er oft auf den ersten Blick konträre Ideen zu einem faszinierend, packenden und vor allem zutiefst humanistischen Werk. In “Rollback” - 2007 bei seinem Stammverlag TOR Books erschienen - verbindet er eine First Contact Geschichte mit einem menschlichen Drama um das Altern und das Phänomen der Liebe.
Ausgangspunkt ist die Suche nach intelligentem Leben im All. Im Jahre 2009 geht eine Antwort auf die Botschaften SETIs auf der Erde ein. Die Wissenschaftlerin Sarah Halifax gelingt die Entschlüsselung dieser Botschaft. Sie besteht aus hunderten Fragen zur Ethik und Moral der Menschen. Dank ihrer Erkenntnisse wird sie nicht nur berühmt, sondern die entsprechenden Antworten im Multiple Choice Verfahren zurückgeschickt. 38 Jahre später an ihrem sechzigsten Hochzeitstag trifft die Antwort ein. Ein Milliardär will Professorin Halifax anheuern, um den Kontakt mit den Aliens weiterzuführen. Das Problem sind nur die 38 Jahre, welche die Botschaften brauchen, um zwischen der Erde und dem neunzehn Lichtjahre entfernten Planeten zu hin und her zu gehen. Die Antwort ist der so genannte Rollback- relative Unsterblichkeit. In seinem letzten Roman hat Sawyer spekuliert, dass eine Karte des Gehirns in einen künstlich gezüchteten jüngeren Körper übertragen werden kann. Im vorliegenden Roman werden im Rahmen des “Rollbacks” die Zellen manipuliert und ihnen suggeriert, wieder jung zu werden. Das Verfahren kostet Milliarden und nur wenige Menschen können sich diesen Prozess leisten. Der Milliardär bietet sowohl Sarah Halifax als auch ihrem Mann diesen aufwendigen Regenerationsprozess als Bezahlung für ihre Forschung an. Bei ihrem Mann funktioniert das Verfahren anstandslos, bei ihr aufgrund der Behandlung einer früheren Krebserkrankung nicht. Voller Entsetzen erkennt ihr Mann, das ihre sechzigjährige Ehe aufgrund des immer stärker auftretenden Altersunterschied ihrem Ende zugeht.
Wie in seinen anderen Romanen betrachtet Sawyer insbesondere die menschliche Gesellschaft aus einem extrem verzerrten philosophischen Winkel. Bevor er den Leser mit diversen moralischen Fragen - auf die es keine echten Antworten gibt - konfrontiert, ist es ihm wichtig, den Plot für den Leser griffiger zu gestalten. Im Jahre 2047/ 2048 sind die Halifax über achtzig Jahre alt. Die erste Begegnung mit einer Botschaft der Fremden fand im Jahre 2009 statt. Es ist sicherlich kein Zufall, das zu diesem Zeitpunkt seine beiden wichtigsten Protagonisten das gleiche Alter aufwiesen wie Sawyers durchschnittliche Leser sind. Mit kleinen Informationen schafft er so eine vertraute auf den Unterhaltungsmedien basierende Basis. Die reicht von Zitaten aus STAR TREK über alte Fernsehserien, inzwischen digitalisiert auf DVD bis zum Film “Contact”, der in mancherlei Hinsicht die grundlegende Idee für den vorliegenden First Contact Plot liefert. Kaum hat Sawyer mit Zwischenblenden diese Ebene etabliert, beginnt er seine Protagonisten und im übertragenen Sinne seine Leser mit den verschiedensten, auf den ersten Blick einfachen Fragen zu konfrontieren. Kann der menschliche Geist mit einer derartig drastischen Veränderung seines Körpers, seiner Umgebung überhaupt mithalten? Im Vergleich zu Peter F. Hamiltons Roman “Misspent Youth” gibt Sawyer eine einfach Antwort: Ja, nach einer gewissen Eingewöhnungsphase. Don Halifax lernt eine junge Studentin kennen, die ihn stark an seine Frau erinnert. Er verliebt sich in sie, hat Sex mit ihr und kehrt schließlich reumütig zu seiner langjährigen Frau zurück, um sie in ihren letzten Monaten zu begleiten. Anfänglich übt die Jugend eine Faszination auf ihn aus. Als sich sein Gewissen meldet, zerbricht diese labile Beziehung. Erst als er erkennt, dass er ein neuer Mensch mit den Erfahrungen des Alters, aber ohne der Versuch der konstanten Belehrung zu unterliegen, werden muss, gibt es eine zweite Chance. Die zweite Frage ist für Gesellschaft, was macht man mit einem plötzlich jung gewordenen Pensionär? Nichts mehr. In einigen wenigen drastischen Szenen zeigt Sawyer auf, wie schnell sich das menschliche Berufsleben stetig wandelt und wie schnell ein Spezialist an Wert verliert. Wie gehen die Kinder mit einem Vater oder Großvater um, der plötzlich jünger ist als sie selbst. Dieser Frage weicht Sawyer in einigen Kapiteln geschickt aus. Da es nur zu einem Besuch mit den Familienmitgliedern im Beisein von Professor Sarah Halifax kommt, verschiebt sich der Fokus auf das immer ungleicher werdende Paar. Da der “Rollback” so kostenintensiv ist, zieht Don Halifax - obwohl er im Grunde nur die Dreingabe ist - den Neid seiner Mitmenschen auf sich. Diese Neidgefühle und seine Unfähigkeit, Sarah zu helfen, wecken Schuldgefühle in ihm. Ist eine zweite Jugend, eine zweite Chance wirklich erstrebenswert? Zumindest diese Frage beantwortet Sawyer eindeutig, wenn auch in Bezug auf seine dreidimensional gezeichneten Charaktere zu simpel: ja, es lohnt sich noch einmal zu leben mit der richtigen Frau an seiner Seite. Don Halifax hat das Glück, zweimal im Leben einer solchen Frau zu begegnen und sich zweimal in sie zu verlieben, wenn sie Mitte zwanzig ist. Damit lässt Sawyer Themen wie Einsamkeit nun Entfremdung komplett aus und macht es seinen Protagonisten stellenweise zu einfach. Unabhängig davon gelingt es ihm zum wiederholten Male, sympathische, überzeugende und vor allem natürliche Charaktere zu erschaffen, deren Schicksals- und Lebensweg der Leser gerne und aus Überzeugung verfolgt. “Rollback” ist kein Buch für Jugendliche, denen das Leben noch offen steht. Sawyer spricht eher die mittlere Generation an und stellt ihnen auf dem halben Weg teilweise unangenehme Fragen. Er zeigt ihnen aber auch, das das Leben ein vergängliches Gut ist, das jeden Tag genossen werden muss und das am Ende eines erfüllten Lebens nicht die Angst vor dem Tod, dem großen Nichts stehen braucht.
In “Contact” schicken die Außerirdischen Baupläne für ein Raumschiff, mit dem die Menschen zu den Sternen fliegen können, um Kontakt aufzunehmen. Sawyer dreht diese Idee um. Nach der moralischen Überprüfung der Menschen schicken die Fremden einen genetischen Code, mit dessen Hilfe es schließlich zum Kontakt kommt. Das sich die Fremden nur auf Sarah Halifax und ihre Antworten konzentrierten wirkt unglaubwürdig und überspannt den ansonsten sehr solide, auf gegenwärtiger wissenschaftlicher Theorien basierenden Handlungsbogen. Weiterhin macht Sawyer den Fehler - im Gegensatz zu “Contact” - dem Leser am Ende zu viele Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Epilog wirkt eher nach dem Feel Good amerikanischer Filme konstruiert als wirklich offen und überzeugend. Trotz dieser Schwächen ist “Rollback” ein weiterer Beweis dafür, das gute Science Fiction solide Charaktere und glaubwürdige Prämissen benötigt, um auf diesen beiden Basen zu den Sternen zu reisen. Wie Robert Charles Wilson gelingt es Robert J. Sawyer nicht immer überzeugend, seine Idee in griffige und vor allem durchgängig logische Plots zu pressen, aber alleine für den Versuch gehört ihm die Anerkennung des Publikums. “Rollback” ist eine empfehlenswerte Lektüre, welche unterstreicht, das Leben zwar ein Geschenk ist, dieses Geschenk aber auch gelebt werden muss.
Orson Scott Card hat mit seinen zwei Buchserien um „Ender“ bewiesen, das er ein feines Gespür für politische Strukturen, die Manipulation des Individuums durch Regierungen und schließlich das brüchige Gebilde eines Staates hat. Mit „Empire“ legt der ehemalige Mormone – ein wichtiger Handlungsträger ist Mormone und wird schließlich Notpräsident der Vereinigten Staaten – eine in näherer Zukunft spielende Spekulation über einen zweiten amerikanischen Bürgerkrieg vor. Der Roman spielt im Universum eines gleichnamigen Computerspieles. In den USA hat der vorliegende Roman schon vor seiner Fertigstellung für Unruhe gesorgt. Orson Scott Card hat immer wieder einzelne Entwürfe in das Netz gestellt, um Feedback von interessierten Gruppen und seinen Stammlesern zu erhalten. Ganz bewusst stellt sich Card in der Tradition seiner „Ender“ Romane gegen die klassische Erwartungshaltung, denn er beschreibt eine Welt, in welcher nach der Ermordung des Präsidenten und seines Stellvertreters durch einen perfide geplanten Anschlag die „Progressive Restoration“ mit ihrer kleinen, aber ungewöhnlich modern ausgerüsteten Armee New York aus den Klauen der falschen amerikanischen Regierung befreit. Die Restorationfront ist eine eindeutig linksorientierte Partei, welcher die neokonservativen, patriotischen Strömungen des Landes und ihres eher ambivalent und damit sehr schwach beschriebenen Präsidenten widerstreben.
Der Roman beginnt unnötig in einem der Entwicklungsländer, wo eine Handvoll amerikanischer Spezialisten eine Gruppe von Terroristen tötet, welche auch die einheimische Bevölkerung unterdrücken. Dann erfolgt die Versetzung zurück in die Staaten und auf das College, wo Reuben einem charismatischen Geschichtsprofessor begegnet, der sich für Amerika eine Art römisches Reich mit nur vordergründig demokratischen Strukturen wünscht. Er versucht Reuben für eine geheimnisvolle Mission anzuheuern. Neben seinem Tagdienst in einer der vielen Behörden soll der Offizier geheimnisvolle Lieferungen quer durch die Staaten untersuchen. Zu seinem Tagdienst gehört es, Anschlagszenarien auf den Präsidenten zu entwickeln. Und ausgerechnet einer seiner Pläne wird zufällig vor seinen Augen ausgeführt. Zusammen mit einem Kameraden kann er nicht verhindern, das der Präsident zusammen mit dem großen Teil seines Stabes ermordet wird. In den folgenden chaotischen Tagen löst sich New York aus den USA und strebt die Unabhängigkeit an. Die neue geheimnisvolle Bürgerwehr verfügt über sehr moderne, anscheinend ferngelenkte Roboter – nicht umsonst wird an die Walker aus „Das Imperium schlägt zurück“ erinnert -, welche die reguläre amerikanische Armee schnell aus der Metropole vertreiben. Für Reuben, seine Frau und einige Offiziere stellt sich jetzt die Frage, ob die Loslösung New Yorks nur ein kleiner Bestandteil eines Umsturzplans ist und die jetzt auf den Plan gerufenen politischen Kräfte diese Entwicklung nicht von langer Hand geplant haben.
Handlungstechnisch ist „Empire“ ein sehr geradliniger Roman, der von drei Actionszenen beherrscht wird. Dem Attentat auf den Präsidenten, das Card atemberaubend spannend und dramatisch beschreibt. Die Auseinandersetzung mit den Rebellentruppen und ihren modernen Roboters, die unter der Unglaubwürdigkeit dieser Entwicklung leidet und schließlich das Eindringen in den Stützpunkt der geheimen Finanziers und Hintermänner. Diese Szene ist in James Bond Manier geschrieben, aber die Verquickung zwischen linker Politik und harten Kapitalismus ist zu konstruiert, zu oberflächlich entwickelt. Zwischen diesen Szenen kann und muss der Leser Cards politische Einstellung herauslesen, um sich eine Meinung über „Empire“ bilden zu können.
Card ist kein Anhänger der gegenwärtigen Konservativen. Auf der anderen Seite sieht er aber die Gefahren für die USA sowohl im rechten als auch politisch linken Lager. Die insbesondere in den Medien vorherrschende Polemik heizt seiner Meinung nach unnötig die Stimmung in den beiden Lagern – hier blau und rot – bezeichnet an. Unsachlich werden unterschiedlichste Themen durcheinander gewirbelt. Erstaunlicherweise sieht er den zukünftigen Bürgerkrieg in den USA nicht als Konflikt zwischen arm und reich. Diese Position vernachlässigt Card in seinem Roman komplett. Card versucht seine Ängste in Worte zu fassen, wirkt aber über weite Strecken des Romans wie gehemmt. Ihm fehlt die ferne Zukunft, um seine Ideen deutlicher und vor allem nuancierter auszudrucken. Nicht selten während der Lektüre hat man das Gefühl, als wolle er keiner politischen Richtung seiner Leser wirklich wehtun. Und wenn sich am Ende des Buches der Separatismus auflöst, um einer nachhaltigeren Bedrohung der politischen Ordnung Platz schaffen, bleibt beim Autoren eine gewisse Erleichterung zurück. Zu den wenigen sehr guten Ansätzen gehört der Vergleich der USA nicht mit der Endzeit des römischen Imperiums, sondern dem Ende der römischen Republik und der Machtergreifung durch Octavian. Dieser hat den zivilen Ungehorsam unter Kontrolle gebracht und schließlich eine ganze Reihe von pro Forma gewählten Diktatoren angeführt. Die Konsequenzen sowohl für das römische Volk als auch die Nachbarn lässt Card unerwähnt.
„Empire“ ist kein einfaches Buch. Die von Card entworfene Handlung ist teilweise zu einfach, zu eindimensional gestrickt. Seine politischen Visionen sind radikal und vor allem aufgrund ihrer Prämissen zumindest lesenswert. Da er die Gefahren aus beiden Lagern sieht, wird das Buch weder konservativen noch linksorientierten Kräften gefallen. Das von ihm gestrickte Szenario eines neuen Bürgerkrieges entwickelt sich nicht immer überzeugend. Der Plot gewinnt erst auf den letzten Metern unglaublich an Tiefe, als eine weitere politische Möglichkeit zu abzeichnet. Leider ist der Text zu diesem Zeitpunkt im Grunde schon zu Ende. Um seine Theorien abzuschließen, sollte Card zumindest eine Fortsetzung schreiben, in welcher die Protagonisten in Amerika unter der „Leges Juliae“ leben. Erst dann lässt sich seine Intention wirklich beurteilen, so bleibt „Empire“ ein diskussionswürdiger, aber nicht zufrieden stellender Torso.
Noch gänzlich unbekannt ist der britische Science Fiction Autor John Courtenay Grimwood. Aufgewachsen in Großbritannien, Südostasien und Norwegen. Nach dem Studium hat er für diverse Magazine Artikel und Kolumnen verfasst. Im Gegensatz zu vielen britischen SF Autoren mit ihren barocken Space Operas schreibt Grimwood Quasi- Alternativweltgeschichten. Quasi in Hinblick auf die Abweichung im Zeitstrom zu unseren Welt. Nicht bei allen Romanen sind die Veränderungen spektakulär oder auf den ersten Blick zu erkennen. In seiner „Arabesk“ Trilogie ist der Erste Weltkrieg schon 1915 aufgrund einer Initiative des amerikanischen Präsidenten zu Ende gegangen. Seine Geschichte spielen – wie auch teilweise im vorliegenden Roman – in einer liberalen islamischen Glaubens- und Staatengemeinschaft in Nordafrika. Für seine Romane ist er neben dem BSFA Award auch für den Arthur C. Clarke Award nominiert worden. John Courtenay Grimwood ist kein einfach zu goutierender Autor. Es wäre ungerecht, einen Schriftsteller mit inzwischen sieben Romanen mit anderen Autoren des Genres zu vergleichen. Am ehesten erinnert insbesondere der vorliegende Roman „Stamping Butterflies“ an William Gibsons „Mustererkennung“ mit verschiedenen Handlungsebenen, die scheinbar zusammenhanglos nebeneinander her laufen, bis der Konstrukteur dieser Welt sie elegant verbindet. Wie in Gibsons Roman ist es wichtig, das Gesamtkunstwerk zu betrachten. Schon der Titel ist sorgfältig gewählt. Gibt es doch die alte Sage, das der Flügelschlag eines einzigen Schmetterlings für Chaos in einer geordneten Welt sorgen kann, dessen Auswirkungen Jahrhunderte in die Zukunft reichen.
Um die Handlung und ihr Zusammenspiel in Worte zu fassen, ist es wichtig, die einzelnen Stränge gesondert zu betrachten. Die griffigste und zugänglichste Handlungsebene beginnt in Marrakesch des Jahres 1970. Der Leser lernt die Straßenkinder Moz al-Turq und Malika kennen, den überraschend zugänglichen wenn auch strengen Polizeioffizier Abbas und schließlich den scheinbar aus dem Swinging Sixties Londons in die Stadt gefallenen Rocker Jake Razor, dessen Ruhm schneller vergeht als er es selbst glauben möchte. Mit wenigen intensiven Beschreibungen baut Grimwood eine dunkle, nihilistische Atmosphäre auf, welche die deutlich später spielenden Zeitebenen beeinflussen wird. Unabhängig davon beschreibt er ein märchenhaftes Afrika aus Filmen wie “Casablanca”, das weder der Historie noch der Realität entspricht. Diese Beugung der Fakten wird durch eine geradlinige, wenn auch nicht gänzlich befriedigende sehr rasant erzählte Handlung überdeckt. Die spannendste Handlung spielt in einer eher fiktiven Gegenwart. Der amerikanische Präsident Gene Newman ist kein Hardliner, sondern ein intelligenter, dynamischer Mann, mit beiden Füßen noch auf dem Boden der Realität. Auf der einen Seite verhandelt er mit China wegen der Menschenrechte, auf der anderen Seite bereist er den Mittleren Osten, um die Menschen kennen zu lernen. Hier entgeht er dem Attentat eines Einzelgängers, der mit einem veralteten Gewehr aus zu großer Entfernung auf ihn schießt. Während das Militär schon große Racheaktionen plant, versucht Newman zu ergründen, warum ihn der Gefangene Zero - eine Anspielung auf Alan Moores “V for Vendetta” - erschießen wollte. Gleich nach dem Anschlag verflacht der Handlungsbogen einen Augenblick. Auf dem Transport zu einem weiteren sicheren Gefängnis wird der Gefangene Zero befreit. Dabei kommen einige bisherige Sympathieträger der Handlung ums Leben. Der Leser fühlt sich einen Moment ebenso desorientiert wird der befreite Zero. Die Aktien selbst wird im Verlaufe des Buches erklärt, man hat aber einen Moment das Gefühl, als habe sie Grimwood nur in den Plot integriert, um ein Erstarren der Handlung insbesondere in Hinblick auf die diversen politischen Diskussionen verhindern wollen. Die letzte Handlungsebene spielt in einer fernen Zukunft. Die chinesische Han Dynastie ist wieder erstarkt. So hat es den Eindruck, denn im Grunde ist sie nur aus dem Gedächtnis einer Handvoll chinesischer Astronauten geborgen worden, die in einem Stasisfeld eingeschlossen durchs All driften. In Wirklichkeit befinden sich ihre Bewusstsein in einem gemeinschaftlichen Bewusstsein, deren Mitglieder jeden Gedanken dieser Astronauten in ein graziles politisches Geflecht einweben.
Mit sehr viel Selbstbewusstsein und Routine fügt Grimwood die auf den ersten Blick konträren Handlungsebenen am Ende des Buches zusammen. Ihm fehlt es allerdings sichtlich schwer, den eigentlichen Plot zu beenden. Zu sehr zielt er wie Stephen Baxter auf mögliche Fortsetzungen. Der Autor lässt zwar den Leser mit einer Reihe interessanter Gedankenmodelle zurück, aber wie eine Reihe anderer SF Schriftsteller beschränkt sich Grimwood zu sehr auf das Beschreiben von den Details als der Suche nach Erklärungen. Während diese oberflächlichen Fehler in den ersten beiden Handlungsebenen dank der vielen einzelnen Elemente und Ideen untergehen, stechen sie in der in der fernen Zukunft spielenden Sequenz um so deutlicher hervor. Der Leser hat das Gefühl, als Welt aus vielen kleinen Mosaikteilchen zu betreten, die faktisch nicht komplett zusammenpassen. Grimwood ist ein empathischer Autor, der sich nicht nur stilistisch auf die Erschaffung einer signifikanten Atmosphäre versteht und vor diesem Hintergrund seine kleinen menschlichen und vor allem überzeugend ergreifenden Dramen ablaufen lässt. Wenn der Autor am Ende des Buches auf mehreren Ebenen das Verhältnis zwischen Herrschern und Beherrschten untersucht und die gegenwärtigen politischen und militärischen Spannungen in die mittlere Handlungsebene einfließen lässt, beginnt aus der grundlegenden phantastischen Geschichte der Schmetterlinge ein exzellenter, aber in einer Parallelwelt spielender Politthriller zu werden. Für seine knapp vierhundert Hardcoverseiten im Original ein interessanter, ein packender Roman eines jungen britischen Autoren, der bereit ist, Risiken einzugehen und neue Wege zu gehen. Das unterscheidet ihn insbesondere von Stephen Baxter, Neal Asher oder M. John Harrison, welche trotz aller Experimentierfreude immer wieder auf bekannte Themen oder gar Plothandlungen zurückgreifen, um ihre Texte ambitioniert, aber nicht immer konsequent und entschlossen genug zu erzählen. “Stamping Butterflies” ist in seinem Kern ein modernes, dunkles Märchen mit einer Moral, die sich jedem Leser auf eine andere Art und Weise erschließt. Und das macht den Reiz des vorliegenden Bandes aus.
TRASH & TREASURY
Beitrag Dit und Dat in Science Fiction Land von Thomas Harbach
vom 27. Jun. 2008
Weitere Beiträge
|
|
Eine kleine Welt neben der Eigenen
Thomas Harbach |
|
|
Meine Nachbarn, die Nazis
Thomas Harbach |
|
|
Space and Haldeman
Thomas Harbach |
|
|
Brian W. Aldiss- Leben eines schreibenden Engländers
Thomas Harbach |
|
|
Green for Science Fiction
Thomas Harbach |
| [Seite 1] [Seite 2] [Seite 3] | |
ManuskripteBITTE KEINE MANUSKRIPTE EINSENDEN!
|

Copyright © 2007 - 2018 literra.info